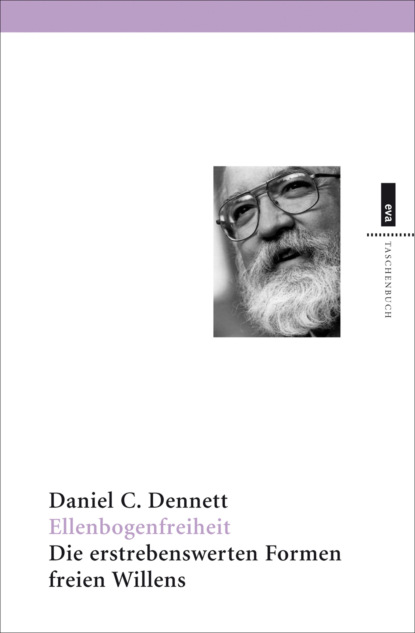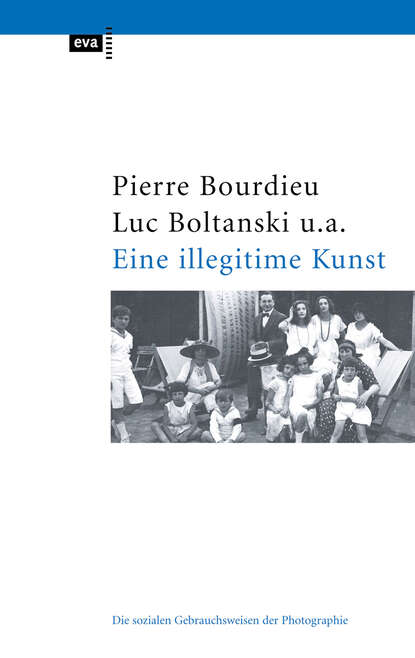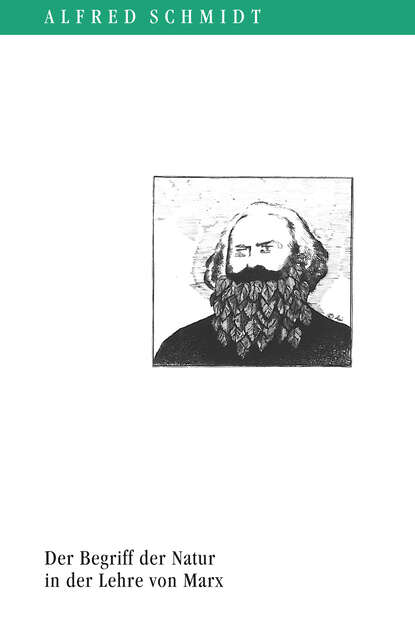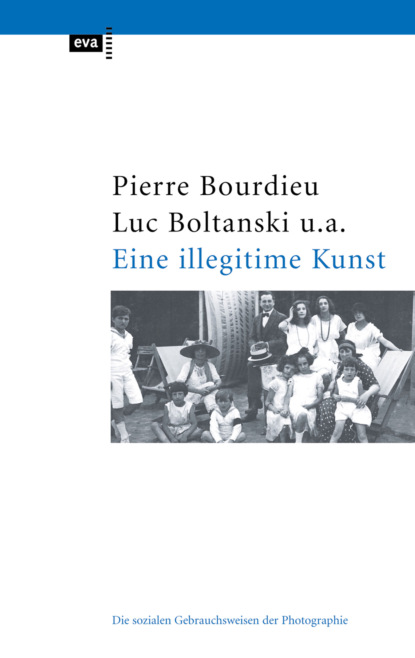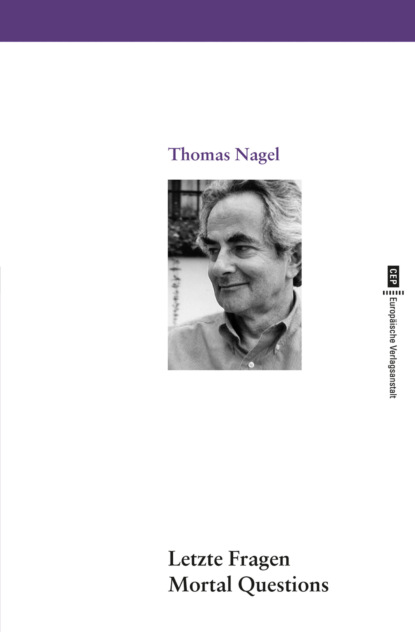- -
- 100%
- +
„Schließlich, wenn immer jede Bewegung verknüpft ist und aus der alten Bewegung immer wieder die neue in bestimmter Ordnung entsteht und die Urkörper nicht durch Abbiegen vom Wege einen Anfang der Bewegung machen, der die Gesetze des Fatums bräche, daß nicht Ursache auf Ursache folge seit unendlicher Zeit, woher kommt dann den lebenden Wesen über die ganze Welt hin, woher kommt, frage ich, dieser freie, vom Fatum losgerissene Wille…?“ (Lukrez, Über die Natur der Dinge, Berlin 1972, II, Zeilen 250–255).
Die oft wiederholte Schwierigkeit bei diesem Lösungsvorschlag (und seinen moderneren Varianten) ist, daß, selbst wenn solche zufälligen Abweichungen passieren, sie anscheinend nicht dazu dienen können, uns die Art von freiem Willen zu verschaffen, die wir uns wünschen. Wenn ein Atom in meinem Gehirn plötzlich mit einer zufälligen Abweichung abdreht, muß es das „völlig grundlos“ tun, und wenn dies mich veranlaßt, etwas Wichtiges zu beschließen oder zu entscheiden, bin ich vollkommen in der Gewalt dieser zufälligen Abweichungen. Zufällige Wahl, so blind und willkürlich wie der Fall eines Würfels oder die Drehung eines Glücksrads, scheint überhaupt nicht wünschenswerter zu sein als vorherbestimmte Wahl. In der Tat waren viele der Meinung, daß es weniger wünschenswert sei, und haben daraufhin verschiedene Möglichkeiten der Vereinbarung des freien Willens mit dem Determinismus vorgeschlagen (verschiedene Varianten des Rekonziliationismus oder, wie er häufiger genannt wird, des Kompatibilismus). Manche dieser Aussöhnungsversuche sind kaum attraktiver als die schreckliche Aussicht, die sie versperren sollten.
Die Stoiker z. B. behaupteten, daß eine gewisse Art von Freiheit darin gefunden werden könnte, daß man nicht gegen das Unvermeidliche ankämpft, sondern vielmehr seine Wünsche nach unten anpaßt, um seiner Lebenslage Rechnung zu tragen. Sie empfahlen eine Haltung weiser Resignation, die sie Apatheia nannten. Und obwohl man bedenken sollte, daß der Begriff während seiner etymologischen Reise bis zu unserer heutigen Apathie vereinfacht und negativ besetzt wurde, bleibt die Tatsache, daß die Stoiker ihre Lehre gerne mit Hilfe manch besonders depriminierender Metaphern erklärten. Jedem von uns ist eine Rolle in der Tragödie des Lebens zugewiesen, so versuchten sie klarzumachen, und es gibt für uns nichts anderes zu tun, als unsere vorgeschriebenen Zeilen so gut, wie wir können, aufzusagen; es gibt keinen Raum, um aus dem Stegreif zu sprechen. Oder man denke an einen angeleinten Hund, der hinter einem Wagen hergezogen wird; er kann friedlich hinterhertrotten oder sich widersetzen. In jedem Fall wird er am selben Bestimmungsort ankommen, aber wenn er sich in seine Bestimmung schickt und das Beste aus der Reise macht, genießt er eine gewisse Art von Freiheit. Mit einem Strick um den Hals durchs Leben geführt zu werden – was für eine Freiheit!
Seit mehr als zwei Jahrtausenden versuchen Philosophen, eine Lehre über den freien Willen zu entdecken, die sowohl attraktiver als auch auf rationalere Weise zu verteidigen ist als diese schrecklichen und nicht sehr anziehenden Anfänge. Es wird oft gesagt (was plausibel ist; aber ich frage mich, wie zutreffend es ist), daß mehr über den freien Willen geschrieben worden ist als über jedes andere philosophische Thema. Jeder Philosoph sollte sich wenigstens ein bißchen verunsichert fühlen, wenn er sieht, daß mit so viel Arbeit so wenig Fortschritt erreicht wurde.
Das Problem mit der Philosophie, sagen manche, ist, daß sie keine Wissenschaft ist; wenn sie wissenschaftlicher wäre, dann würde sie ihre lösbaren Probleme vollständig lösen und den Rest beiseitelegen. Das Problem mit der Philosophie, sagen andere, ist, daß sie versucht, Dinge „wissenschaftlich“ zu sehen, die nur mit Mitteln der Kunst behandelt werden können. Wenn sie ihre Affäre mit der wissenschaftlichen Methode beenden würde, müßte sie ihre Projekte nicht länger in Begriffen vortragen, die das Scheitern garantieren. Das Problem mit der Philosophie ist, glaube ich, daß sie viel schwieriger ist, als es sich sowohl Wissenschaftler als auch Künstler vorstellen, denn sie teilt – notwendigerweise – die Zielvorstellungen und Methoden beider.
Es gibt unabweisbare philosophische Fragen – „Haben wir einen freien Willen?“ ist eine davon –, die klare, wohlbegründete, folgerichtig hergeleitete Antworten verlangen. Wir sollten uns nicht mit verblümten, impressionistischen Antworten abfinden, wie attraktiv oder bewegend sie auch sein mögen. Aber die meisten Versuche, wirklich streng mit philosophischen Fragen umzugehen – und Fragen über die Willensfreiheit sind keine Ausnahme – verwickeln sich in die Probleme voreiliger Formalisierung. Es gibt eine Unzahl von bewußt technischen Arbeiten von Philosophen über das Problem des freien Willens, die, ironischerweise, nur von ästhetischem Interesse sind (für Kenner der Formelarchitektur oder des logischen Schattenboxens), weil sie einfach den Kontakt mit den wirklichen Problemen nicht herstellen können. Eine der Aufgabe angemessene Methode zu finden, ist das ewige erste Problem der Philosophie, und es gab nie einen weitgehenden Konsens über die richtige oder beste Methode. Jedes Buch über den freien Willen gibt ipso facto eine Erklärung über die Methode ab darüber, wie man sich dem Problem nähern sollte. Das vorliegende Buch wird sich in der unmittelbaren Folge dem Problem der Methode bewußter zuwenden. Meine Methode, die sich gleich in Aktion zeigt, nimmt die Wissenschaft sehr ernst, aber ihr Vorgehen ähnelt mehr dem der Kunst.
Zu meiner Studentenzeit dachte ich, ich würde Bildhauer werden, und ich wandte mich mit mehr Energie Holz- und Steinblöcken zu als der Philosophie oder auch der Wissenschaft. Während ich an diesem Buch arbeitete, kam es mir in den Sinn, daß ich die Methoden, die ich im Atelier entwickelte, nicht aufgegeben, sondern einfach das Medium ausgetauscht hätte. Anders als ein Zeichner, der jede Linie mit dem ersten Strich des Zeichenstiftes gleich richtig treffen muß, hat der Bildhauer den Luxus, so lange kleine Stückchen abschlagen und schleifen zu können, bis die Linien und Oberflächen genau richtig aussehen. Zuerst bearbeitet man den Block grob, wobei man ab und zu einen Schritt zurückgeht und ihn argwöhnisch anschaut, um sicherzugehen, daß man sich dem anvisierten Endprodukt nähert. Erst nachdem der Block die richtigen Proportionen angenommen hat, kehrt man zu jeder einzelnen rohen, groben Oberfläche zurück und investiert sehr viel Arbeit, um die feinen Details genauso hinzukriegen.
Manchen Philosophen ist diese Methode, wenn sie sie in der Philosophie antreffen, sehr unsympathisch. Sie haben keine Geduld mit flüchtig entworfenen Lösungen und wollen von Anfang an nichts anderes sehen als scharfe, klare Kanten. Ich strebe nach dem gleichen Endprodukt wie sie, ziehe aber ihre Strategie in Zweifel. Es ist einfach zu schwierig in der Philosophie, gleich den richtigen Start zu erwischen, und nirgends sind die Risiken ihrer Strategie deutlicher zu sehen als in der philosophischen Literatur über Willensfreiheit, die übersät ist mit brillanten, aber nutzlosen Fragmenten. Es ist eines der Themen dieses Buches, daß beim Problem des freien Willens wenig Fortschritte gemacht worden sind, weil die Philosophen einfach die Gestalt der Hauptsache nicht mehr sehen konnten, wenn sie sich in das Thema „freier Wille“ stürzten, um definitiv anzugeben, was sie bei ihrer etwas kurzsichtigen Betrachtung für die wichtigen Teile des Problems hielten.
Aus dem groben Marmorblock des Problems entstehen ein hervorragend ausgearbeitetes Gesicht und ein paar sehr schön polierte Hände und Füße – aber für die Ellenbogen wurde kein Platz gelassen. Die meiste Arbeit in diesem Buch wird im groben Bearbeiten der Gestalt von denjenigen Teilen bestehen, die die Philosophen gewöhnlich mit einer Katzenwäsche hinter sich lassen.
Es wird oft bemerkt, daß das Problem der Willensfreiheit ein einzigartig verpflichtendes oder sogar fesselndes philosophisches Problem ist: Menschen, die sonst überhaupt keinen Geschmack an der Philosophie finden, können dazu gebracht werden, sehr gründlich über das Problem nachzudenken, und sie können wirklich geplagt werden von der Vorstellung, daß die Antworten auf die Fragen sich als „die falschen“ herausstellen könnten.
Warum finden Menschen das Problem der Willensfreiheit fesselnd? Teilweise sicherlich, weil es tiefgehende und zentrale Fragen über unsere Stellung im Universum berührt, über die „conditio humana“, wie man so schön sagt. Aber auch deshalb, so werde ich argumentieren, weil die Philosophen eine Menge von wirklich schreckenerregenden Gespenstern1 heraufbeschworen und dann – ganz zu Unrecht – unterschwellig suggeriert haben, das Problem des freien Willens bestehe darin herauszufinden, ob irgendwelche dieser Schreckensgespenster wirklich existieren.
Dies hat dazu beigetragen, daß es bei diesem Problem an Fortschritten mangelt, weil sich die Philosophen, teilweise weil sie Opfer ihrer eigenen Angstmacherei geworden sind und teilweise weil sie die selbstgebastelte Dringlichkeit benutzt haben, um die Entwicklung metaphysischer Systeme und Theorien zu „motivieren“, eine Reihe von unerreichbaren Zielen gesetzt haben: die Erfindung unmöglicher philosophischer Talismane, die die nicht vorhandenen Übel abwehren sollen.
Ich möchte nicht unterstellen, daß die Philosophen absichtlich und wissentlich die Glut der Angst geschürt oder daß sie die Angst unredlich ausgeschlachtet haben, um eine Pseudomotivation für ihre metaphysischen Fingerübungen zu geben. Wir Philosophen sind eher die Opfer als die Täter der heraufbeschworenen Illusionen. Schließlich sind wir ja die wichtigste eigentlich angesprochene Leserschaft für die Literatur, die sich unschuldig verschwört, um die Fehldeutungen in die Welt zu setzen. Und unsere Komplizenschaft, durch die das Leben der Fehler verlängert wird, rührt teilweise her von dem natürlichen und im Grunde allgemeinen Wunsch, sich an einem Projekt zu beteiligen, dessen Wichtigkeit auch Zuschauern klargemacht werden kann. Wenn dies dazu führt, bestimmte Dinge hier und da zu überdramatisieren, ein paar Kontraste hervorzuheben und ein paar Grenzen zu verschärfen, dann tun wir nur, was jeder andere in seinem eigenen Arbeitsbereich auch tut.
Man beachte zum Beispiel, daß eine meiner Anfangsprämissen – daß die Menschen sich sehr stark für den freien Willen interessieren –, unter meinen Händen bereits eine vertraute Übertreibung erfahren hat. Es ist ja nicht so, als ob sich jeder auf die gleiche Weise dafür interessierte, einen freien Willen zu haben, wie sich jeder dafür interessiert, etwa Schmerzen zu vermeiden oder Liebe zu finden. Wir sollten uns an den Luxus unserer eigenen Teilnahme an dieser Erörterung erinnern. Die meisten Menschen – 99 Prozent und noch mehr, zweifellos – waren und sind immer zu beschäftigt damit, am Leben zu bleiben und sich in schwierigen Umständen durchzuschlagen, als daß sie Zeit fänden oder Lust hätten, sich mit Willensfreiheit auseinanderzusetzen. Politische Freiheit ist für viele von ihnen eine größere Sache, aber die metaphysische Freiheit ist es einfach nicht wert, daß man sich um sie kümmert. Wie Dewey einmal sagte: „Was die Menschen im Namen der Freiheit hoch geachtet haben und wofür sie gekämpft haben, ist verschiedenartig und komplex – aber sicher war es nie eine metaphysische Freiheit des Willens.“ (Dewey 1922, S. 303).
Die meisten anderen Menschen haben sich also über den freien Willen noch nicht den Kopf zerbrochen. Für uns (lieber Leser) ist es aber beruhigend, glauben zu können, daß wir dank unserer Muße und intellektuellen Neigungen ihre mißliche Lage genauer betrachtet haben als sie. Das mag wahr sein. Aber wir sollten vorsichtig sein, wenn es darum geht, unsere ganz spontanen und gegenseitig anerkannten Intuitionen – daß das Problem der Willensfreiheit eine der ganz großen Fragen ist – ungeprüft zu akzeptieren. Denn wir sind eine selbstausgewählte Gruppe. Besonders ist zu beachten, daß die Willensfreiheit ein fast ausschließlich abendländisches Thema ist. Könnten wir irregeleitet sein? Könnte es sein, daß wir nur denken, der freie Wille sei von Bedeutung? Heißt das, daß uns die Frage auch außerhalb des Vorlesungssaales, außerhalb unserer beruflichen Aktivitäten oder mitternächtlicher Diskussionsrunden in Bann hält? Wie Ryle einmal bemerkt, haben wir alle unsere fatalistischen Momente: „Obwohl wir wissen, was es heißt, diese Vorstellung zu haben, sind wir immer noch unbeeindruckt von ihr. Wir sind keine heimlichen Eiferer für sie oder gegen sie.“ (Ryle 1954, S. 28). Fatalismus ist nach Ryle „keine der brennenden Fragen“, und dasselbe kann man von der weitergehenden Frage der Willensfreiheit sagen. Aber man kann sie sicherlich als ein brennendes Problem darstellen.
Wenn der freie Wille von Bedeutung ist, muß es daran liegen, daß es schrecklich wäre, ihn nicht zu haben, und es muß einige Gründe dafür geben zu bezweifeln, daß wir ihn haben. Wovor fürchten wir uns? Wir fürchten uns davor, keinen freien Willen zu haben. Aber wovor fürchten wir uns genau? Und warum? Jeder, dem vor der Aussicht graut, keinen freien Willen zu haben, muß irgendeine Ahnung davon haben, wie schrecklich diese Lage wäre. Und in der Tat sind in der Literatur eine Menge von Analogien zu finden: Keinen freien Willen zu haben, wäre so ähnlich wie im Gefängnis oder hypnotisiert oder gelähmt oder eine Puppe zu sein oder … (die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen).
Ich glaube nicht, daß diese Analogien bloß nützliche Illustrationen sind, bloß plastische Erläuterungsmittel. Ich glaube, sie gehören zum Ursprung des Problems. Hätten wir sie nicht, um die philosophischen Diskussionen zu verankern, würde das Problem der Willensfreiheit wegdriften und wäre bestenfalls noch eine kuriose Frage, um Metaphysiker und Problemkrämer zu verwirren. Ein Aspekt davon läßt sich leicht erkennen. Angenommen, ein Philosoph würde behaupten, das Problem des freien Willens gelöst zu haben; dann könnte ein Laie sagen: „Lindert denn deine ,Lösung‘ meine Sorgen? Wenn nicht, dann ist sie, gleichgültig was sie sonst noch ist, keine Lösung für das, was ich das Problem des freien Willens zu nennen gelehrt wurde.“ Wenn wir uns von der Tradition leiten lassen, dann ist das Problem der Willensfreiheit wesentlich eines, um das wir uns Gedanken machen. Gedanken über den Willen, die von bloß esoterischem Interesse sind, sind gerade nicht das Problem des freien Willens, wie faszinierend sie auch für manche Spezialisten sein mögen.
Aber es ist mehr daran als das. Die Ängste verankern das Problem der Willensfreiheit nicht nur, sie bilden auch seinen Gehalt und gestalten die Dynamik der Argumentation und der Untersuchung. Eines meiner Themen wird sein, daß das „klassische“, „traditionelle“ philosophische Problem der Willensfreiheit in weit höherem Ausmaß ein Kunstprodukt traditioneller Methoden und Voreingenommenheiten der Philosophen ist als bisher angenommen.
Ich schlage vor, die Rolle dieser Ängste zu untersuchen und dabei manche – doch nicht wirklich alle – der Befürchtungen und Verwirrungen, die sich miteinander verschwören und „das Problem der Willensfreiheit“ schaffen, bloßzustellen und dadurch aufzulösen. Das Problem wird sich als ein falsch benanntes und nutzloses Amalgam von übereilten Problemstellungen und selbstgeschaffener Panik herausstellen, als falscher Vorwand für viel anderweitig motivierte Systembildung und metaphysisches Flickwerk.
Es gibt einige unzweifelhaft schreckliche Dinge in unserer Erfahrung, und wenn wir fürchten, daß wir keinen freien Willen haben, dann ist es immer deswegen, weil wir fürchten, daß etwas, das einem dieser schrecklichen Dinge in relevanter Hinsicht ähnelt, unser Schicksal ist. Nur deshalb, weil wir diese mißliche Lage genau kennen und befürchten, daß etwas ähnliches unser Los sein könnte, kümmern wir uns überhaupt um den freien Willen.
Ich werde eine Liste dieser Schreckgespenster vorlegen und sie kurz analysieren. Jedes von ihnen spielt eine Rolle in der traditionellen Diskussion über den freien Willen. Keines davon ist in allen Varianten leicht zu verjagen, aber wenn wir die Ängste untersuchen, dann mag das dazu führen, daß ein paar davon verschwinden. Das heißt (wie Mutter immer sagte): Wenn wir ihnen mutig in die Augen sehen (und unsere Augen nie auch nur ein bißchen abwenden und nie so geschäftig werden und Theorien erfinden), dann können wir feststellen, daß manche von ihnen bloß Erdichtungen unserer Phantasie sind. Wenn wir uns an die Schreckgespenster am Anfang zurückerinnern, dann werden wir in der Lage sein, ihre Schatten in den Untersuchungen weiterer Fragen in den folgenden Kapiteln auszumachen.
In seinem Buch „Der Begriff des Geistes“ versuchte Ryle, indem er uns schockierte oder beschämte, uns eine schlechte Denkgewohnheit dadurch zu nehmen, daß er die Taktik benützte, die von ihm angegriffene Ansicht „mit absichtlicher Geringschätzung als (das) ,Dogma vom Gespenst in der Maschine‘“ zu bezeichnen2. Wenn ich von diesen Schreckgespenstern rede, rede ich auf ähnliche Weise mit absichtlicher Respektlosigkeit (und einer Spur von Karikatur in diesem ersten Kapitel). Denn ich bin der Auffassung, daß diese Metaphern die meiste Arbeit beim Vorantreiben des Problems der Willensfreiheit hinter den Kulissen geleistet haben und daß sie nicht im geringsten den Respekt und den Einfluß verdienen, derer sie sich gewöhnlich erfreuen. Meine Absicht ist also, die Sensibilität ihnen gegenüber zu verstärken und ihren traditionellen Ruhm mit meinen pejorativen Charakterisierungen auszuhöhlen. Einmal ruhiggestellt, werden sie in den folgenden Kapiteln mit einer mehr chirurgischen Einstellung angegangen werden.
2. Die Butzemänner
Die ersten der Schreckgespenster sind in ganz wörtlichem Sinn Butzemänner – Butzemenschen, wenn Sie darauf bestehen –, denn sie werden als Handelnde aufgefaßt, die mit uns in der Kontrolle über unsere Körper wetteifern, die mit uns konkurrieren, die Interessen haben, welche den unseren zuwiderlaufen oder wenigstens unabhängig von ihnen sind. Diese gräßlichen Gesellen werden von den Philosophen oft als Miesmacher benützt und auf die Bühne geholt, wann immer die Angst nachläßt, wann immer die Dringlichkeit des behandelten Themas zweifelhaft wird. Wenn Verwickeltheit auf Verwickeltheit folgt, beginnt der Leser zu gähnen und unruhig zu werden, aber er wird schnell wiederbelebt mit einer andeutungsweisen Analogie: „Das aber wäre so, als ob Sie sich in den Klauen von … befänden“.
Der unsichtbare Gefängniswärter: Gefängnisse sind schrecklich. Gefängnisse sollten gemieden werden. Jemand, der das nicht versteht, gehört nicht zu uns. Wenn Gefängnisse also etwas Schlechtes sind, womit kontrastieren sie dann? Wenn man nicht im Gefängnis ist, ist man frei (in einem wichtigen Sinne), und jeder von uns kann sich dankbar klarmachen, wie froh wir sind, nicht im Gefängnis zu sein. „Aha!“ sagt der Angstmacher. „Was macht Sie so sicher, daß Sie nicht im Gefängnis sind?“ Manchmal ist es offensichtlich, daß man im Gefängnis ist; aber manchmal ist es das nicht. Ein durchtriebener Gefängniswärter mag die stählernen Stäbe in den Fensterrahmen verstecken und Pseudo-Türen an den Wänden anbringen (wenn man eine öffnen würde, sähe man die Steinwand dahinter). Es könnte einige Zeit dauern, bis der Gefangene merkt, daß er im Gefängnis ist.
Sind Sie sicher, daß Sie nicht in einer Art Gefängnis sind?3 Hier ist man eingeladen, eine Reihe von Übergängen in Betracht zu ziehen, die uns von offensichtlichen Gefängnissen zu verschleierten (aber trotzdem fürchterlichen) Gefängnissen bringen, bis zu völlig unsichtbaren und unentdeckbaren (aber trotzdem fürchterlichen?) Gefängnissen. Nehmen wir ein Reh im Magdalen College Park. Ist es eingesperrt? Ja, aber es ist nicht schlimm. Das Gehege ist ziemlich groß. Angenommen wir setzen das Reh in ein noch größeres Gehege – den New Forest mit einem Zaun rundherum. Wäre das Reh immer noch eingesperrt? Mir wurde gesagt, daß im Staat Maine das Rotwild sich während seines Lebens nie weiter als fünf Meilen von seinem Geburtsort wegbewegt. Wenn eine Umzäunung außerhalb der normalen uneingeschränkten Grenzen der Wanderungen, die ein Reh zu seinen Lebzeiten unternimmt, angelegt werden würde, wäre das eingezäunte Reh eingesperrt? Vielleicht; aber zu beachten ist, daß es für unsere Intuitionen einen Unterschied darstellt, ob jemand die Umzäunung angelegt hat. Fühlen Sie sich auf dem Planeten Erde eingesperrt – so wie Napoleon auf Elba festhing? Es ist eine Sache, auf Elba geboren zu werden und zu leben und eine andere, von jemandem nach Elba gebracht und dort festgehalten zu werden. Ein Gefängnis ohne einen Gefängniswärter ist kein Gefängnis. Ob es ein unangenehmer Aufenthalt ist oder nicht, hängt von anderen Faktoren ab; es hängt schlicht davon ab, wie (wenn überhaupt) die Lebensmöglichkeiten der Bewohner eingeschränkt werden.
Der ruchlose Neurochirurg: Wie würden Sie es finden, wenn jemand Sie festbände und Elektroden in ihr Gehirn einsetzte und dann jeden Ihrer Gedanken und jede Ihrer Handlungen kontrollierte, indem er Knöpfe auf der dazugehörigen Bedienungstastatur drückt? Nehmen wir zum Beispiel die ganz typische Heraufbeschwörung dieses Bösewichts durch Fischer (1982): Der ominöse Dr. Black, der im Gehirn des armen Jones die Dinge so arrangiert, daß Black „die Aktivitäten von Jones kontrollieren (kann). Jones weiß unterdessen nichts davon“. Zuerst können wir fragen, – wie wir es immer tun sollten – warum wird dieser andere rivalisierende Handelnde eingeführt? Wozu Dr. Black ins Spiel bringen? Könnte das Beispiel nicht genausogut funktionieren, wenn etwa Jones einen Gehirntumor hätte, der seltsame Ergebnisse produzierte? Was Fischers Vision schrecklicher macht, ist, daß Jones’ Kontrolle seiner eigenen Aktivitäten von einem anderen Handelnden, Dr. Black, an sich gerissen wurde.
Ein Tumor könnte im Gehirn von jemandem dies und das verursachen, und es wäre wirklich furchtbar, einen entkräftenden Gehirntumor zu haben, aber es würde einen schrecklich gewitzten Tumor verlangen, wenn er jemandes Gehirn kontrollieren sollte.
Varianten des ruchlosen Neurochirurgen sind der häßliche Hypnotiseur und der gebieterische Puppenspieler. Wir alle kennen auftretende Hypnotiseure, (wir glauben sie jedenfalls zu kennen;) und besonders schauerlich ist, daß sie anders als der ruchlose Neurochirurg vielleicht keine physikalische Spur ihres Einflusses hinterlassen. Erinnern wir uns, daß von Jones angenommen wurde, daß er nichts von Dr. Blacks Intervention merkt – ein wichtiger Punkt, zu dem wir in späteren Kapiteln zurückkommen. Aber noch heimtückischer sind Hypnotiseure, die ihre Opfer vor einem Publikum zur Schau stellen: Sie zeigen Sie als Opfer, um Sie vor Leuten lächerlich zu machen, die in einer wünschenswerteren Lage sind. Es „hilft“, wenn Sie sich ihr Gelächter vorstellen, wenn ihnen Ihre Misere vorgeführt wird. Der gebieterische Puppenspieler ist ein wenig anders, denn man kann ihn sich so vorstellen, daß er Ihre groben Bewegungen trotz Ihrer Anstrengungen und Wünsche kontrolliert. In den Klauen des gebieterischen Puppenspielers können Sie vergebens kämpfen, wie der Hund der Stoiker, und Sie können wenigstens hoffen, Ihre Verweigerung aus Gewissensgründen dem Publikum zu zeigen, indem Sie sich in ein Stirnrunzeln oder Wimmern flüchten, eine Tröstung, die den Opfern des Hypnotiseurs offenkundig unmöglich ist.
Wir haben noch nie eine wirkliche menschliche Puppe gesehen, aber wir alle wissen von der Sklaverei und wissen, daß es eine schreckliche Situation ist, wenn man sich überhaupt irgendetwas Schreckliches vorstellen kann. Was würden Sie lieber sein wollen: der Zombie von Dr. Svengali oder die bemitleidenswerte menschliche Puppe? Wären Sie lieber ein Sklave oder ein Gefangener? Dies sind alles etwas unterschiedliche Schicksale, jedes auf seine Weise furchtbar, aber es gibt noch andere Bösewichte, die man fürchten muß.
Das kosmische Kind, dessen Puppen wir sind: Nozick schreibt: „Ohne freien Willen scheinen wir eingeschränkt zu sein, bloßes Spielzeug äußerer Kräfte“ (Nozick 1981, S. 291). Wie unwürdig, ein bloßes Spielzeug zu sein, ein Zeitvertreib. Aber wie könnte man das Spielzeug einer bloß unpersönlichen Macht sein? Es kann kein Spielzeug geben ohne Spieler. Und Spieler sind nicht einfach Handelnde; sie sind verspielte, kindliche Handelnde. (Es wird nirgends nahegelegt, es als herabwürdigend zu sehen, wenn man sich selbst als Werkzeug Gottes begreift – viele Evangelisten drücken das ebenfalls aus).