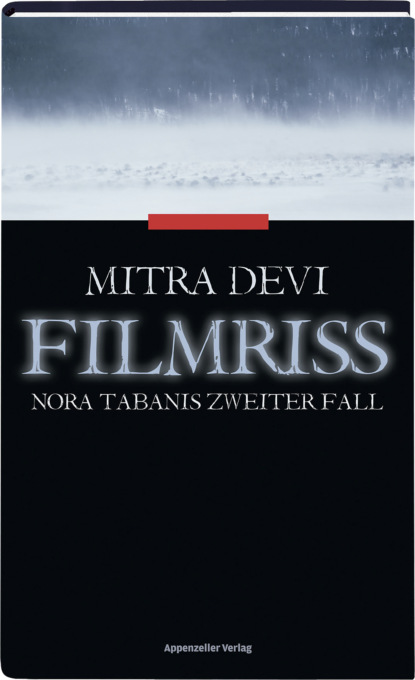- -
- 100%
- +
«Ja, das bin ich», sagte Nora und griff nach einem Kugelschreiber. «Erzählen Sie, was passiert ist.»
«Ich habe ein seltsames Geräusch gehört», sagte Frau Kaiser schniefend. «Ich … ich wollte nachsehen, ob die Kinder schon wach sind, aber als –»
«Wann war das?»
«Vielleicht vor einer halben Stunde.»
Nora schaute auf die Uhr und machte sich Notizen. «Was meinen Sie mit seltsam?»
«Es war eine Art Poltern. Dann glaubte ich, einen Schrei gehört zu haben, mein Gott! Ich war mir nicht sicher. Doch ich hatte eine Ahnung. Irgendwie wusste ich, dass etwas geschehen war. Eine Mutter spürt so etwas. Ich ging also ins Kinderzimmer, als ich …» Ihre Stimme brach erneut. Nora hörte einen Mann im Hintergrund: «Lass mich das machen, Helen.» Ein Rascheln drang aus dem Apparat, dann ein Klicken, als werde die Freisprechfunktion angestellt. «Nein, Markus, es sind meine Kinder!»
«Das ist unfair, Helen. Du weisst, ich liebe sie wie meine eigenen.»
«Hallo?», sagte Nora. «Frau Kaiser?»
«Ich bin da. Wir können Sie beide hören. Mein Mann wollte nicht, dass ich Sie anrufe. Keine Polizei, meinte er, bedeute auch keine Privatdetektive. Aber ich sage, wenn der Entführer –»
«Wer sagt denn, dass es nur einer ist!», warf ihr Mann dazwischen. «Vielleicht sind es mehrere, und du bringst unsere Kinder in Lebensgefahr! Wir beobachten Sie, haben sie geschrieben. Häng auf, Helen, häng endlich den Hörer auf!»
«Nein, das werde ich nicht tun! Helfen Sie uns, Frau Tabani. Bitte helfen Sie uns!»
«Hören Sie, Frau Kaiser, Ihr Mann hat recht. Ich bin nicht die richtige Person für eine Kindesentführung. Ich muss Ihnen dringend raten, die Polizei einzuschalten. Sie hat viel mehr Erfahrung und bessere technische und personelle Möglichkeiten, um –»
«Nein!», rief Frau Kaiser. «Haben Sie denn nicht zugehört? Wir beobachten Sie! Der Entführer würde das erfahren, er würde meinen Kindern –»
«Unseren Kindern!»
«– unseren Kindern etwas antun, sie womöglich gar …» Ein erneutes Schluchzen kam aus dem Hörer, dann vernahm Nora Herrn Kaisers Stimme. «Verzeihung, Frau Tabani. Unser Anruf war ein Irrtum. Meine Frau wird jetzt auflegen, und Sie werden uns einfach vergessen.» Seine tränenerstickte Stimme klang, als ginge ihm das Ganze ebenso nah wie seiner Frau.
«Stop!», rief Nora, «warten Sie! Die ersten vierundzwanzig Stunden nach einem Kidnapping sind die wichtigsten. Danach verliert sich eine Spur sehr schnell. Falls Sie jetzt sofort handeln und die Polizei benachrichtigen, besteht eine gute Chance, dass –»
«Wenn wir das tun», rief Frau Kaiser, «gefährden wir das Leben unserer Kinder! Können Sie das verantworten? Ich habe Ihren Namen im Telefonbuch gefunden. Ich suchte nach einer Privatdetektivin, einer Frau. Wegen des Einfühlungsvermögens, wenn es um … wenn es um Kinder geht. Sie waren die Einzige. Lassen Sie uns nicht im Stich.»
Nora fühlte sich hin- und hergerissen. Was, wenn sie dem Ganzen nicht gewachsen war? Wenn aufgrund ihres Fehlers den Kindern etwas zustiess? Das wäre grauenhaft. Andererseits war es tatsächlich möglich, dass die Entführer Kaisers beobachteten und bei Nichtbefolgen ihrer Warnung die Kinder töteten.
Eine Sekunde herrschte angespannte Stille, dann platzte das Ehepaar gleichzeitig heraus. Er sagte: «Wir legen jetzt auf.» Sie schrie hörbar verzweifelt: «Helfen Sie uns! Wissen Sie überhaupt, wie es ist, um ein Familienmitglied zu bangen?»
Ein Messerstich fuhr in Noras Herz. Das Bild ihres Vaters blitzte auf. Carlo Tabani. Erschossen mit seiner eigenen Waffe. Und Noras Leben danach nie mehr dasselbe. Ihre Entscheidung war gefallen. Sie würde alles tun, was möglich war, um die Kinder heil nach Hause zu bringen. «Ich übernehme den Fall», sagte sie und spürte die Entschlossenheit, die sich in ihr ausbreitete. «Wo wohnen Sie?»
Ein erleichterter Atemstoss kam aus dem Hörer, dann gab Frau Kaiser eine Adresse oberhalb des Toblerplatzes an.
Nora kritzelte den Strassennamen aufs Papier. «Ich komme zu Ihnen, um mir den Tatort anzuschauen.»
«Ausgeschlossen!», gab Kaiser zurück. «Die Entführer könnten unser Haus im Visier haben.»
«Die Täter kennen mich nicht», wandte Nora ein.
«Nein, die Drohung nehmen wir ernst», sagte auch seine Frau und schien sich nun, da sie mit Noras Hilfe rechnen konnte, etwas gefasst zu haben. «Ausserdem graut mir davor, dass jemand davon Wind bekommt. Ich stamme aus einer ehrwürdigen…» Sie zögerte kurz und fuhr dann fort: «Für meine Familie wäre es sehr schlimm.»
«Ich verstehe.»
«Wir werden Sie aufsuchen.»
«Das ist ein kapitaler Fehler, Helen», warf Kaiser ein, aber seine Stimme verriet die Resigniertheit des Verlierers.
«Markus!», drängte Helen Kaiser. «Wir müssen jetzt zusammenhalten!»
Ein Seufzer war zu hören, dann seine apathische Stimme. «In Ordnung. Mach, was du willst. Es sind ja deine Kinder.»
Nora konnte buchstäblich fühlen, wie diese Worte Frau Kaiser trafen. In Extremsituationen kam das Beste und das Schlechteste des Menschen ans Licht. Und ganz besonders zeigte sich, wie eine Beziehung beschaffen war.
«Ich schlage vor», sagte Frau Kaiser, um Kontrolle bemüht, «wir fahren unverzüglich zu Ihrem Büro, damit wir das weitere Vorgehen besprechen können. Markus?»
«Einverstanden, Helen.»
«Gut», sagte Nora. «Sie wissen, wie Sie mich finden. Bringen Sie aktuelle Fotos Ihrer Kinder mit, und schauen Sie nach, ob irgendetwas von ihnen fehlt. Kleider, persönliche Dinge, Spielsachen. Das kann uns Auskunft über die Persönlichkeit der Täter geben. Es eilt. Jede Stunde, die vergeht, ist eine Stunde zu viel.»
Sie hängte auf und versuchte, Jan zu erreichen. Das war definitiv eine grosse Sache, sie würde auf seine Tatkraft angewiesen sein. Immer wieder hatte er ihr angeboten, auch am Sonntag zu arbeiten, doch noch nie hatte sie davon Gebrauch machen müssen. Jetzt war es Zeit für Jans Sonntagseinsatz.
Sie liess es klingeln, bis sich sein Beantworter einschaltete und sprach ihm eine Mitteilung aufs Band. Darauf versuchte sie es auf seinem Handy, fand auch dort nur die Combox vor und hinterliess ihre Botschaft. Komisch. Sie kannte Jan seit über einem halben Jahr, kurz, nachdem sie sich selbständig gemacht und ihr Detektivbüro eröffnet hatte. Jan war sonst Tag und Nacht erreichbar, seine E-Mails las er stündlich, sein Handy nahm er wahrscheinlich mit ins Bett. Noch nie hatte sie es erlebt, dass er einen Anruf nicht entgegengenommen hatte. Wirklich komisch. Sie startete den Computer, schrieb ihm per Mail: «Bitte ruf mich an, dringend!», dann suchte sie die früheren Kidnapping-Fälle aus der Zeit hervor, als sie noch bei der Kriminalpolizei gearbeitet hatte und las sich ein. Die Aussichten waren nicht erfreulich. Einige Fälle wurden erfolgreich gelöst, viele aber endeten mit Blutvergiessen, wurden nie geklärt, die Verschleppten blieben für immer verschollen.
Kurz schaute Nora aus dem Fenster. Es war hell geworden und schneite dicke Flocken, die wie luftige Wattebäuschchen herniederschaukelten. Ein idyllisches Bild, das ihr unter diesen Umständen wie Hohn erschien. In drei Tagen war Heiligabend. Und irgendwo dort draussen harrten zwei neunjährige Kinder in den Händen von Entführern.
6
«Heilige Scheisse, dieser Schnee!», fluchte Hektor lauthals, während er versuchte, zwischen den hin- und herschabenden Scheibenwischern die Fahrbahn zu erkennen. Ein heftiger Wind wehte, die Flocken stieben wie bei einem Schneesturm fast waagrecht gegen den Wagen. Auf der Strasse war um diese Zeit kaum Verkehr. Hektor nahm die Autobahneinfahrt Richtung Uster.
Paco sass hinten neben den gefesselten Kindern, die noch immer keinen Ton von sich gaben, und starrte auf Hektors kahlrasierten Schädel. Er hätte sich keinen Besseren für diesen Job aussuchen können. Ein beschränkter Choleriker, aber einer, der tat, was man ihm sagte. Im Knast hatte man sich erzählt, Hektor Kant habe noch nie eine flachgelegt, jedenfalls keine, die freiwillig mitmachte. Dafür schienen ihn alle Nutten von Zürich zu kennen und zu mögen. Wahrscheinlich hofften sie auf den weichen Kern in der harten Schale. Verstehe einer die Frauen. Vor ihm, Paco, hatten sie Angst, das wusste und genoss er. Und gleichzeitig fanden sie ihn faszinierend. Er sah ja auch umwerfend aus, da spielte er nicht den Bescheidenen. Vom spanischen Vater hatte er die dunklen Augen und Haare, seine rasiermesserscharfen Koteletten zeichneten die markante Kopfform nach, und seinen Körper konnte man nicht anders als phantastisch nennen. Er tat auch genug dafür. Er hatte aufgehört zu rauchen und achtete auf seine Ernährung. Zweimal pro Woche liess er sich von einer Thailänderin massieren. Ganz seriös. Er hatte ihr noch nie irgendwelche zweideutigen Angebote gemacht. So eine war sie nicht. Sie gehörte zur Sorte sensibel und unschuldig, und das reizte ihn viel mehr. Einmal war er zu früh in ihrer Praxis erschienen, hatte sich ihr lautlos von hinten genähert und seine Hände um ihren Hals gelegt. Zu Tode erschrocken war sie zusammengezuckt und hatte sich während der ganzen Massage nicht mehr erholen können. Ihre zittrigen Finger kneteten seine Schultern, und er spürte ihre Angst.
Ein Rucken riss ihn aus seinen Gedanken. Die Kinder kamen langsam zu sich. Sie bewegten sich hin und her und merkten, dass ihre Arme und Füsse zusammengebunden waren. Noch immer trugen sie ihre Schlafanzüge, der Junge einen mit aufgedruckten Oldtimern in allen Farben, das Mädchen einen mit bunten Fröschen und Schildkröten darauf. Lorena döste wieder weg. Lukas blinzelte verunsichert, rappelte sich in eine Seitenlage, gab ein würgendes Geräusch von sich, und Paco stellte ihm einen Kübel vors Gesicht. Chloroform konnte Übelkeit auslösen. Zum Glück hatten sie vorgesorgt.
«Kotz mir nicht das Auto voll! Wenn’s schon sein muss, dann hier rein.»
Der Junge kämpfte sichtlich gegen den Brechreiz, sah verängstigt zu ihm hoch, dann übergab er sich in den Eimer.
Paco wandte den Kopf ab. Wenn er etwas nicht ausstehen konnte, dann war es der Gestank von Erbrochenem. Es machte ihn selber halb krank. Es erinnerte ihn zu sehr an früher. Wie oft hatte er seine Mutter fast zu Tode besoffen in ihrer eigenen Kotze vorgefunden. Schon als kleiner Junge hatte er alles aufgewischt, seine Mutter mit einer Mischung aus Wut, Verachtung und Mitleid gewaschen und so getan, als wäre bei ihnen zu Hause alles in Ordnung.
«Hektor! Mach das Fenster auf!», schrie er nach vorn.
«Willst du, dass die ganze Kälte reinkommt?», brüllte der zurück.
«Ich hab gesagt, reiss das verdammte Fenster auf! Na los, mach schon!»
Augenblicklich fegte ein frostiger Luftzug in den Transporter, und Paco konnte wieder klar denken.
Lukas fuhr sich mit dem Ärmel über den Mund und schaute schuldbewusst zu Boden. «Tut mir leid. Danke für den Eimer.»
Guter Himmel, der Junge bedankte sich bei ihm!
«Wo bringen Sie uns hin? Was machen Sie mit uns?», fragte der Kleine ängstlich. Seine Augen waren geschwollen, seine blonden Haare standen nach allen Seiten ab.
Paco ersparte sich eine Antwort.
«Warum tun Sie das?», blieb Lukas hartnäckig.
Paco seufzte entnervt. «Weisst du, was ich nicht leiden kann?»
«Kinder, die dumme Fragen stellen?»
«Ganz richtig, Bürschchen. Hör zu, du und Lorena benehmt euch schön brav, und in ein paar Tagen seid ihr wieder zu Hause und feiert Weihnachten. Na?»
«Versprochen?», fragte Lukas.
Paco kniff seine Augenbrauen zusammen. «Ich mache niemals Versprechungen.»
«Wie kann ich Ihnen dann glauben, wenn Sie –»
«Lukas, du weisst, was ich nicht leiden kann!»
«Entschuldigung.» Er stockte einen Moment. «Woher wissen Sie überhaupt unsere Namen? Wer sind Sie?» Seine Stimme rutschte eine Oktave höher, er sah hilfesuchend zu seiner Schwester hinüber.
Die kam langsam zur Besinnung, schaute sich um, entdeckte Paco und Hektor und stiess sogleich einen markerschütternden Schrei aus. «Lassen Sie uns sofort raus hier! Sie haben uns entführt! Hilfe! Anhalten! Das ist verboten, was Sie machen!» Sie trat nach Paco, versuchte ihn zu schlagen und zu beissen.
Paco schob sie beiseite. «Was haben wir denn hier für ein temperamentvolles Fräulein? Scheint mehr Schneid zu haben als ihr Bruder, der kleine Hosenscheisser.»
Lukas schaute bei diesen Worten geknickt drein, als wäre es nicht das erste Mal, dass er so etwas vernahm.
«Mein Vater rettet uns!», schrie sie weiter, und die Tränen liefen ihr über die Wangen. «Die Polizei kommt, und Sie müssen für viele Jahre ins Gefängnis! Und dort kriegen Sie nur Bohnen zu essen! Lassen Sie uns raus! Sofort! Wenn Sie uns gehen lassen, dann … dann … erzählen wir niemandem, dass Sie es waren. Nicht wahr, Lukas?»
Der Bruder schaute sie verunsichert an.
«Lukas!»
Jetzt nickte der Kleine.
Paco grinste. Kluges Köpfchen, dieses Mädchen.
«Bitte, Herr Entführer, lassen Sie –»
«Lorena, halt die Klappe. Euch geschieht nichts.»
«Und weshalb tragen Sie dann eine Pistole in ihrer Hose?»
«Ach, die?» Paco nahm sie betont beiläufig heraus und spielte mit ihr. «Reine Vorsichtsmassnahme. Wenn ihr mir allzu sehr auf den Geist geht, dann drück ich hier ab. Hier, seht ihr?» Er zeigte es ihnen. «Und auf den Geist gehen heisst brüllen, heulen, nervige Fragen stellen und nicht gehorchen. Kapiert?»
Lukas wurde bleich, Lorena verstummte für einen Augenblick.
«Also. Ihr seid brav und könnt bald nach Hause. Oder ihr nervt, und ich leg euch um. So einfach ist das. Es macht peng. Nur einmal pro Kind, das reicht völlig. Es ist eine starke Waffe. Und eure süssen kleinen Köpfchen verwandeln sich in blutigen Brei.» Er liess das etwas wirken, dann sagte er mit eisiger Stimme: «Habt ihr mich verstanden?»
Die Kinder blickten ihn erstarrt an.
«Ob ihr mich verstanden habt?»
«Ja», sagte Lukas.
«Ich hasse Sie», murmelte Lorena. Sie sah trotzig zu ihm hoch, ihre nassgeweinten Augen funkelten böse, ihre Lippen zitterten.
Paco verzog seinen Mund zu einem diabolischen Lächeln. «Wir werden eine Menge Spass miteinander haben, kleines Fräulein.»
7
«Bist du Lenny?» Jeff starrte den hageren Typen an, der ihm geöffnet hatte.
Dieser rieb sich verschlafen die Augen. «Was soll das, Mann? Es ist Sonntagmorgen! Schon mal was von Nachmitternachtsschlaf gehört?» Er trug gelbe Boxershorts und ein geblümtes Hawaii-Hemd mit viel zu langen Ärmeln. Dann stöhnte er theatralisch: «Nun komm schon rein.»
Jeff zwängte sich an ihm vorbei durch die Tür und betrat die Wohnung. Ein abscheulicher Geruch empfing ihn. Es stank nach seit Ewigkeiten nicht gelüfteten Schlafräumen, nach kaltem Rauch und vergammelten Esswaren. Jeff konnte kaum atmen. Wenn er nicht gleich seinen Stoff bekäme, wäre es um ihn geschehen, da war er sicher. So was konnte kein Mensch überstehen. «Bist du Lenny?», brachte er nochmals hervor. «Kannst du… kannst du mir helfen? Ich brauch dringend was.»
«Das seh’ ich selber, Alter. Auf was für einem Trip bist du denn? Lenny ist tot, das weisst du doch.» Er ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank, und Jeff folgte ihm. «Willst du ein Bier?»
«Nein», stammelte Jeff. «Ich brauch einen Schuss.» Wie furchtbar dieser Satz in seinen Ohren klang. Das Eingeständnis eines missratenen Lebens.
«Ja, ja, kriegst du ja.» Der Typ öffnete eine Bierdose und trank sie in einem Zug leer. «Setz dich.»
Jeff liess sich auf den hölzernen Stuhl fallen und betrachtete seine zitternden Hände. Der Küchentisch war übersät mit ungespültem Geschirr, klebrigen Getränkeresten und zwei überquellenden Aschenbechern. Unter einem Kerzenstummel und einem halbvollen Glas Wasser lag der Tages-Anzeiger, auf dessen aufgeschlagener Seite ein Artikel über einen erschossenen Drogensüchtigen und Dealer namens Leonard T., genannt Lenny, stand. Jeff griff nach der Zeitung. Neben dem Bericht war das Foto eines unsicher lachenden Mannes mit tief ins Gesicht gezogener Wollmütze abgebildet, der nicht viel älter als zwanzig aussah. Jeff betrachtete ihn ausgiebig. Völlig unbekannt. Kein Wiedererkennen, nicht einmal der Funke einer Erinnerung. «Das ist Lenny?», sagte er. «Wer bist dann du?»
Der andere strich sich seine strähnigen Haare aus der Stirn. «Jetzt hat’s dich aber recht erwischt! Fragst du mich das im Ernst?»
«Hör zu», bemühte sich Jeff, die richtigen Worte zu finden. «Ich bin heute morgen mit rasenden Kopfschmerzen, blutigen Beulen und einer kompletten Gedächtnislücke in einem Gepäckschliessfach eines Bahnhofs aufgewacht!»
«Echt? Du weisst nicht mehr, wer ich bin?» Der andere riss die Augen auf.
Aus Jeffs Stimme klang sein ganzes Elend, als er schrie: «Ja, so ist es! Ich weiss nicht, wer du bist! Ich weiss nicht, wer ich bin! Ich weiss überhaupt nichts! Ich bin ein gottverfluchter Junkie auf Entzug in einer Stadt, die ich nicht kenne, ohne Geld in der Tasche, ohne eine beschissene Erinnerung an irgendwas in meinem Leben! Und jetzt sag mir verdammt nochmal deinen Namen!»
«Wow! Ist ja echt abgefahren», machte der und sah mit einer Art Bewunderung auf Jeff herunter, während er die leere Bierflasche auf die Ablage stellte. «Das ist ja wie im Film ‹Memento›.» Er machte eine kleine Pause, dann fuhr er fort: «Und du verarschst mich wirklich nicht? Du hast eine echte Amnestie?»
«Seh’ ich so aus, als würd ich Witze machen?» Jeff schüttelte den Kopf. «Ich wünschte, es wär so. Und übrigens: es heisst Amnesie.»
«Na gut.» Der andere zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch Richtung Zimmerdecke. «Ich heisse Paddy. Ich bin … wir sind so eine Art Wohnpartner.»
Jeff streckte ihm die Hand hin, Paddy nahm sie in die seine und schüttelte sie erstaunt. «So formell waren wir aber nie.»
«Hör zu, Paddy, du siehst, in welchem Zustand ich bin. Hast du… ich meine, bist du auch drogensüchtig?»
«Alter, wie redest du denn? Drogensüchtig. Sag doch gleich suchtmittelabhängig. Du hörst dich an wie ein Bulle!» Paddy gähnte ausgiebig, schmiss die leere Bierdose in hohem Bogen in einen offenen Abfalleimer, verfehlte ihn und wandte sich wieder an Jeff. «Es ist echt wahr! Du weisst tatsächlich nichts mehr!»
«Sag ich doch.»
Paddy krempelte seine Ärmel hoch und zeigte Jeff eine wüste Ansammlung von blutunterlaufenen Einstichen. «Hier. Ich bin ein Junkie wie du. Heutzutage sind wir der Abschaum, damit du’s weisst. Alles ist hip und trendy und auf Ecstasy, LSD und irgendwelchem Designerdope. All die Börsenheinis und Banker der Bahnhofstrasse zieh’n sich linienweise Koks rein, Zürich ist eine echte Hochburg geworden. Die reichen Säcke sind Tag für Tag zugedröhnt, aber auf uns schauen sie runter wie auf Ungeziefer. Ich sag dir, Sugar ist nicht schlechter als all das andere Zeug. Nur gilt es als totale Looserdroge.»
«Sugar?»
«Heroin, Mann! Das kann ja heiter werden mit dir. Aber lesen und schreiben kannst du noch?»
«Wieso erzählst du mir das alles?»
«Will dich nur vorbereiten, Alter. Ist ein hartes Pflaster hier. Und wir sind die am unteren Ende. Lenny haben die Bullen gekriegt, ist bei einer Razzia umgekommen. Ich dachte erst, die hätten dich auch geschnappt, als ich nichts mehr von dir hörte. Ich bin dein Freund. Falls du das auch vergessen hast.» Er schaute Jeff mit einem undefinierbaren Ausdruck an, und Jeff war sich nicht sicher, ob Paddy die Situation ausnützte oder wirklich meinte, was er sagte. Gab es unter Junkies überhaupt Freunde, oder war sich jeder selbst der Nächste? Paddy konnte ihm alles vormachen, und Jeff würde nie wissen, was der Wahrheit entsprach und was gelogen war. Eine Amnesie machte einen ganz und gar zum Opfer anderer. Wenn dieser Alptraum nur bald zu Ende wäre. Eine Welle von Schmerz erfasste seinen Brustkasten und nahm ihm fast den Atem. «Gib mir was. Ich zahl’s dir zurück. Ehrenwort.»
Paddy brach in schallendes Gelächter aus. «Auf dein Ehrenwort pfeif’ ich! Du auf meins übrigens auch. Wer von uns was hat, gibt dem anderen manchmal was ab und manchmal auch nicht. So läuft das bei uns beiden. Aber heute hast du Glück. Gestern war Zahltag bei mir, hab einen guten Deal erledigt, kannst was haben.»
«Danke, Mann», stöhnte Jeff, «das werd’ ich dir nie vergessen.»
Paddy lachte wieder. «Deine Gedächtnislücke macht sich echt gut! Du wirst ja zu einem richtig netten Kerl!» Er ging aus der Küche und kam kurz darauf mit einer gebrauchten Spritze, einem Löffel und einem Plastiktütchen mit einem weissen Pulver zurück. Aus dem Kühlschrank nahm er ein medizinisches Fläschchen, auf dem Ascorbinsäure stand. «Wie’s geht, weisst du aber noch, oder?»
Jeffs Beine schlotterten unkontrolliert, sein Kiefer klapperte vor Kälte und Schmerz. «Keine Ahnung.»
Paddy stöhnte. «Aber deinen Arsch kannst du noch selber abwischen, oder muss ich dich wickeln?»
«Gib her», sagte Jeff und nahm ihm die Spritze aus den Fingern. Und wie von selber taten seine Hände das, was sie scheinbar so oft getan hatten. Sie griffen zum Wasserglas, füllten den Löffel mit ein paar Tropfen, streuten Ascorbinsäure und das andere Pulver hinein und mischten das Ganze. Ohne dass er hätte sagen können, was als Nächstes kam, wusste es sein Körper. Alles war gespeichert. Flüssigkeit erhitzen, Blubbern im Löffel, aufziehen und wegklopfen der Luftblasen in der Spritze. In seiner Hosentasche fand er das Stück Schnur, und jetzt wusste er, wofür sie gut war. Er band sie sich um den Arm, klemmte sie sich zwischen die Zähne und schnürte sich das Blut ab. Dann pochte er auf seine aufgestaute Vene, bis sie anschwoll. Das eingebrannte Muster. Er mochte seinen Namen vergessen haben, seine Familie, seine Lebensgeschichte, doch was für seinen Organismus das Wichtigste war, wusste er noch. Wider Willen stiegen ihm bei diesem Gedanken die Tränen in die Augen. Er schluckte sie hinunter und leckte sich über die ausgetrockneten Lippen. Dann stach er mit der Nadel in seine Ader, stocherte nervös darin herum und fand die richtige Stelle nicht. «Komm schon!», presste er hervor. «Was hast du mir da für eine stumpfe Nadel gegeben! Ich krieg die nicht rein! Hast du keine neue?»
«Sorry, ausgegangen», meinte Paddy.
Jeff war völlig am Ende mit seinen Nerven. Das würde nie was werden. Er würde hier vor diesem Paddy krepieren. Ein Schluchzer schüttelte ihn, gegen den er sich nicht wehren konnte. Eine Träne tropfte auf den Tisch, und seine Finger zitterten so sehr, dass er mehrmals danebenstach. Grausige Bilder sausten in rasendem Tempo durch seinen Kopf. Wie er Leute niederschlug, ausraubte und betrog für Heroin. Wie er seine Stirn gegen Betonwände knallte vor unerträglichem Schmerz. Dann sah er einen kleinen Jungen, der vor einem Grabstein stand. Neben ihm eine verhärmte Frau, die seine Hand mit eisernem Griff hielt. Lilafarbene Blumen auf dem Grab, eine in Stein gemeisselte Inschrift, die er nicht lesen konnte. War er der Junge? Er wusste nicht, ob das Erinnerungen, Vorahnungen oder Befürchtungen waren. Er wusste nicht, was für ein Mensch er war. Nur, dass er einer war, der alles tun würde, um diesen Horror zu beenden. Die Tränen strömten über sein Gesicht, er murmelte unverständliche Worte vor sich hin. «Es tut mir leid», sagte er immer wieder und wusste nicht, warum. «Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich hab’ das nie gewollt.»
«Mensch, Jeff, du machst mir Angst! Soll ich dir helfen?», fragte Paddy.
«Lass mich, ich schaff das!»
Verbissen stach er sich ins Fleisch, bohrte, stiess und stocherte, suchte das Tor zur Erlösung, den Eingang zur Rettung. Warum dauerte das so lange? Eine rote Flüssigkeit quoll aus seinem Arm, rot wie Krieg, wie Qual, wie Tod, floss auf den Tisch und sickerte ins Holz. Der Schweiss rann über sein Gesicht, der Schüttelfrost packte ihn. Paddys Gesicht verschwamm zu einer verzerrten Grimasse, seine Worte «Schweinerei!» und «verdammtes Schlachtfeld!» ergaben keinen Sinn mehr, verklangen wie Traumbilder in einem Universum des Grauens. Da, endlich. Blut strömte in die Spritze. Die Nadel hatte die Vene gefunden. Jeff atmete auf. Lockerte die Schnur. Und drückte ab.
Augenblicklich durchflutete ihn eine Woge von Wärme, füllte ihn aus, pulsierte durch seine Blutbahn, erreichte sein Hirn. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl ergriff ihn, aller Schmerz fiel von ihm ab, alle Angst, alle Verzweiflung. Das war es, was er gesucht hatte! Befreiung! Mehr noch, es war Liebe, es war Leben! Jeffs Lippen verzogen sich unwillkürlich zu einem verzückten Lächeln. Jetzt war es gut. Endlich war alles gut. Das Rauschen in seinem Körper nahm zu, schwoll an, jagte durch seine Zellen wie feurige Blitze. Die Wärme wurde zu Hitze, zu Licht, zu Gott. Seine Augen fielen zu, sein Kopf kippte nach hinten, sein Leiden kam zu einem Ende.