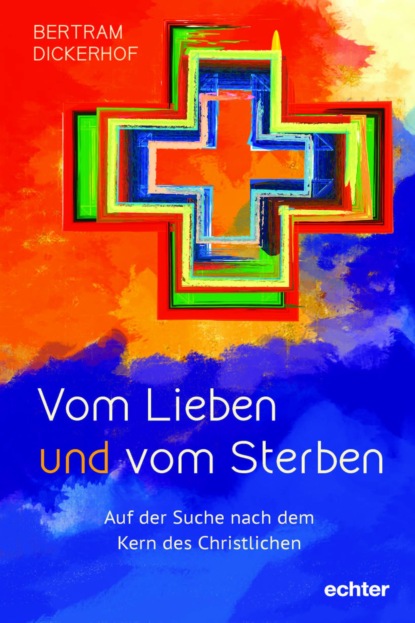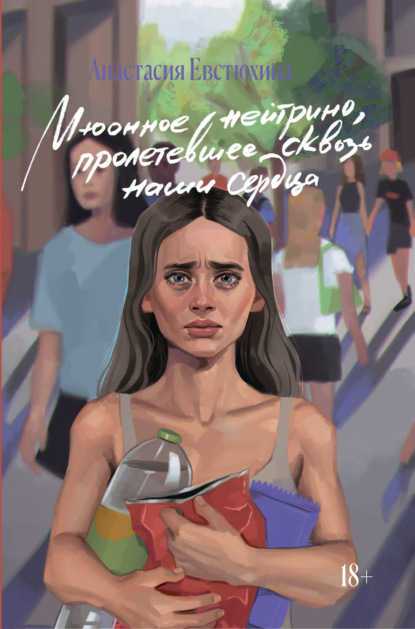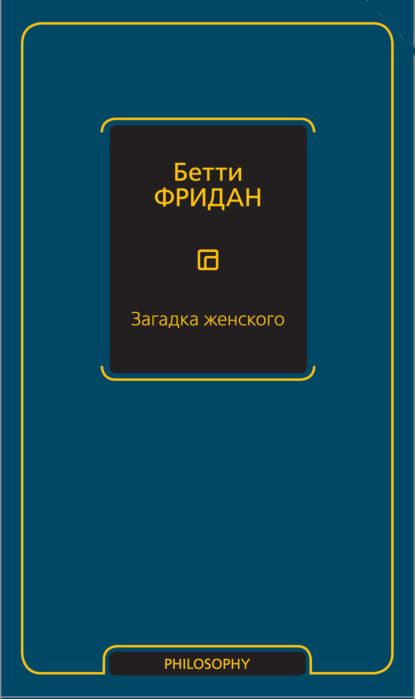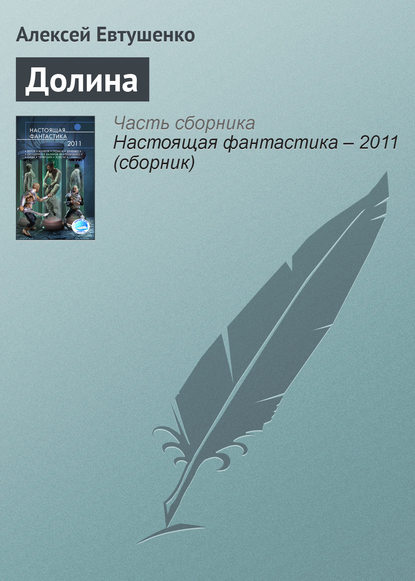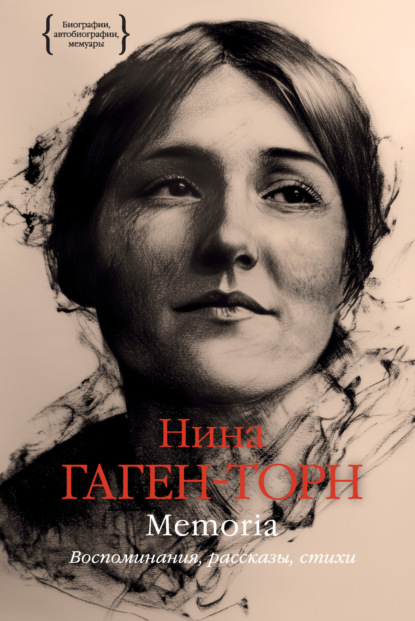- -
- 100%
- +
Schwankend zwischen Angst und Zuversicht, ob der „Menschensohn“ – dieses Wort gebraucht Jesus für sich selbst – tatsächlich am Ende untergehen und sterben wird und sie als seine Jünger womöglich mit ihm (Joh 11,16) oder ob er als Messias und König von Israel mit ihnen zu seiner Rechten und Linken (Mk 10,37) die Herrschaft übernimmt, gingen sie mit ihm nach Jerusalem hinauf, ahnend, dass dort eine Entscheidung fallen wird zwischen leidendem Menschensohn und politischem Messias.
Alles in allem sind die Tage des galiläischen Frühlings und des ungebrochenen Vorschussvertrauens der Jünger in Jesus vorbei. Als eine Frau ihn mit kostbarem Öl salbt, fahren die Jünger6 diese harsch an: Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Indirekt treffen sie damit auch Jesus, der diese Verschwendung nicht nur zulässt, sondern auch verteidigt (Mk 14,4f). Tatsächlich entspricht die Summe von dreihundert Denaren dem, was ein Tagelöhner damals in einem Jahr verdienen konnte, heute etwa 24.000 Euro, wenn man einen Lohn von 10 Euro pro Stunde zu Grunde legt. Doch handelt es sich wirklich um eine Verschwendung? Oder ahnt die Frau, dass Jesu Tod am Kreuz als Hingabe seines Leibes für euch (1 Kor 11,24) derart verschwenderisch ist, jedes menschliche Maß so maßlos übersteigt, dass sie durch ihre „verschwenderische“ Tat die Einzigartigkeit dieser Hingabe und dieser Person würdigen will? So scheint Jesus sie zu verstehen, wenn er sagt: Die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt (Mk 14,7–8).
Wie weit die innere Entfremdung gediehen ist, zeigt folgende Begebenheit beim letzten Abendmahl: Als Jesus davon spricht, dass ihn einer der Zwölf verraten wird, da wurden sie sehr traurig und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? (Mt 26,21). Sie zweifeln nicht nur an Jesus, sondern tragen ihm gegenüber auch Ablehnung und vielleicht sogar Hass in ihrem Herzen, so dass sich keiner sicher ist, ob nicht er selbst es sein wird, der Jesus verrät. Jeder hat Anteil an Judas, der den Behörden den Aufenthaltsort Jesu anzeigt. Als Jesus seinen Jüngern nur ein paar Stunden später ohne jeden Vorwurf voraussagt, dass sie Anstoß an ihm nehmen werden, was sie doch de facto schon seit längerem tun, reagieren sie darauf wie bei den Leidensankündigungen Jesu: Sie blocken ab – umso mehr, als sie sich ertappt gefühlt haben werden: Was als unangenehm und unpassend erscheint, was dem Anschein nach nicht sein darf oder peinlich ist, was stört oder gar Angst macht, wird unter den Tisch gekehrt. Es scheint dann weg zu sein. Petrus kann mit voller Überzeugung behaupten: Auch wenn alle Anstoß nehmen – ich nicht! Jesus sagte ihm: Amen, ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber beteuerte: Und wenn ich mit dir sterben müsste – ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen (Mk 14,27–31). Sie möchten zu ihm stehen, gleich was kommt. Da ihr guter Wille aber mit ihren Zweifeln an Jesus, ihrem Unverständnis, ihrer Kritik an ihm, ja Ablehnung und ihrer Angst vor den Juden nicht verbunden ist, steht dieser Wille auf tönernen Füßen: Sie werden ihr Versprechen nicht halten können.
Und in der Tat ist es schon aus, als Jesus Petrus, Johannes und Jakobus bittet, ihm in seiner Todesangst beizustehen und mit ihm zu wachen. Wer würde das nicht für seinen Freund tun, wenn dieser in seiner Not so klar darum bittet? Dies wollen auch die drei Jünger im Garten Getsemani. Sie hatten eben erst versprochen, bei ihm zu bleiben. Sie wollen es, aber sie können es nicht. Sie vermögen einfach nicht mehr, sich wach zu halten. Zu groß ist die Spannung. Die Augen waren ihnen zugefallen (Mk 14,40; Mt 26,43), vor Kummer erschöpft (Lk 22,45). Sie sind am Ende. Aufgebraucht ist ihre Kraft, die vermiedenen und ungelösten Spannungen zu ertragen. Die Dämme, durch die sie sich selbst und ihre Liebe zu Jesus schützen wollten, brechen vollends ein, als die Häscher kommen. Sie kapitulieren und fliehen. Außer Petrus. Er reißt sich zusammen, überwindet seine Angst und setzt sich der feindlichen Umgebung des hohepriesterlichen Hofes aus, um bei Jesus zu sein. Doch seine verdrängten Gefühle und Bedürfnisse unterminieren die Mauer aus Willen und Vorstellung: Petrus verleugnet Jesus dreimal mit wachsender Aggression gegenüber denen, die ihn in Frage stellen (Mk 14,71). Als er merkt, was geschehen ist, was er getan hat, bricht er zusammen und kapituliert ebenfalls.
Wir wissen nicht, was mit den Zwölfen – das war der Name für den Kreis der zwölf Apostel auch nach dem Weggang des Judas – geschieht. Es sind die Jüngerinnen Jesu, die Frauen, die unter seinem Kreuz stehen oder aus der Ferne Anteil an seinen Leiden nehmen und den Verstorbenen zu seinem Grab begleiten. Bei alledem sind die Zwölf nicht dabei!7 Ihr Fehlen mag Zeichen ihres mangelnden Mutes sein und Ausdruck des Anstoßes, den sie an Jesus nehmen. Doch geht die Bedeutung ihres Fernbleibens weit darüber hinaus: Denn bei Markus und Matthäus verschwinden die Zwölf als Handlungssubjekte komplett aus der Geschichte. Am radikalsten bei Markus: Kein einziger ihrer Namen taucht in seinem Evangelium noch einmal auf. Bei Matthäus finden wir sie erst Tage oder Wochen später wieder auf einem Berg in Galiläa, auf dem ihnen der Auferstandene erscheint, ein Widerfahrnis, das sich ohne ihr Zutun ereignet. Das Verschwinden der Zwölf als Akteure aus dem Evangelium erinnert an die Sterndeutergeschichte und das Verschwinden der Magier aus ihr in Jerusalem. Die Magier wie die Zwölf – sie sind wie aus der Geschichte gefallen, wie vom Erdboden verschluckt, wie gestorben und begraben mit dem, den sie suchten bzw. dem sie folgten. Und in der Tat wird dieses Ende Jesu den Zwölfen den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Nicht nur ihre menschlichallzumenschlichen Hoffnungen auf gutes Auskommen, Einfluss und Ansehen zur Rechten und Linken des regierenden Messias sind in den Abgrund des Nichts gefallen. Nicht nur erleiden sie den Verlust eines Menschen, der ihnen nahe war, den sie geliebt haben. Vielmehr ist alles in Frage gestellt, was sie in allen Zweifeln und Prüfungen bei Jesus bleiben ließ: die Verheißung ewigen Lebens, ihr Glaube, dass durch ihn das Reich Gottes kommt. Denn kein Gott tritt hervor und wendet das Blatt der Geschichte, vertreibt die Heiden und die Sünder, stellt das Reich Davids wieder her. Im Gegenteil: Römer und Herodes behaupten sich. Und das Rad der Geschichte dreht sich weiter, wie es sich immer gedreht hat, die Welt wird nicht gerichtet und anscheinend beginnt auch kein neuer Äon. Gott hat geschwiegen, hat Unrecht und Böses geschehen lassen. Wieder einmal, wie so oft. Oder hatte er gar Jesus verlassen (Mk 15,34)? Konnte es denn sein, dass „ihr“ Jesus von Gott verflucht war, wie es in der Torah geschrieben steht: ein Gehenkter ist ein von Gott Verfluchter (Dtn 21,23c)? Sollte es denn möglich sein, dass Jesus, der doch Worte ewigen Lebens hatte, wie ihnen schien, sie nicht zu Gott, dem Ziel der menschlichen Sehnsucht, sondern in die Gottferne führte, in der sie ja nun tatsächlich saßen? War Jesus doch der Gotteslästerer, der sich zum Sohn Gottes gemacht hatte, als den der Hohe Rat ihn verurteilt hatte? Verwirrung, Angst, Ohnmacht, Sinn- und Perspektivlosigkeit … Passion und Tod Jesu befördern sie unversehens aus dem Raum des Außen und der historischen Ereignisse in den Raum des Innen, der Bewusstheit von Gedanken und Gefühlen, Empfindungen, inneren Bewegungen, geistigen Gegebenheiten, den sie bis dahin kaum kannten und so oft vermieden hatten. In der Tat hatten sie ja nichts wissen wollen vom Ende des Menschensohns in Jerusalem, von ihrer Entfremdung gegenüber Jesus, ihrer inneren Verwandtschaft mit Judas. Das Johannesevangelium berichtet anschaulich, dass die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren (Joh 20,19). Damit schützen sie sich vor den Juden, liefern sich aber all den Empfindungen und Gefühlen aus, die die Ereignisse der letzten Stunden, Tage, Wochen in ihr Bewusstsein spülen. In deren Untergrund brodelt die Schlüsselfrage: Wer ist Jesus aus Nazareth in Bezug auf Gott wirklich und wie ist Gottes Reich zu verstehen?
WACHSTUM UND SÜNDE
Halten wir ein wenig inne, um das Geschehene nachwirken zu lassen. Wer meint, Nachfolge Christi sei nur ein leichtes und unbeschwertes Dahingleiten, wird angesichts des Weges der Jünger mit Jesus eines anderen belehrt: Ambivalenz von Glauben und Unglauben, Spannungen von Verstehen und Nichtverstehen, von Zeiten des Trostes und Durststrecken, von Verlust, Leid und Tod, von Vertrauen einerseits und Enttäuschung, Vorwürfen und Zweifeln andererseits. Ambivalenzen und Polaritäten gehören zu einem Glauben, der auf Wachstum angelegt ist: Man denke an Jesu Gleichnisse vom Senfkorn, das das kleinste von allen Samenkörnern [ist]; sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum (Mk 13,32), oder vom Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Sea Mehl8 verbarg, bis das Ganze durchsäuert war (Mt 13,33). Wachstum geht aber vonstatten nur in Spannungen und durch Krisen hindurch: Was bislang Sinn stiftete, plausibel erschien, Fundament des eigenen Lebens war, beginnt zu verblassen oder gar durch ein Ereignis auf einen Schlag zusammenzubrechen.
Die Hinrichtung Jesu war für die Jünger ein solches Ereignis. Unglück, Verlust und Leid bleiben ihnen nicht erspart. Ein Teil der dadurch ausgelösten Krise besteht darin, dass selbstverständliche Grundannahmen über das Leben, da sie nun nicht mehr funktionieren, zu Bewusstsein kommen können – wie z. B. die Vorstellungen der Jünger vom politischen Messias, vom Reich Gottes als einem Wohlfahrtsstaat, von einem Gott, der in die Geschichte eingreift wie eine innerweltliche Ursache. Es gilt, sich die Wahrheit einzugestehen und seine gewohnten, aber falschen Vorstellungen loszulassen und zu kapitulieren.
Der Kern dessen, was eine Krise aufdeckt, ist die Wahrheit der Sünde. Das zeigt uns das Beispiel des „verlorenen Sohnes“ (Lk 15) im Gleichnis vom barmherzigen Vater, durch das wir versuchen wollen, diesen für die Schrift wichtigen, aber schwierigen und unmodernen Begriff „Sünde“ zu verstehen. Der jüngere Sohn hat sein Vermögen durchgebracht und beneidet hungernd die Schweine um ihr Futter. Ähnlich wie die Jünger ist auch er eingeschlossen in einer ausweglosen Situation. Und so wird der Weg frei für das Entscheidende: Da ging er in sich … (Lk 15,17). Er wird seiner unbewussten Vorstellungen vom Leben und seines diesen entsprechenden Strebens inne. Er erkennt sie als Verfehlung, als Sünde: Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich, Vater, versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein (Lk 15,18f). Das Wort „Sünde“ ist weitgehend aus unserem Sprachgebrauch verschwunden, keineswegs aber das damit Gemeinte aus der Realität, wie wir gleich sehen werden, wenn wir den „verlorenen Sohn“ weiter begleiten. Worin mag er seine Sünde sehen? Sein Erbteil zu fordern, wie er es tat, war rechtlich möglich, entsprach jedoch nicht den Gepflogenheiten in Israel und bürdete zudem der Familie einen finanziellen Aderlass auf. Vielleicht erkennt er Schuld darin, möglicherweise auch in dem zügellosen Leben, das er dann führte und bei dem er sein Vermögen verschleuderte (Lk 15,13). Sünde führt zu schuldhaften Taten, für die der Täter verantwortlich ist – aber Schuld macht das Phänomen Sünde nicht aus. Das Wesentliche der Sünde liegt verborgen hinter der Schuld. Sünde ist zuerst eine existenzielle Kategorie, nicht eine moralische.
Dem jüngeren Sohn muss es so erschienen sein, dass er sein Glück nur finden kann, wenn er restlos alles, was ihm zusteht, fordert – nicht etwa nur einen Teil, um so seiner Familie entgegenzukommen. Er begibt sich in die Fremde und schneidet damit alle bestehenden Beziehungen zu seiner Familie, seinen Freunden und zu seiner Heimat ab. Sein zügelloses Leben mag ihm Kumpane und Gespielinnen schaffen, es verhindert jedoch echte Begegnungen und personale Beziehungen. Der drohende finanzielle Ruin kann ihn nicht davon abhalten, sein Vermögen restlos durchzubringen. Wir können in diesem Verhalten des jüngeren Sohnes eine Fixiertheit auf die eigenen Vorstellungen und Bestrebungen sehen, die sich gegenüber berechtigten Anliegen anderer ebenso verschließt wie überhaupt gegenüber Beziehungen: Der jüngere Sohn will sich nicht stören und nicht in Frage stellen lassen. Er wirkt wie gefangen in einer Eigenwelt, die blind für die Wirklichkeit ist: Wie kann er glücklich sein, wenn ihm das Geld, das er für sein Glück braucht, zwischen den Fingern zerrinnt? Diese Eigenwelt hat zerstörerische Wirkungen auf andere, z. B. die Familie, und auch auf ihn selbst: Am Ende steht er völlig verarmt und von allen verlassen da. Diese Zerstörung bewirkt allerdings auch, dass seine Eigenwelt aufgedeckt und als Sünde erkannt werden kann, wie der Fortgang der Geschichte zeigt: Sünde ist die geistige Macht, die den Menschen verschließt und in eine starre, beziehungsfeindliche, eigentümliche Welt einsperrt, deren Boden Angst ist – denn Angst ist es, die Verschlossenheit und Starre bewirkt. Erfüllung, die im Menschen angelegt ist und sich durch Beziehungen entfaltet, wie an den lebendig machenden Begegnungen mit Jesus zu sehen ist, wird durch die Sünde verhindert. Durch die Sünde wird das Leben verfehlt, der Schöpfer dieses Lebens und auch der Mitmensch.
Dem „verlorenen Sohn“ geht all das nun an diesem Karfreitag seines Lebens auf, als er die Schweine um ihr Fressen beneiden muss. Er kann in sich gehen und seine Sünde erkennen. Die Weise, wie er als Mensch bisher unterwegs war, stirbt dadurch. Er kann nicht mehr derselbe Sohn sein, der er war: Mach mich zu einem deiner Tagelöhner! (Lk 15,19). Das ist die Kapitulation: das Loslassen-Können des bisherigen naiv gewissen Lebensfundamentes, des bisher Plausiblen und Sinnstiftenden, um die Wirklichkeit, an der nicht mehr vorbeizusehen ist, annehmen zu können. Auch die Jünger werden sich ihre Sünde eingestehen müssen, die durch das Abblocken eines klärenden Gesprächs sie die Begegnung mit Jesus verfehlen, sich ihm entfremden und ihn verlassen ließ, so dass er ohne seine Freunde leiden und sterben musste. Die Sünde und ihre Macht sind jedoch nicht das Ende: Der „verlorene Sohn“ gewinnt sich selbst als Person. Der barmherzige Vater nimmt den Sünder an. Er verleiht ihm eine neue Sohnschaft und Herrschaft. Das werden auch die Jünger erleben.
Die entscheidende Voraussetzung dabei ist Vertrauen. Der „verlorene Sohn“ vertraut darauf, dass sein Vater ihn als Tagelöhner aufnehmen wird. Auch die Jünger können sich einen Rest an Offenheit bewahren durch ihre Erfahrungen mit Jesus und ihre Liebe zu ihm. In dem Maß allerdings, wie wir nicht vertrauen können, dass das Sterben in einer solchen kreuzigenden Lebenssituation in Auferstehung gewandelt wird, bleibt uns nur die Devise „lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir tot“ (1 Kor 15,32; Jes 22,13).
5 Zur Weisheitsliteratur zählen die Bücher Ijob, Sprichwörter, Kohelet, Jesus Sirach und Weisheit; für sie ist wahrer Humanismus ohne Gottesfurcht undenkbar.
6 Nach Joh 12,4 ist es Judas allein.
7 Außer im Johannesevangelium der Lieblingsjünger Jesu, bei dem es sich um Johannes selbst handelt.
8 Das sind ungefähr 24 kg: Geduld ist also nötig, bis der Sauerteig diese Menge Mehl durchsäuert hat.
3. Auferstehung
Auferstehung ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Das hat schon Paulus klar erkannt: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos (1 Kor 15,14). Auferstehung durchzieht der Sache nach das gesamte Neue Testament, in 18 von 27 Schriften kommt sogar das Wort selbst vor. Versuchen wir zu verstehen, was die Schrift damit sagen will, damit dadurch auch uns diese Wirklichkeit erschlossen wird.
3.1 Der biblische Befund
Das älteste schriftliche Zeugnis der Auferstehung Jesu, etwa 50 n. Chr., findet sich in 1 Thess 1,10: … Jesus, den er [Gott] von den Toten auferweckt hat … Solche eingliedrigen Auferweckungsformeln9 müssen bereits vorher als mündliche Bekenntnisformeln in Gebrauch gewesen und damit deutlich älter sein. Sie besagen, dass Gott Jesus nicht in der Scheol, dem Totenreich, gelassen, sondern an ihm gehandelt, ihn erweckt hat. Darüber, wie es zu dieser Überzeugung kommt, besagen sie nichts.
Diese Lücke schließt 1 Kor 15,3–8. Dieser Text verknüpft die Auferstehungsbekenntnisse mit Erscheinungen des Auferstandenen, die damit zur Quelle des Wissens von der Auferweckung Jesu werden. 1 Kor 15,3–8 ist eine gebündelte Zusammenfassung von Traditionen und Inhalten der Auferweckungspredigt und reicht weit in die mündliche Überlieferung zurück: Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als Letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt.
Paulus sieht seine eigene Bekehrung als Erscheinung des Auferstandenen an. „Ohne die Erscheinungen hätte es keine Zeugen und keine Zeugnisse für die Auferstehung des Herrn gegeben. Sie sind unersetzlich“ (Scheffczyk). Wie diese Erscheinungen zu verstehen sind, wird uns später beschäftigen.
Zwanzig und mehr Jahre später, also ab etwa 70 n. Chr., sind die Ostererzählungen der Evangelien verschriftlicht worden. Diese sind keine historischen Berichte, sondern „Geschichten um Geschichte“, d. h., sie enthalten Historisches, sind aber vor allem Verkündigung. Diese muss die Adressaten, Menschen des letzten Viertels des ersten Jahrhunderts, Juden- und Heidenchristen in unterschiedlichen Gemeinden an verschiedenen Orten der Welt, mit jeweils ihrem Vorwissen, ihrem Denkhorizont und ihren Fragen dort abholen, wo sie stehen. Auch das Verständnis der Verkündiger der Osterbotschaft hat sich entwickelt, vertieft und akzentuiert. So lassen sich ansatzweise die Unterschiede in den Osterevangelien verstehen. Gemessen an der fundamentalen Bedeutung der Osterbotschaft, sind die Texte der Osterevangelien spärlich; so spärlich, dass sie sich hier im Überblick präsentieren lassen:
• Das älteste Osterevangelium ist Mk 16,1–8, das um etwa 70 n. Chr. entstanden sein dürfte. Es schildert lediglich, wie ein weiß gekleideter junger Mann den Frauen, die auch bei Kreuzigung und Grablegung Jesu zugegen waren, im leeren Grab die Auferstehung Jesu mitteilt und ihnen den Auftrag gibt, seine Jünger nach Galiläa zu schicken, wo sie den Auferstandenen sehen werden. Die von Schrecken und Entsetzen gepackten Frauen fliehen vom Grab und sagen niemandem etwas. Dieses Ende des Evangeliums wurde als so unbefriedigend empfunden, dass es nach 100 n. Chr. durch eine Zusammenfassung aus den beiden anderen synoptischen Evangelien ergänzt wurde.
• Lk 24,1–53 ist in den frühen 80er Jahren geschrieben worden. Lukas benutzt Markus als Vorlage, aber bei ihm führen die Frauen den Auftrag der beiden Engel aus. Allerdings werden die Jünger nicht nach Galiläa geschickt, vielmehr sollen sie in Jerusalem bleiben. Darüber hinaus erzählt Lukas die Geschichte von den Emmausjüngern, in der sich die Gegenwart des Auferstandenen durch Schrift und Brotbrechen im Aufgehen der Augen und Brennen der Herzen vermittelt. Außerdem setzt Lukas sich besonders mit der Art der Leiblichkeit des Auferstandenen auseinander.
• Etwas später als Lukas ist Mt 28,1–20 entstanden, etwa 80–90 n. Chr. Auch Matthäus verarbeitet die Markusvorlage: Bei ihm eilen die Frauen nicht nur voll Furcht, sondern auch in großer Freude vom Grab davon, um den Jüngern die Auferstehung Jesu mitzuteilen und sie gemäß dem Auftrag des Engels nach Galiläa zu schicken. Auf dem Weg kommt Jesus selbst ihnen entgegen, grüßt sie und bestätigt den Auftrag seinerseits. Diesem am meisten jüdisch geprägten Evangelium liegt ferner die Universalität der Sendung der Jünger zu allen Völkern am Herzen und die Zusicherung des Auferstandenen, bis zum Ende der Welt bei ihnen zu bleiben. Ein weiteres Thema ist die Entstehung des Gerüchts, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen, um dann angesichts des leeren Grabes seine Auferstehung zu behaupten.
• Eine eigene, von den Synoptikern unabhängige Tradition liegt im gegen Ende des 1. Jahrhunderts geschriebenen Kapitel 20 des Johannesevangeliums vor. Maria aus Magdala, die in allen Evangelien beim Kreuz Jesu steht, entdeckt das leere Grab und holt Petrus und den „anderen Jünger“. Als sie dann schließlich selbst ins Grab hineingeht, erscheint ihr Jesus, den sie zunächst nicht erkennt (Joh 20,11–18). Am Abend erscheint der Auferstandene den Jüngern, die sich aus Furcht vor den Juden eingeschlossen hatten. Später wurde dem Johannesevangelium noch ein weiteres Kapitel als zweiter Schluss angefügt. Damit nehmen seine Erscheinungserzählungen mehr Raum ein als in den synoptischen Evangelien, und mehr als dort werden Begegnungen und Dialoge des Auferstandenen mit Einzelpersonen – mit Maria Magdalena, Thomas, Petrus, dem Lieblingsjünger – berichtet.
Die Unterschiede zwischen den Osterevangelien und den Auferstehungszeugnissen der Bekenntnistradition sind auffällig: In allen Osterevangelien kommt das leere Grab vor, die ersten Adressaten sowohl der Osterbotschaft als auch der Erscheinungen des Auferstandenen sind Frauen.10 Von einer Erscheinung vor Frauen im Sinne der Osterevangelien und von einem leeren Grab weiß Paulus nichts. Allerdings mag er, wo er in 1 Kor 15,3–8 von „allen Aposteln“ spricht, auch an Junia (Röm 16,7) und Priska (Röm 16,3; 1 Kor 16,19; 2 Tim 4,19) gedacht haben. Und unter den 500 „Brüdern“ könnten sich auch Frauen befunden haben, da das Maskulin für Männer und Frauen stehen dürfte. Ebenso fehlt bei Paulus die Emmauserzählung (Lk 24,13–35). Auf der anderen Seite kennen die Evangelien weder die Erscheinung vor 500 Brüdern noch vor Jakobus noch vor „allen Aposteln“, womit Paulus nicht nur die Zwölf, sondern alle Verkünder des Evangeliums im Blick hat.
3.2 Die Entstehung des Konzepts „Auferstehung“
Wieso taucht in den Evangelien das leere Grab auf, von dem in der Bekenntnistradition nie die Rede war? Um die Zeit der Abfassung der Evangelien, also 70 bis 100 n. Chr., starben die letzten Zeitzeugen Jesu, die dann etwa auch in diesem Alter gewesen sein müssen. Deswegen könnte ein vertieftes Interesse an der Frage entstanden sein, wie jene zu ihrem Glauben an die Auferstehung Jesu gekommen waren. Den Aposteln stand, als Jesus starb, das Konzept „Auferstehung“ nicht aktiv zur Verfügung, denn sie hatten Jesus nicht verstanden, als er davon sprach, und auch nichts Genaueres wissen wollen. Es kommt ihnen auch nicht zu Bewusstsein, als die Frauen sie zum leeren Grab rufen. Tja! Es ist halt leer. Kein Licht geht ihnen auf: Der lukanische Petrus geht voll Verwunderung wieder nach Hause; das Johannesevangelium fügt erklärend hinzu, dass Petrus und Johannes noch nicht die Schrift verstanden [hatten], dass er [Jesus] von den Toten auferstehen müsse (Joh 20,9f). Die beiden werden sich wohl der naheliegenden Vermutung von Maria Magdalena anschließen, dass jemand den Leichnam Jesu aus dem Grab weggeschafft haben muss. Tatsächlich folgt aus der historischen Tatsache eines leeren Grabes nichts für die Auferstehung des darin beigesetzten Toten. Wie sollte nämlich jemand zur Erklärung des leeren Grabes auf die Idee kommen, der Tote sei deshalb nicht da, weil er auferweckt wurde und nun zur Rechten Gottes sitzt? Eine noch abstrusere Erklärung ist kaum denkbar. Das Faktum des leeren Grabes legt weder die Idee einer Auferstehung nahe noch ist es ein Beweis dafür, dass Jesus in einer vollkommen neuen Weise bei Gott lebt und von ihm zum Herrn und Messias gemacht wurde.
Im Kontext von „Auferstehung Jesu“ ist das leere Grab nicht erforderlich. Denn es stimmt ja auch nicht, dass der tote Körper Jesu für dessen Auferstehung gebraucht würde: Weder ist Auferstehung eine Wiederbelebung des Körpers und seine Rückkehr in die irdische Geschichte, um dann am Ende des Lebens ein zweites Mal zu sterben, noch bedarf der Auferstehungsleib der Materie des Leichnams, um entstehen zu können. Paulus widmet der Frage Wie werden die Toten auferweckt, was für einen Leib werden sie haben? eine lange Antwort in 1 Kor 15,35ff: Irdischer und auferweckter Leib gehören zwei ganz verschiedenen Ordnungen an. Der Blumensamen, den wir in unseren Balkonkasten säen, hat in seiner Gestalt eines Korns nichts gemein mit der Gestalt der Blume. Same und Blume gehören unterschiedlichen Welten an, die lediglich im Tod des Samens einander berühren. Ohne diesen Tod keine Blume. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich.