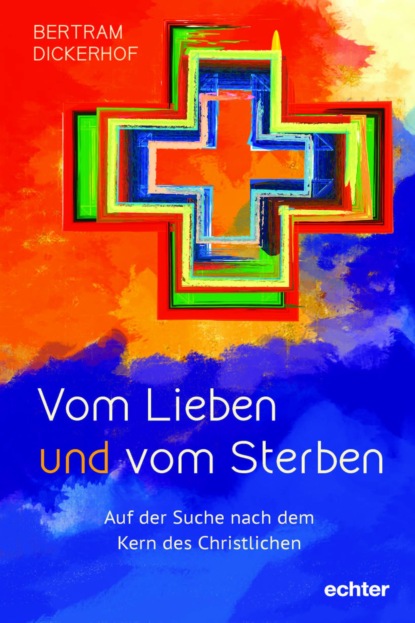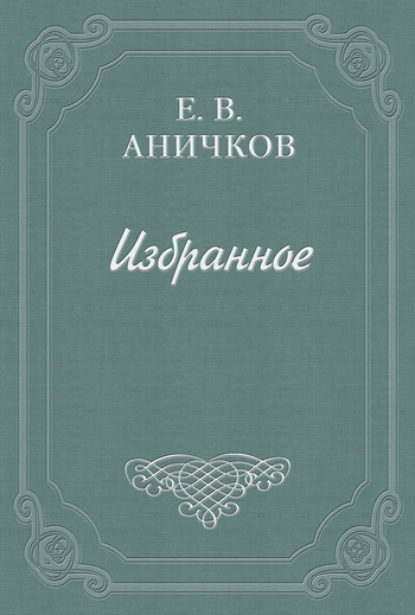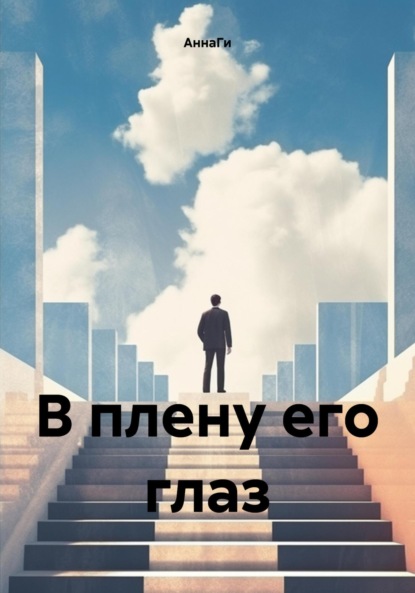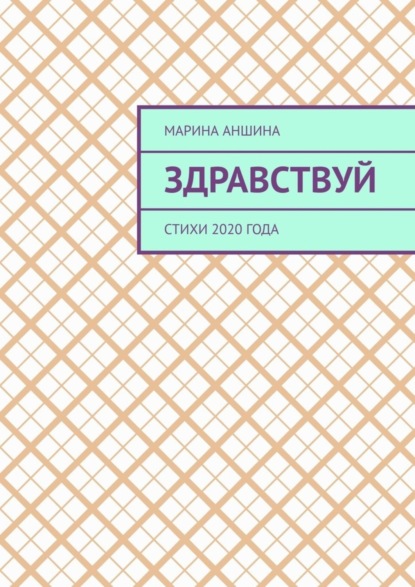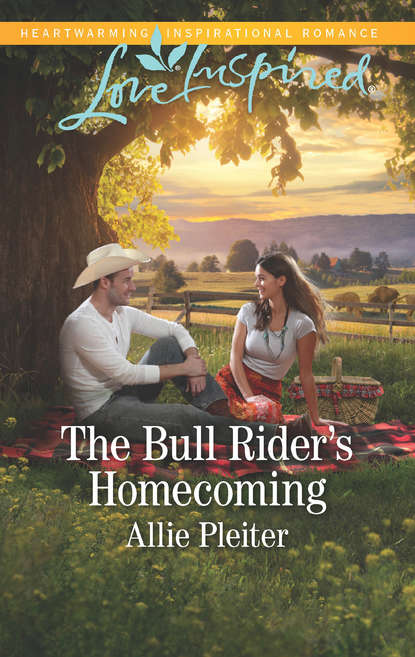- -
- 100%
- +
Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib.
So steht es auch in der Schrift: Adam, der Erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der Letzte Adam wurde lebendig machender Geist.
Der Erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde; der Zweite Mensch stammt vom Himmel.
Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden.
Damit will ich sagen, Brüder: Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben; das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche.
Die notwendige Voraussetzung für Auferstehung ist der Tod. Jedoch hat der überirdische, himmlische, unverwesliche Auferstehungs„leib“ – er ist Geist – mit dem irdischen, verweslichen Leichnam nichts zu tun.
Die Aussageabsicht der Texte Mk 16,1–8 und seiner Parallelen bei Lukas und Matthäus kann also nicht die Mitteilung der historischen Tatsache des leeren Grabes sein, weil aus ihr für eine Auferstehung nichts folgt. Doch was ist sie dann? Ich meine, dass es um die Einführung der Idee „Auferstehung“ geht, sowohl als Konzept für den Tod Jesu, der in seine Auferstehung hineinstirbt, als auch als Beschreibung der Disposition, in der Menschen, Frauen, eine solche göttliche Idee einfallen und in ihnen aufgehen kann.
Gehen wir dieser Vermutung nach, indem wir uns zunächst die Lektüre des ältesten Osterevangeliums zu Gemüte führen: Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich (Mk 16,1–8).
Auf den ersten Blick scheint unser Text wie ein Tatsachenbericht daherzukommen. Doch können bereits seine ersten Zeilen Zweifel daran wecken, ob er das wirklich ist: Die Salbung eines bereits in Tücher eingewickelten und beigesetzten Toten, also das, was die drei Frauen beabsichtigen, kam bei den Juden ganz und gar nicht vor.11 Ihre Absicht ist jedenfalls als Ausdruck ihrer großen Sehnsucht und Liebe zu werten, Jesus nochmals zu berühren, intensiv einzutauchen in ihre Beziehung zu ihm. Zwar waren sie bei seinem Sterben und seiner Beisetzung zugegen. Doch diese musste ganz schnell erfolgen wegen des herandrängenden Sabbats. Zeit zum Abschiednehmen hatte es nicht wirklich gegeben. Das wollen sie nun nachholen. Möglicherweise spielt auch das Motiv mit, ihre Beziehung zu Jesus auf dem bisherigen Stand zu konservieren; immerhin wollen sie „etwas zur Erhaltung des Leichnams tun“12. Wie dem auch sei: Den sie berühren werden, ist ein Toter, kalt und starr. Er ist nicht mehr „ihr“ Jesus. Wie immer ihre Motive sein mögen, ihre Aktion wird zu einem wichtigen Schritt dahin, das Gewesene los- und sich verwandeln zu lassen.
Um ihren Plan ausführen zu können, treffen sie Vorsorge: Am Abend des Sabbats kaufen sie die wohlriechenden Öle, die sie brauchen. Merkwürdig ist jedoch, dass ihre Vorsorge sich nicht auch auf den Stein erstreckt, mit dem das Grab Jesu verschlossen ist. Mit der Öffnung des Grabes steht und fällt doch ihr ganzes Vorhaben! Wieso beziehen die Frauen ihn nicht in ihre Vorkehrungen ein?
Als mein Bruder in der Ferne gestorben war, wollte ich den Toten unbedingt vor seiner Beisetzung sehen und Abschied nehmen. Ein leichter Gang war das dennoch nicht. Neben der Liebe war da auch tiefer Schmerz. Der Verlust tat so weh! Die Aussicht war schlimm, nun alleine weitergehen zu müssen, ohne seine Begleitung und sein Verständnis. Ich fühlte mich einsam und leer. So in etwa wird auch den Frauen das Wiedersehen mit dem Leichnam Jesu nicht leichtfallen, und der Verschlussstein steht für ihren Widerstand dagegen und die Kraft, die seine Überwindung kostet: vielleicht mehr, als sie aufbringen können. Diesen Widerstand schieben die Frauen gerade nicht weg, er ist ihnen bewusst, sie sprechen davon und halten ihn aus. Sie gehen ihren Weg, doch gehen sie ihn mit der Frage, wer ihnen hilft, ins Grab hineinzukommen, d. h., sie gehen ihn im Bewusstsein ihres Widerstandes.
Doch dann, am Grab, ist alles anders als gedacht: Die Sonne geht gerade auf und ein frischer Tag bricht an. Der Verschlussstein und damit die Last, die auf ihnen lag, ist weg. In ihnen breitet sich eine gewisse Leichtigkeit aus, durch die sie sich öffnen. Das aufgegangene Grab wirkt nun geradezu wie eine Einladung, hineinzugehen. Drinnen erblicken sie als Erstes einen jungen Mann in weißem Gewand und erschrecken. „Hier ist Göttliches am Werk“, will die Geschichte uns vermitteln: Alles atmet Neubeginn, Reinheit, Zukunft, ist faszinierend und gleichzeitig erschreckend, das typische Erleben, wenn Menschen dem Göttlichen begegnen:13 Rudolf Otto hat in seinem Klassiker14 das Heilige als „Fascinosum et Tremendum“, als faszinierend und erschreckend beschrieben. Einladung, Anziehung und Erschrecken charakterisieren das Erleben der Frauen, und ihnen geht auf: Jesus ist auferstanden; er ist nicht hier. Das ist keine Fantasie, keine Einbildung, kein Ergebnis eines schlussfolgernden Denkens. „Auferstehung“ wird ihnen mitgeteilt in einem göttlichen Einfall, den sie empfangen können, weil sie offen sind. Die aufgehende Sonne, der Tag, der neu anbricht, der junge Mann im weißen Gewand – all das beschreibt das innere Milieu der Frauen, in dem sie fasziniert und ins Tiefste getroffen die Botschaft von der Auferstehung Jesu erhalten. Eine Erfahrung dieser Art ist Menschen nicht unbekannt. Zum Beispiel beschreibt Ignatius von Loyola sie in seinen Geistlichen Übungen als beste Möglichkeit einer „heilen und guten Wahl“. Diese ist dann gegeben, „wenn Gott, unser Herr, den Willen so bewegt und an sich zieht, dass eine Ihm ergebene Seele, ohne zu zweifeln oder auch nur zweifeln zu können, dem folgt, was ihr gezeigt worden ist.“15 Der „Seele“, die offen und empfänglich ist, widerfährt etwas. Sie wird „bewegt“ und „gezogen“, und zwar zu Gott, d. h. ist erfüllt von dem Glück, das sie ersehnt. Ihr wird etwas „gezeigt“, und dem folgt sie. Sie hat verstanden. Sie zweifelt nicht daran, ja, sie kann es gar nicht. Sie ist pure Einsicht und Zustimmung. Etwas in der Art werden auch die markinischen Frauen erleben. Durch die Art und Weise, wie die Idee der Auferstehung sich ihnen vermittelt, ist ihnen unmittelbar klar: Jesus gehört zur Sphäre des Himmels, er lebt bei Gott, er ist in das Göttliche eingegangen.
Doch damit ist der innere Weg der Frauen noch nicht zu Ende. Die Idee der Auferstehung, die zunächst in Spannung steht zu ihrer Alltagswirklichkeit, trachtet danach, integriert und damit in der Welt fruchtbar zu werden. Als Erstes können sie nun sehen, dass das Grab leer ist, dass der Leichnam Jesu nicht dort ist, wo er sein sollte. Das ist mehr als irritierend: Wie kann der Leichnam des Menschen Jesus plötzlich weg sein? Natürlich, weil er auferstanden ist. Es passt alles zusammen. Doch diese Ungeheuerlichkeit der Auferstehung drängt die Frage auf: Wer war der Jesus, mit dem nun derart Unerhörtes geschieht, wirklich? Kann das Bild denn stimmen, das die Jüngerinnen und Jünger sich aus ihren Erlebnissen mit ihm gemacht hatten? Oder waren ihre Deutungen zu kurz gegriffen, Werk ihrer eingeschränkten Sicht? Sollte Gott, der Jesus am Ende aus dem Tod in seine Herrlichkeit auferweckt, schon in Jesu irdischem Leben in einer bisher unvorstellbaren Weise „da“ gewesen sein? Ihrem bisherigen Verständnis von Jesus, vom Ende der Toten im Schattenreich der Scheol, von Gott, den keiner geschaut hat und den sie doch in Jesus hätten sehen können, wenn sie nicht so blind gewesen wären …, wird der Boden weggezogen. Sie hatten die Welt, wie sie sie zu sehen gewohnt waren, selbstverständlich für die Wirklichkeit gehalten und merken nun, dass sie ihre Welt ist, ein Bild der Wirklichkeit, das sie sich gemacht haben. Der mittelalterliche Kirchenlehrer Thomas von Aquin (1225–1274) sieht in diesem Aufwachen eine Erkenntnis unseres Erkennens: „Was auch immer wahrgenommen wird, es wird auf die Weise des Wahrnehmenden wahrgenommen.“16 In der Tat werden Sinneseindrücke vielfach be- und verarbeitet – physiologisch, unbewusst, bewusst –, bis sie Baustein der Welt eines Menschen werden. Was ihm zu fremd ist, dafür hat er gar keinen Sensus, was ihn nicht interessiert, fällt raus, was ihm zu bedrohlich erscheint, verdrängt er; in Beziehungen überträgt er alte Beziehungserfahrungen und verkennt dabei die Person, mit der er hier und jetzt zu tun hat. Die Lücken seiner Welt schließt er durch Assoziationen und Verallgemeinerungen.17 Unpassendes versucht er an seine gewohnte Welt anzupassen – die sich dabei verändert in dem Maße, wie er sich durch das Unpassende stören lässt.
Dass also die Jüngerinnen und Jünger Jesus in ihrem Bild von ihm verkannt haben, stellt nun sie selbst in Frage. Kein Wunder also, dass die Frauen von Schrecken und Entsetzen gepackt vom Grab fliehen. Doch nehmen sie als Aufgabe mit, nach Galiläa zu gehen, wo sie neu auf ihre Erlebnisse mit Jesus zurückblicken können in der Hoffnung, dass sie ihn dort sehen werden, wie er es gesagt hat. Dies alles den Aposteln mitzuteilen, fürchten sie sich. Durch die Infragestellung ihres Welt- und Selbstverständnisses drohen sie, wie in einen Abgrund zu stürzen. Sie können nicht sprechen. Doch in Galiläa sollen sie ein neues, bleibendes Lebensfundament erhalten. Galiläa, wo alles angefangen hat. Galiläa, wo viele Orte mit Erinnerungen an das Wirken Jesu verbunden sind. Dorthin zu gehen ist die Chance, ihre damaligen Begegnungen mit Jesus nun im Licht der Auferstehungsbotschaft neu zu verstehen, eine Aufgabe, die sich allen Zeitgenossen Jesu stellt: Auch wenn wir früher Christus dem Fleische nach gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden (2 Kor 5,16f). Die Perspektive ist wahrhaft ungeheuerlich. Sie ist das Ende der Welt, in der sie bisher so selbstverständlich gelebt haben, in der Gott und Mensch, Gerechter und Sünder, Tod und Leben fein auseinandersortiert waren. In der neuen Welt wohnt Gott, der geheimnisvolle Grund aller Wirklichkeit, allem inne und ist damit allem näher und innerlicher, als es je sich selbst sein kann. Allen Gegensätzen widerfährt Gerechtigkeit, sie werden gewürdigt und doch in Barmherzigkeit miteinander versöhnt. Das Leben lernt schon jetzt eine Erfüllung kennen, die bleibt und zunimmt.
Halten wir einen Moment inne, um ein erstes Fazit aus unserem markinischen Osterevangelium zu ziehen: Die Idee „Auferstehung“ ist nichts, was der menschliche Verstand logisch erschließen oder sich in irgendeiner Weise ausdenken könnte. „Auferstehung“ ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die mitgeteilt und empfangen werden muss. Das leere Grab Jesu wird zu einem dreifachen Symbol: Als Grab bezeichnet es zum einen die Grenze, die die Wirklichkeit dem Leben setzt: dem leiblichen Leben und immer wieder auch dem Leben, wie wir es uns vorstellen und wünschen. Wir stoßen an diese Grenze am Ende in unserem Sterben und während unseres Lebens in Enttäuschungen und Verlusten aller Art, in der Konkretheit einer geschichtlichen Situation, in der wir uns vorfinden, ob sie uns gefällt oder nicht. Aber gerade im Hineingehen in die Grenzsituation, im Annehmen der mit ihr verbundenen Gefühle, wie die Frauen das tun, wird das Grab Jesu, zweitens, zum Ort des Aufgehens göttlichen Lebens und göttlicher Wirklichkeit und zum Symbol einer beginnenden Verwandlung: Diese lässt das bisherige Selbst- und Weltverständnis zusammenbrechen. Das leere Grab wird so, drittens, auch zur Chiffre für das Sterben der eigenen Welt- und Selbstkonstruktionen.
Werfen wir noch einen Blick darauf, wie Matthäus und Lukas, die beide das markinische Osterevangelium verarbeiten, mit ihrer Vorlage umgehen: Matthäus macht aus dem jungen Mann im weißen Gewand gleich einen Engel. Seine Frauen sind nicht nur voll Furcht, sondern auch voll großer Freude. Anders als die markinischen Frauen eilen [sie] zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft auszurichten. Auf dem Weg kommt ihnen Jesus entgegen. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße (Mt 28,9). Der Auferstandene selbst erscheint ihnen, sie machen eine Erfahrung, es bleibt nicht bei der bloßen Idee und Möglichkeit von Auferstehung. Doch scheint der Prozess des Durchsäuert-Werdens des bisherigen Lebens durch den Sauerteig der neuen Wirklichkeit unverzichtbar. Denn der Auferstandene bestätigt die Aufforderung des Engels und schickt seine Jünger und Jüngerinnen nach Galiläa.
Lukas nimmt größere Veränderungen vor: Nicht Galiläa. Die Jünger sollen in Jerusalem bleiben (Lk 24,49), wo der Auferstandene ihnen durch viele Beweise zeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen (Apg 1,3). Auf diese Weise findet in Jerusalem der Prozess statt, zu dem Markus und Matthäus die Jünger nach Galiläa schicken: die Integration der Auferstehung ins eigene Welt- und Selbstverständnis. In der Auferstehungsbotschaft durch zwei Männer in leuchtenden Gewändern wiederholt Lukas die Leidensankündigung Jesu auf dem Weg nach Jerusalem: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen (Lk 24,7).
Dieses Wort hatten die Jünger bisher ganz und gar nicht verstanden. Um dieses Wort dreht sich nun die Geschichte von den beiden Jüngern, die am Ostertag nach Emmaus unterwegs sind (Lk 24,13–35). Unerkannt begleitet der auferstandene Jesus den Weg der beiden, so wie der irdische Jesus – unerkannt letztlich auch er – seine Jünger nach Jerusalem begleitet hatte. Der Unterschied ist, dass für die Emmausjünger inzwischen Wirklichkeit und damit besprechbar geworden ist, was für die Zwölf auf dem Weg nach Jerusalem unter keinen Umständen geschehen durfte und worüber nicht gesprochen werden konnte: der Tod Jesu. Dieser Tod erscheint nun, nachdem er eingetreten ist und die Jünger ihre Passion durchleben, in der Gegenwart des Auferstandenen nicht mehr nur als Verhängnis, sondern als göttliche Notwendigkeit: Musste nicht der Christus all das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? (24,26). Obwohl dieser Satz den Emmausjüngern Hoffnung und Perspektive eröffnet, braucht es den Gang durch die ganze Schrift, durch Mose und alle Propheten, damit sein Inhalt sie erreicht. Den beiden brennt das Herz. Doch erst am Abend, beim Brechen des Brotes, als im Zeichen vollzogen wird, was Jesus am Kreuz in Liebe und Barmherzigkeit ausgelitten hat, gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn (24,31). Jetzt erst werden sie der Präsenz inne, die „da war“ auf ihrem ganzen Weg. Sie hatte sie Worte für das Selbstverständliche, das sie so sehr bewegt hatte, finden und aussprechen lassen. Sie hatte sie einander begegnen und ihre Herzen brennen lassen.
Was bedeutet nun dieser Satz: Musste nicht der Christus all das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen?
Er besagt, dass nicht Vermeiden und Abwehren, sondern Hineingehen in die Grenzsituation und sie durchleben der Weg zu Erfüllung und Vollendung ist. Über Grenzsituationen verfügt man nicht, man kann sie nicht herstellen, sie kommen auf einen zu. In sie hineinzugehen und sie zu durchleben heißt, Enttäuschung oder Verlust zu erleiden, da die Grenze ja darin besteht, dass die eigene Wunschvorstellung von einer Situation sich nicht erfüllt. Dass darin der Weg zur Erfüllung liegen soll, ist dem „gesunden Menschenverstand“ völlig entgegengesetzt. Es durchkreuzt das Prinzip, das Gefällige zu erstreben und das Missfällige zu vermeiden oder abzuwehren. Unabhängig von Gesellschaftsschicht, Bildungsgrad, moralischem oder sozialem Status erschallt vor dem Kreuz Jesu unisono die Überzeugung, dass ein „echter“ Messias vom Kreuz heruntersteigen könne und würde, d. h. die Macht habe, das Missfällige abzuwehren und das Gefällige herzustellen: Die Leute, die [vor dem Kreuz Jesu] vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn (Mk 15,29–32 par). Wer irgendeine Machtressource hat – dem Messias, dem König von Israel, dem Christus, müssten sie in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen –, der nutzt sie, um Ohnmacht, Leiden, Schmerz, Tod zu entgehen; der steigt herab vom Kreuz; der lässt nicht geschehen, was geschieht, wenn es unangenehm oder gar leidvoll wird; der wehrt sich mit allen Kräften dagegen.
Nicht aber so Jesus Christus, der in das Missfällige – seine Passion – hineingeht und so – und nur so – seine Herrlichkeit erlangt, die jedes Gefällige über-erfüllt.
Das heißt nun nicht, dass das Evangelium uns ganz generell zum Leiden auffordert. Es geht ihm nicht um eine süßliche Leidenssüchtigkeit; eine solche ist schräg! Es geht auch nicht um die Anpreisung von Opfern, die man suchen und bringen soll. Sondern, und darin besteht das zweite Fazit aus unserem Osterevangelium, es geht um die Entmachtung des Prinzips, das Gefällige zu erstreben und das Missfällige zu vermeiden oder abzuwehren. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu waren vor Ostern selbstverständlich in diesem Prinzip gefangen. Auferstehung kann jedoch nur vernehmen und erfahren, wem die Fesseln dieses Prinzips gelockert worden sind. Insofern geht es dem Evangelium um die Entkoppelung einer gegebenen, irgendwie unangenehm anmutenden Situation von einem spontanen, quasi automatischen Verhalten, das darauf zielt, die von der Situation ausgelösten Empfindungen nicht spüren und erleben zu müssen. Durchbrochen werden soll die Automatik. An ihre Stelle sollen Bewusstheit und Freiheit treten. Die Bergpredigt (Mt 5) ist voll von Beispielen solcher Automatismen, die im nächsten Kapitel ausführlicher untersucht werden: Da ist ein Feind – und sofort wird er gehasst und bekämpft; da kränkt mich einer – und spontan schimpfe ich auf ihn; da ist meine Partnerschaft unbefriedigend – und schon will ich ihn oder sie loswerden. Bei alledem ist die Aufmerksamkeit dessen, der in der missfälligen Situation ist, draußen: beim andern, bei den zu ergreifenden Maßnahmen … überall, nur nicht bei sich selbst und den eigenen Empfindungen. Die Entkoppelung besteht daher gerade darin, innezuhalten, d. h. sich nach innen zu wenden und seiner inneren Bewegungen, also seiner Gedanken, Gefühle, Impulse, Wünsche innezuwerden, die mit der unangenehm anmutenden Situation verbunden sind. In den Beispielen: die Wirkung der Feindschaft oder der Kränkung in seinen Gefühlen und Impulsen zu merken und dabei auszuhalten; den Ärger zu durchleben, statt ihn abzureagieren; sich die Frustration über die unbefriedigende Partnerschaft eingestehen, um zur Frage nach dem eigenen Beitrag gelangen zu können. Unsere Frauen aus den Osterevangelien sind ein Vorbild, was diese Entkoppelung angeht. Sie gehen in ihre Passion hinein. Sie setzen sich dem Kreuzestod Jesu aus; sie sind bei seiner Beisetzung dabei; ja, sie gehen in sein Grab hinein und erleiden dort ungeschützt alles, was die Endgültigkeit ihres Verlustes in ihrem Inneren auslöst. Sieht Markus in diesem entkoppelten Verhalten, das in das Unangenehme des Lebens aus Liebe und Sehnsucht hineingeht, die entscheidende Disposition für das Entstehen des Osterglaubens? Jedenfalls scheint es so, denn er lässt sein Evangelium mit dem Hineingehen ins Grab enden. Dennoch bedeutet Entkoppelung nun nicht, für immer in seinen negativen Gefühlen festzusitzen und auf jedes Handeln zu verzichten. Im Spüren, Fühlen, Erleben, Wahrnehmen seiner inneren Bewegungen bewusst zu verweilen verwandelt den Menschen. Der zweite Schluss des Markusevangeliums (Mk 16,9–20) zeigt dies: Die Verwandlung der Hineingehenden befähigt sie zur Begegnung, in der sich die Erscheinung des Auferstandenen im Alltag realisiert und letztlich das Tun vollzieht, das der Auferstandene ihnen aufträgt: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! (Mk 16,15).
Und schließlich ist noch ein drittes Fazit aus dem markinischen Osterevangelium zu ziehen: In das Missfällige hineingehen wie die Frauen, indem sie beim Kreuz Jesu stehen, bei seiner Grablegung dabei sind und schließlich sogar in das Grab selbst eintreten, kann nur, wer sich genügend sicher fühlt. Bei den Frauen ist eine „Stimmung“ da, die überzeugt ist, dass ihnen letztlich nichts passieren kann, was immer auch geschieht. Sie fühlen sich angenommen und bejaht. Sie reden sich das nicht ein oder reißen sich zusammen. Es geschieht mit ihnen. Unser Text drückt dies aus durch diese kleinen Fügungen: Der Stein, der Sorge bereitet hatte, ist weg; die ganze Szenerie atmet Neubeginn, Frische, Energie: Alles Dunkel ist vertrieben; im Grab werden sie geleitet von dem jungen Mann bzw. Engel, der sich ihnen verständnisvoll zuwendet. Durch all das teilt sich den Frauen ein Gefühl unbedingten Gehalten- und Angenommenseins mit, göttliche Liebe, die Basis des ganzen Prozesses. Damit stellt sich die Frage, wieweit die Sehnsucht nach der Erfüllung über alles hinaus letztlich Sehnsucht nach dieser unbedingten Liebe ist.
Exkurs: War das leere Grab tatsächlich leer?
Diese Frage konnte bisher offenbleiben, weil der Osterglaube sich nicht aus dem Faktum eines leeren Grabes ableiten lässt. In der Tat spielt das leere Grab weder in den Osterzeugnissen vor Paulus noch bei Paulus selbst eine Rolle. Röm 6,4 und 1 Kor 15,4 sind die beiden einzigen paulinischen Stellen, die überhaupt das Begraben-Sein Jesu erwähnen. Die Frage, ob das Grab am Ostermorgen leer war oder nicht, kommt in den neutestamentlichen Texten erst nach 70 n. Chr. auf. Für uns heute ist sie nicht eindeutig zu beantworten. Der Sachverhalt ist nicht mehr zu überprüfen. Aber die Argumente zu den möglichen Positionen sollen vorgestellt werden, so dass Leserin und Leser sich selbst ein Bild machen können.
Für die moderne Wissenschaft wird das Grab Jesu am Ostermorgen schwerlich leer gewesen sein. Aber auch die Wissenschaft kennt Irregularitäten. Ob das Licht als Welle oder als Teilchenstrom gedeutet wird, in jedem Fall gibt es Phänomene, die gegenüber der jeweiligen Deutung irregulär sind. Quanten, kleinen Materieteilchen, ist keine genaue Raum-Zeit-Stelle zuzuordnen. Der Urknall selbst ist eine Irregularität, nur seine Auswirkungen sind wissenschaftlicher Forschung zugänglich, nicht aber er selbst. Hinzu kommt, dass Wissenschaft nur allgemeine Aussagen machen kann: Der Einzelfall kann von der allgemeinen Gesetzmäßigkeit abweichen.
In seiner Pfingstpredigt (Apg 2,29–32) insinuiert Petrus die Leerheit des Grabes Jesu: David habe prophezeit, dass einer seiner Nachkommen, im Gegensatz zu ihm selbst, nicht der Unterwelt preisgegeben und sein Leib die Verwesung nicht schauen werde (Ps 16,10). Dieser Nachkomme sei Jesus, und sie, die Apostel, seien Zeugen dafür. Daraus folgt, dass Jesu Leib die Verwesung nicht schaut, sein Grab also leer ist, auch wenn das ausdrücklich nicht gesagt wird.
Wäre das Grab nicht leer gewesen, hätte es mit der Verkündigung der Auferstehung schwer werden können. Denn der Hebräer unterscheidet traditionell nicht zwischen Leib und Seele. Eine Auferstehung von den Toten ist für ihn mit der Belebung seines irdischen Leibes verbunden. Noch im nach 160 v. Chr. geschriebenen 2. Buch der Makkabäer (2 Makk 7) finden wir einen Niederschlag dieser Überzeugung. Ein Gefolterter hofft, zu ewigem Leben auferweckt zu werden, und zwar mit unversehrtem irdischem Leib. Wäre Gegnern der Auferstehungsverkündigung der Nachweis gelungen, dass der Leichnam Jesu im Grab liegt, hätte die Botschaft dann Glauben finden können? Von den daraus sich ergebenden Kontroversen findet sich jedoch in der Überlieferung keine Spur.