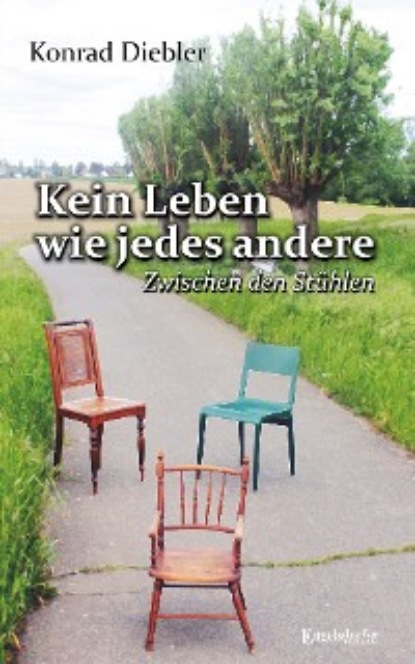- -
- 100%
- +
Das nächste Röntgenbild ergab, dass die Knochen immer noch nicht zusammenpassten. In einer Operation sollten dann die Knochenenden richtig zusammengefügt werden. Ich erhielt diesmal eine Lachgasnarkose. Nach dem Aufwachen, diesmal ohne Übelkeit und Erbrechen, war mein linkes Bein vom Fuß bis ganz, ganz oben unter der Pobacke in Gips. In der Operation waren vier Schlingen aus Silberdraht um mein Schienbein gewickelt worden. Das Wadenbein war glatt gebrochen und benötigte somit diese Prozedur nicht.
Die letzte Operation hatte zwei Wochen nach dem Unfall und Einlieferung ins Krankenhaus stattgefunden.
Nun lag ich acht Wochen mit dem Gipsbein im Bett.
Das St. Elisabeth war ein katholisches Krankenhaus. Die Oberin der Station und ihre Stellvertreterin waren Ordensschwestern. Sie trugen eine bodenlange, schwarze Ordenstracht mit Haube, bei der nur das Gesicht zu sehen war.
Es herrschte ein strenges Regime. Vor der Visite wurden die Betten gerichtet, danach mussten wir still auf dem Rücken liegen und die Arme parallel zum Körper auf der Bettdecke ablegen.
Besuchszeiten waren mittwochs von 15 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Bis zur Besuchszeit war das große Tor in der Biedermannstraße verschlossen. Punkt 14 Uhr wurde es geöffnet und die davor wartenden Angehörigen stürmten auf das Klinikgelände und ins Haus auf die einzelnen Stationen. Dabei konnten schon mal mehrere Minuten der wertvollen Besuchszeit vergangen sein.
Zum Ende der Besuchszeit ging die Oberin mit einem Gong von Zimmer zu Zimmer und forderte die Besucher strikt zum Gehen auf.
Ich lag auf der chirurgischen Männerstation in einem Kinderzimmer mit acht Betten. Brauchte man hier aber ein Bett, wurde ich in einem „Männerzimmer“ mit 16 Betten untergebracht. Vermutlich deshalb, da ich schon die längste Zeit im Krankenhaus lag.
Dort sah ich viel Leid, war aber auch Zeuge von derben Witzen. Eine Krankenschwester betrat einmal in ihrer Freizeitkleidung das Zimmer. Das Kleid besaß einen tiefen Rückenausschnitt, was einen Patienten spontan zu der Äußerung veranlasste: „Schwester, Sie haben Ihr Kleid verkehrt herum an.“
Nach acht Wochen im Krankenbett bekam ich einen sogenannten Gehgips. Der hieß so, weil am Fußende ein Metallbügel eingegipst war und so durfte ich zwei Wochen nach Hause. Nach zehn Wochen im Liegen konnte ich mich nun erstmals wieder mühsam fortbewegen.
Aber ich musste noch einmal ins Krankenhaus. Da sollte der Gips entfernt werden und ich wieder nach Hause gehen dürfen. Der Arzt nahm eine große Schere, um den Gips aufzuschneiden. Dieser war sehr hart geworden. Der Versuch misslang. Der Doktor bekam einen Wutanfall und sagte nur: „Ab, auf Station!“
So war ich schneller wieder im Krankenhaus, nichts mit Gips ab und nach Hause.
Am nächsten Tag legte man mich in eine Badewanne voll warmen Wassers und der Gipsverband löste sich. Zum Vorschein kam ein Bein, das in allen Farben schimmerte. Im Knie konnte ich es nicht beugen. Für die Entzündung gab es Salbe und für das steife Knie Krankengymnastik. Auf dem Bauch liegend beugte der Therapeut das Bein im Kniegelenk, was stark schmerzte.
In Woche 14 nach Einlieferung sollte ich dann endlich entlassen werden. Am Vortag der Entlassung löste sich ein Grind an der Operationsnarbe am Schienbein. Oh Schreck, ein Stück Silberschlinge schaute heraus! Nichts mit Entlassung. In einer weiteren Operation wurde die Schlinge entfernt. Diese Aktion verlängerte den Krankenhausaufenthalt um weitere zwei auf insgesamt 16 Wochen.
Inzwischen war es Mitte Juli und in den großen Ferien. 14 Wochen hatte ich die Schule nicht besucht. Meine Eltern vereinbarten mit der Klassenlehrerin, dass ich nicht nach Klasse 5 versetzt werde.
So besuchte ich ab dem 1. September 1963 nochmals die 4. Klasse. Der Lehrer Herr P., ein noch junger Mann, hatte die Klasse nicht im Griff, sondern die Klasse ihn. Mein Vater sah sich die Geschichte bis zum Halbjahreszeugnis vor den Winterferien 1964 an. Mit dem Schuldirektor Erich Pöschel war er per Du und so reichte eine kurze Bitte: „Erich, nimm meinen Jungen aus der 4 c.“ Und so geschah es, ab dem zweiten Halbjahr besuchte ich die 4 a bei Frau K.
Meine Oma Ida kenne ich nur als herzkranke Frau, man sagte: „Sie hat ein schwaches Herz von der vielen Arbeit.“ Das Laufen fiel ihr schwer, längere Strecken waren nicht möglich, da fiel es ihr leichter, mit dem Fahrrad zu fahren.
Als „Findelkind“ in schweren Verhältnissen bei Pflegeeltern aufgewachsen, hatte sie nur ein Ziel, im Leben etwas zu erreichen.
Aus diesem Grund wollte sie auch nur ein Kind bekommen und großziehen. Damals, in der vorwiegend kinderreichen Zeit, eine Seltenheit. Sie wusste, Kinder kosten Geld und schränken ihre Erwerbstätigkeit ein.
Oma Ida und mein Vater verstanden sich gut, Schwiegermutter und Schwiegersohn waren aus dem gleichen Holz geschnitzt, beide hatten große Not in der Kindheit und Jugend kennengelernt.
Mit starkem Willen, Ehrgeiz, Fleiß und der notwendigen Geschäftstüchtigkeit erarbeiteten sie sich einen bescheidenen Wohlstand.
Meine Großeltern kenne ich nur im Rentenalter. Oma Ida konnte wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit nur noch ihren Haushalt versorgen.
Opa Alwin hingegen arbeitete noch in der Tischlerei als Hofarbeiter. Dort sorgte er für Ordnung und Sauberkeit auf dem Holzlagerplatz und in der Werkstatt. Im seinem Wohnhaus, der Leinestraße 2, war er Hausmeister, kehrte Fußweg, Hof, Keller und Trockenboden und schob im Winter Schnee. Dafür bekam er von der Hausbesitzerin einen Mietnachlass, musste nur 20 statt 30 Mark monatlich zahlen.
In den 60er Jahren waren elektrische Waschmaschinen noch eine Seltenheit, die Wäsche wurde mit der Hand auf dem Waschbrett gewaschen. Die große Wäsche machten Oma Ida und meine Mutter für beide Haushalte zusammen in der Leinestraße. Sie dauerte drei Tage lang.
Der Ablauf war wie folgt: Zunächst gab es einen Eintrag im Kalender, der im Treppenhaus hing. Jeder Mieter schrieb dort ein, wann er waschen wollte und somit Waschhaus und Trockenplatz benötigte.
Am ersten Tag wurde die Wäsche mit Sil oder Gemol eingeweicht, so sollte sich der Schmutz schon lösen.
Am zweiten Tag spannte Opa Alwin die Wäscheleine auf dem Hof, diese musste sehr straff gespannt werden, damit die nasse, schwere Wäsche nicht durchhing. Danach heizte er den Waschhauskessel an.
Die Holzwannen wurden mit warmem Wasser aus dem Kessel gefüllt, da hinein kamen Waschpulver und die vorgeweichte Wäsche. Das Ganze wurde mit einem keulenähnlichen Gegenstand aus Holz mehrfach kräftig umgerührt. Je nach Wäscheart und Verschmutzung kam die Wäsche dann aufs Waschbrett, wurde gerubbelt, geknetet und aneinander gerieben. Nach dem Waschgang musste mehrfach und gründlich mit klarem Wasser gespült werden, bis keinerlei Waschmittelrückstände mehr vorhanden waren.
Nach dem Spülgang kam die Wringmaschine zum Einsatz. Zwei drehbare Zylinder standen mit kleinem Abstand übereinander. Mit einer Kurbel wurden die Zylinder gedreht und durch den Spalt die nasse Wäsche gezogen, so dass das Wasser herausgedrückt wurde. Die noch feuchten Wäschestücke kamen auf die Leine und wurden mit hölzernen Klammern befestigt.
Bei Regen konnte die Wäsche nicht auf dem Hof getrocknet werden, wenn möglich, wartete man noch einen Tag länger, d.h. nur, wenn an dem Tag dann kein anderer Mieter den Trockenplatz für sich beanspruchte. Anderenfalls musste die ganze Wäsche auf dem Trockenboden unter dem Dach trocknen. War die Wäsche trocken, kam sie zusammengelegt in den Wäschekorb.
Praktisch war: An Waschtagen gab es immer Nudeleintopf. Dieser wurde einen Tag vorher aus selbstgemachtem Nudelteig gekocht. So brauchte das Essen nur aufgewärmt werden.
An Tag drei ging es zur Wäscherolle, dort wurden Bettwäsche und Handtücher glatt gerollt.
Solche Rollen oder auch Wäschemangeln genannt, gab es viele in der Stadt.
In einem langgestreckten Bau auf dem Hof hinter den Häusern befand sie sich. Betrieben wurde sie von ihrer Besitzerin. Nicht, dass sie die Wäsche rollte, dies musste man selbst tun. Sie stellte die Rolle nur gegen Bezahlung zur Verfügung. Den Wäschekorb stellten wir auf einen Handwagen, den ich zusammen mit meiner Mutter zog. Ziel war die Wäscherolle in der Helenenstraße in Dölitz. Nach dem Rollen wurden die Wäschestücke in den Korb gelegt und mit dem Handwagen ging es wieder zurück.
Am Abend räumte Mutter die glatt gerollte Wäsche in den Wäscheschrank. Dort lag sie dann ordentlich auf Kante, der Stolz jeder Hausfrau.
Waschen am Waschbrett war schwere Arbeit. Mutter wünschte sich eine Waschmaschine. Bei ihrem Mann rannte sie dabei offene Türen ein. Ihre Mutter hingegen wollte davon gar nichts wissen. Mit so einer neumodischen Maschine wird die Wäsche nicht sauber, war ihre Meinung.
Es wurde trotzdem eine Waschmaschine gekauft, eine WM 66 und diese wurde bei uns in der Auenhainer Str. 21 im Waschhaus aufgestellt. Ab dieser Zeit wurde die Wäsche für beide Haushalte bei uns gewaschen und was soll ich sagen, die Wäsche wurde sauber und Oma hatte nie etwas anderes gesagt. Eingeweicht wurde am Vortag ebenfalls, auch wurde das heiße Wasser im Waschhauskessel bereitet und dann in die Waschmaschine gegossen, dies sparte Stromkosten.
Aber dann kam die Wäsche in die Maschine und nach dem Waschgang in die Wäscheschleuder und danach auf die Leine.
Eine große Arbeitserleichterung, auch mussten Waschhaus und Trockenplatz nicht mehr mit anderen Mietern geteilt werden.
Auf die Rolle ging es aber immer noch, nun in die Auenhainer Straße.
Oma Idas Herzkrankheit verschlechterte sich, 1964 erlitt sie einen Herzschlag. Meine Mutter rief die Hausärztin zum Hausbesuch. Doch die medizinischen Möglichkeiten waren damals noch sehr eingeschränkt. In der darauffolgenden Nacht war sie friedlich in ihrem Bett eingeschlafen.
Die anschließende Trauerfeier fand auf dem Leipziger Südfriedhof statt. Hinter einer Glasscheibe wurde sie aufgebahrt und so konnten die Familienangehörigen, Freunde und Bekannten Abschied nehmen. Auch ich habe dort meine Oma letztmalig gesehen.
Opa Alwin war nun Witwer, sehr traurig und konnte mit der Situation schwer umgehen.
Seine Wohnung reinigte er selbst und hielt Ordnung, diese praktischen Seiten des Lebens waren nicht das Problem, sondern die seelischen Schmerzen.
Er war schon immer, wie man damals sagte, schwermütig. Depressiv nennt man es heute. Er konnte den Tod seiner geliebten Frau nicht überwinden und wollte am liebsten auch sterben.
Zum Mittagessen kam er jeden Tag zu uns und meine Mutter wusch auch seine Wäsche.
Jeden Sonnabend wollte er Kartoffeln und Quark essen, es musste aber selbstgemachter Quark sein, so wie er es von seiner Frau gewohnt war. Montags holte er im Milchladen in einer 5-Liter-Kanne Milch. Diese wurde stehen gelassen, bis sie sauer wurde, dann kam die Masse in ein Stoffsäckchen, dieses wurde in der Küchenspüle am Wasserhahn befestigt. Das Wasser lief durch den Stoff in die Spüle und es verbreitete sich in der Küche ein säuerlicher Geruch. Am Sonnabend war aus der sauren Milch Quark geworden. Mit Pellkartoffeln ein feines Essen. Zum Schluss aßen wir meistens noch eine Pellkartoffel mit Butter und Salz.
Zum Sonntagsessen brachte er immer eine Flasche Weißwein mit. Diese versteckte er auf der Veranda und sagte dann: „Konrad geh mal raus, ich habe dort etwas versteckt.“ Dieses Ritual wiederholte sich jeden Sonntag.
Sein Lebensmut kehrte jedoch nicht zurück, er wollte sterben. Schon viele Jahre hatte er einen Leistenbruch, welcher von einem Bruchband gehalten wurden. Eine Operation war nicht angesagt, er aber wollte unbedingt operiert werden, dachte, in seinem Alter von 79 Jahren wacht er aus der Narkose nicht wieder auf. Meine Eltern und auch die Ärzte rieten von einer Operation ab. Er hat sich dennoch „unters Messer“ gelegt und die Operation gut überstanden.
Opa erschien immer pünktlich 12.00 Uhr bei uns zum Mittagessen. An einem Tag 1966 war dies nicht der Fall. Meine Mutter war beunruhigt, da musste doch was passiert sein. Meine Eltern fuhren in seine Wohnung, den Schlüssel hatten sie und konnten hinein. In der Küche und im Wohnzimmer fanden sie ihn nicht. Die Tür zur Schlafkammer war nicht ganz geschlossen, mein Vater wollte sie öffnen. Spürte aber einen Widerstand. Nachdem er sie mit Kraft aufgeschoben hatte, sah er das Unglück – Opa Alwin hatte sich an der Türklinke stranguliert.
Den Abschiedsbrief fanden sie auf dem Wohnzimmertisch. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen bestätigten den Freitod.
Im Leipziger Umland waren viele Braunkohletagebaue aktiv und es war klar, dass nach der Auskohlung tiefe Löcher in der Landschaft verbleiben würden. Der Abraum wurde wieder in den Tagebau verbracht, aber die Braunkohle war ja nicht mehr da. Diese Restlöcher sollten Seen werden.
Als Kinder konnten wir uns dies nur schwer vorstellen. Aber bereits Anfang der 70er Jahre wurde der Kulkwitzer Tagebau westlich von Leipzig geflutet und es entstand der gleichnamige See mit Badestrand, Campingplatz und einem Schiff, das auf dem Land stand und als Gaststätte diente.
Es folgten der Cospudener, der Markkleeberger, der Störmtaler und der Zwenkauer See. Das Leipziger Neuseenland war entstanden.
Im Chemieunterricht behandelten wir die Entstehung von saurem Regen aus Industrieabgasen und Regenwasser. Nördlich von Leipzig, in Bitterfeld und Wolfen, gab es viele Chemiebetriebe und diese emittierten ungereinigten Abgase. Der daraus entstandene saure Regen bedrohte die Waldgebiete der Dübener Heide. Die lapidare Aussage der Chemielehrerin war, dieser Wald würde in einigen Jahren nicht mehr vorhanden und die Dübener Heide gestorben sein.
Die Entwicklung der Chemieindustrie wurde über den Schutz der Natur gestellt. Obwohl ich als Schüler diese Aussage nicht in Frage stellte, war es mir doch unheimlich, dass ein ganzes Waldgebiet aufgegeben werden sollte.
Anfangs habe ich die Schulzeit nicht besonders ernst genommen, zwar immer meine Hausaufgaben erledigt, da war meine Mutter schon hinterher, aber darüber hinaus nur das Notwendigste getan. Es gab viele Dinge, die mehr Spaß machten als zu lernen.
Und da sich in den 60er Jahren die Freizeit größtenteils draußen abspielte, war eine Woche Stubenarrest wirklich eine Strafe. Im Sommer sind wir viel Fahrrad gefahren, haben Radrennen veranstaltet, waren auf Rollschuhen unterwegs und spielten Verstecken.
Im Frühsommer, so Mai, Juni wurde gemurmelt, wir nannten es „Kullerschieben“. Unsere Straße war damals noch mit Kopfsteinpflaster gepflastert. Einige Steine wurden herausgenommen und an die Seite gelegt, in die so entstandene Kuhle wurde „hinein gemurmelt“. Es gab Glaskugeln, „Glaser“ genannt und welche aus Ton, „Toner“ genannt. Toner hatten keinen Wert, nur Glaskugeln waren anerkannt. Das Ganze spielte sich mitten auf der Fahrbahn ab. Damals gab es nur wenige Autos und wenn eines kam, gingen wir zur Seite und ließen es durch. Zum Ende der „Kullerschiebzeit“ wurde der Pflasterstein wieder an seinen Platz gebracht und es war Schluss bis zum nächsten Jahr. Noch heute ist es mir ein Rätsel, wer Anfang und Ende der „Kullerschiebzeit“ bestimmte.
Auch im Winter, bei Eis und Schnee waren wir viel draußen. Es gab Winter mit viel Eis und Schnee und auch welche ohne. Auch gab es Zeiten mit tiefem Frost ohne Schnee. Da haben wir unseren kleinen Rodelberg mit herangeschleppten Eimern Wasser selbst vereist und konnten rodeln. In diesen Zeiten fuhren wir auf den zugefrorenen Teichen Schlittschuh und spielten Eishockey.
In unsere Nähe gab es vier Teiche, zwei in der Kleingartenanlage „Zur großen Eiche“ und zwei Teiche im Dorf Dösen an der Leinestraße. Auswahl hatten wir somit genug. Eishockey spielten wir mit einem umgedrehten Spazierstock und einem kleinen Gummiball, welcher sprang und hopste. Einen Puck hatten wir nicht. Schlittschuhe, welche fest mit den Stiefeln verbunden waren, gab es in unserer Kindheit noch nicht. Die Schlittschuhe befestigten wir an unseren Skistiefeln. Alle Kinder hatten Skistiefeln und auch einfache Holzskier. Mit diesen fuhren wir den Rodelberg hinunter oder über die Felder Langlauf. Wenn am Abend die Gasbeleuchtung angezündet wurde, war es Zeit nach Hause zu gehen. Durchgefroren betraten wir das warme Haus. Der festgefrorene Schnee an unseren Skihosen und -socken taute und hinterließ große Wasserpfützen.
Die Skistiefel trugen wir auch in der Schule. Die Eisenbeschläge an den Skistiefeln klapperten laut auf dem gefliesten Fußboden. Die hohen, guten Winterschuhe wurden geschont, waren für den Sonntag oder wenn man mit den Eltern außer Haus ging.
Wir besuchten in der DDR die zehnklassige, allgemeinbildende polytechnische Oberschule (POS). Schüler, welche nicht 10 Jahre die Schule besuchen konnten oder wollten, hatten die Möglichkeit, diese nach der 8. Klasse zu verlassen. In einer dreijährigen Lehrzeit erlernten sie dann einen Beruf, meistens in einem Handwerk.
Nach der 8. Klasse wechselten die Schüler mit den besten Zeugnissen an die Erweiterte Oberschule (EOS), mit dem Ziel, nach 4 Jahren das Abitur, auch Reifeprüfung genannt, abzulegen.
Gute Zensuren waren jedoch nur eine Voraussetzung, zur EOS zugelassen zu werden. Auch die Einstellung zum sozialistischen Staat wurde bewertet. Kinder aus Arbeiterhaushalten erhielten bevorzugt den Zugang zum Abitur und damit zur Hochschulreife.
Wir anderen lernten weiter an der POS, nach bestandener Abschlussprüfung in Klasse 10 schlossen wir diese mit der mittleren Reife ab. Dem schloss sich eine zweijährige Lehrzeit in einem Handwerks- oder anderem Facharbeiterberuf an.
Mein Halbjahreszeugnis in der achten Klasse war schlecht und so kam ein Wechsel an die EOS, sehr zum Ärger meines Vaters, nicht in Frage. Vier Jungen aus unserer Klasse gingen ab Klasse 9 an die Erweiterte Oberschule.
Mein schlechtes Zeugnis versetzte mir aber doch einen Schreck. Ich sagte mir selbst: „So kann es nicht weitergehen, da wird ja nie etwas aus mir.“
Ab dem zweiten Halbjahr der 8. Klasse bemühte ich mich und lernte mehr. Der Erfolg stellte sich ein und das Zeugnis zum Schuljahresabschluss war schon viel besser.
An unsere Lehrer aus dieser Zeit habe ich durchweg gute Erinnerungen. Sie bemühten sich mit Erfolg, uns viel beizubringen, was bei den meisten auf fruchtbaren Boden fiel.
Die Schule in der DDR hatte grundsätzlich zwei Bildungsaufträge. Zum einen, die Kinder und Jugendlichen zu bilden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Naturwissenschaften, Mathematik, Deutsch und die Fremdsprachen sollten auf den Beruf oder ein Studium vorbereiten. Neben der allseitigen Bildung war dann noch die „Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten“ der zweite Auftrag. Die Fächer Geschichte, Literatur und vor allem Staatsbürgerkunde sowie die Mitgliedschaft in der Pionierorganisation Ernst Thälmann und ab dem 14. Lebensjahr in der Jugendorganisation FDJ – Freie Deutsche Jugend – waren darauf zugeschnitten. Die Lehrpläne waren darauf ausgerichtet und die Lehrer dafür besonders ausgebildet. Nicht alle Lehrer waren SED-Genossen. Vorsichtig haben manche zu erkennen gegeben, dass sie eine andere Meinung vertraten.
An einen Satz unseres Staatsbürgerkundelehrers kann ich mich bis heute erinnern. Er sagte: „Die Kapitalisten muss man hassen.“ In der nächsten Unterrichtsstunde kam er auf das Thema zurück und sprach sinngemäß: „Ich habe darüber noch einmal nachgedacht und möchte nicht zum Hass erziehen. Ich selbst habe persönliche Gründe, die Kapitalisten zu hassen, möchte dies jedoch nicht auf euch übertragen.“ Die Kehrtwende seiner Aussage hat mich damals stark beeindruckt.
Der Eintritt in die Organisationen der Pioniere und FDJ war ein Automatismus. Es wurde nicht gefragt und nicht darüber diskutiert. Ich kann mich an keinen Schüler in meinem Umkreis erinnern, der nicht Pionier und FDJler geworden war. In den Klassen wurde ein sogenannter Gruppenrat bestehend aus Vorsitzendem, Stellvertreter und Wandzeitungsredakteur gewählt. In den ersten Schuljahren waren dies überwiegend Mädchen. An eine Besonderheit erinnere ich mich. In unserer Klasse wurden Mädchen in den Gruppenrat gewählt, welche gleichzeitig die Christenlehre besuchten, da sie aus einem christlichen Elternhaus kamen. So etwas war sonst nicht üblich.
Auch ein nebenher von Jugendweihe und Konfirmation war möglich und wurde praktiziert. Zuerst Jugendweihe und im darauffolgenden Jahr Konfirmation. Dem Staat war wichtig, dass alle Jugendlichen an der sozialistischen Jugendweihe teilnahmen. Dass im Folgejahr konfirmiert wurde, war ihm mehr oder weniger egal.
Anfang der 60er Jahre eroberte eine Band von Liverpool aus die Musikwelt – The Beatles.
Beatmusik benannte man nach ihnen die neue populäre Musik.
So im Alter von 13 Jahren begannen wir uns für Musik zu interessieren und verfolgten im Rundfunk den Aufstieg der Beatles, der Rolling Stones und der anderen Musikgruppen.
Beatles oder Stones? Die Antwort auf diese Frage teilte uns Jugendliche in zwei Fangruppen.
Mir selbst gefielen die Beatles besser.
Radiohören wurde unsere Leidenschaft, ununterbrochen ertönte aus den Lautsprechern Musik.
Lieblingssender waren Radio Luxemburg und der Deutschlandfunk. Ersteren empfingen wir tagsüber auf Kurzwelle und am Abend konnten wir ihn über Mittelwelle hören. Tonschwankungen und Störgeräusche gehörten leider dazu. Auf Mittelwelle konnten wir den Deutschlandfunk empfangen und dort die Hitparade verfolgen. Auf Radio Luxemburg wechselten im Stundentakt die Moderatoren. Einer von ihnen war Frank, erst Jahre später wurde er uns als Frank Elstner bekannt.
Zwei ganz besondere Sender waren der „Deutsche Soldatensender“ und der „Deutsche Freiheitssender 904“. Beide strahlten von der DDR gen Westen, spielten Westmusik und sollten die Soldaten der Bundeswehr bzw. die westdeutsche Bevölkerung ideologisch beeinflussen. Sie sendeten kein 24-Stunden-Programm, waren nur früh morgens, mittags und dann noch einmal am Abend zu empfangen.
Ich besaß zwei Radioapparate, ein Röhrenradio, welches ich von meinem Opa Alwin geerbt hatte und ein Kofferradio aus sowjetischer Produktion. Dieses gab es nicht im Handel zu kaufen. Sowjetische Soldaten brachten es aus ihrem Heimaturlaub mit nach Leipzig. Auf der Fahrt von ihrer Kaserne zur Abfalldeponie in der Leinestraße, hielten sie an der Tischler-PGH an und boten ihre Waren feil. Bei Männern waren Rasierapparate begehrt. In der Sowjetunion wurden diese den Philip-Shave-Rasierern aus Holland nachgebaut. Die Sowjets störten sich nicht an Patentrechten. Durch solche Verkäufe erlangten die Sowjetsoldaten DDR-Geld, mit dem sie sich wiederum etwas kaufen konnten, vermutlich stand Schnaps ganz oben auf der Wunschliste.
150 Mark hatte ich gespart und kaufte mir bei den „Russen“ mein Kofferradio „Alpinist“, es hatte Mittel- und Langwelle, leider keine Kurzwelle. Trotzdem war ich glücklich wie ein kleiner Prinz.
Ebenfalls 150 Mark kostete das kleine Transistor-Radio „Micky“, das nur Mittelwelle hatte, dagegen war mein „Alpinist“ ein wahrer „Riese“.
Mit unseren Kofferradios zogen wir um die Häuser, das Schönste war, mit der „Heule“ im Arm mit Freunden an der Ecke zu stehen und lautstark Musik zu hören.
Der Empfang von Westrundfunk und Westfernsehen war ein spezielles Problem in der DDR. Direkt verboten war es nicht, aber Mitglieder der SED und andere staatstreue Personen sollten und durften die Westsender nicht einschalten. Mein Vater war nicht nur SED-Genosse, sondern schon 1930 in die KPD eingetreten.
Die Tagesschau in der ARD ließ er sich jedoch nicht verbieten. Unsere Antenne auf dem Dach war gen Westen ausgerichtet. In Leipzig war der Empfang schlecht, die Stadt war zu weit von der Grenze zur BRD entfernt. Es bestanden zwei Möglichkeiten der Ausrichtung der Antennen, nach Süden zum Ochsenkopf empfing man den Bayerischen Rundfunk und nach Nordwesten Richtung Harz den Norddeutschen Rundfunk NDR. Wir konnten den NDR besser empfangen. Somit standen uns zwei Fernsehsender, das DDR-Fernsehen und die ARD, zur Verfügung.
„Ein Kessel Buntes“ aus Ost-Berlin und „Einer wird gewinnen“ mit Hans-Joachim Kulenkampff aus Hamburg flimmerten über die Mattscheibe.
Nicht nur eine neue Musik hielt Einzug in unser Leben, auch eine neue Mode und vor allem ein neuer Haarschnitt. Die Beatles mit ihrer Pilzkopffrisur waren uns Vorbild. Alle Jungen wollten sich die Haare lang wachsen lassen und stießen dabei auf verbitterten Widerstand der Eltern und Lehrer.