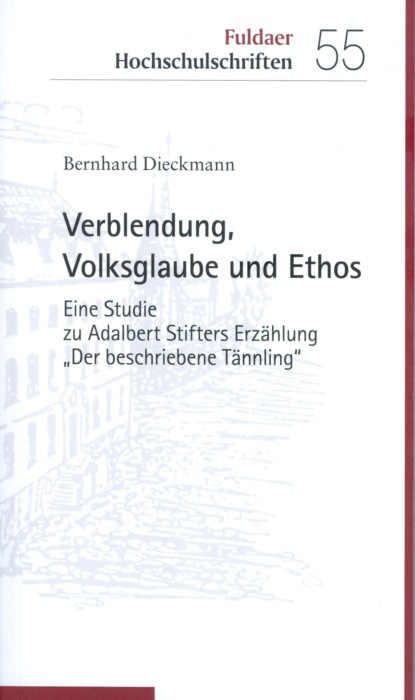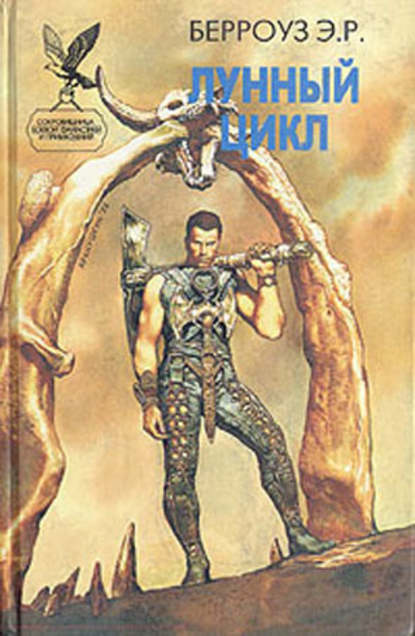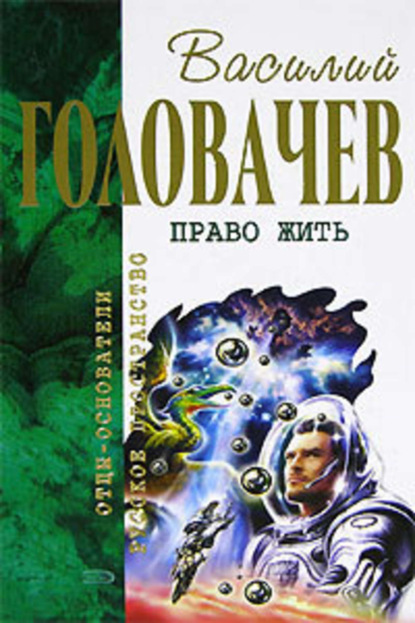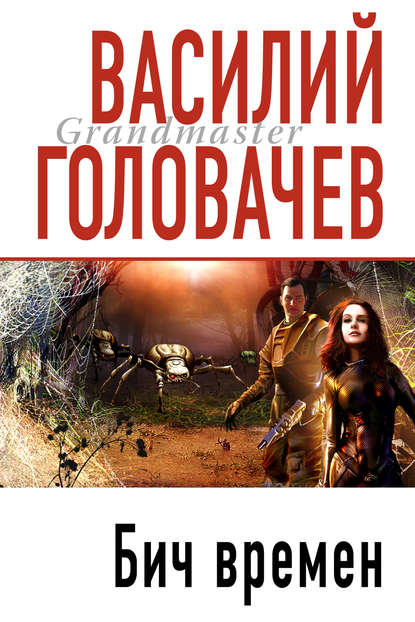- -
- 100%
- +
Nach Meinung des Erzählers ist die Heirat von Hanna und Guido keineswegs eine „Liebesheirat zwischen Arm und Reich“,67 sondern törichter Leichtsinn. So wie die Jagdgesellschaft sich darstellt, besteht sie aus Menschen, die zur Liebe unfähig sind. Dafür gibt es ein Indiz, auf das schon J. P. Stern aufmerksam gemacht hat – die Szene aus dem 4. Teil, in der den Herren ihr Standort bei der Treibjagd zugeteilt wird. Sie werden namentlich aufgerufen und antworten stets mit „Weiß sie nicht“, „Weiß sie“ oder ähnlich (422). Dass sie nie „Ich“ sagen, kritisiert Stern als Zeichen für Stifters „Entpersönlichung“.68 Doch, wenn man – was weiter unten geschehen soll – den Gebrauch des Wortes „Ich“ im „Tännling“ untersucht, zeigt sich, dass diese Stelle als harte Kritik an den Herren – also auch an Guido – zu verstehen ist.
Kritik zeigt sich ebenso im Gebrauch des Wortes „Liebe“. Bei der Freundschaft von Hanna und Hanns reden zumindest die Leute von Liebe; sie sagen, Hanna „fürchte und liebe ihn“ (396,8). Am Schluss von Teil 1 heißt es – wie schon zitiert: „Alle Menschen wußten, daß sie Liebende und Geliebte seien.“ (396,23–24) Auch wird nur bei Hanns von seiner Liebe zu Hanna gesprochen: „Die Liebe, die Zuneigung und die Anhänglichkeit wuchs immer mehr und mehr. Hanns that Alles, was ihm sein Herz einflößte.“ (404,27–29)69 Später, bei der Verbindung von Hanna und Guido, wird das Wort „Liebe“ nicht gebraucht.
Weiter wird mit einer gewissen Betonung gesagt: „Da wollte es der Zufall ...“ (413,9), dass Hanna neben Guido zu stehen kam. Das Wort „Zufall“ ist zu beachten. Denn ein paar Seiten später wird noch einmal von ihrem „zufälligen Nebeneinanderstehen“ gesprochen (418,13). Dieses ist nicht nur Anlass für die Verbindung von Hanna und Guido, es ist – zumindest von Guidos Seite her – zudem der entscheidende Grund für die Heirat: der Eindruck, den ihre gemeinsame Schönheit auf das Volk macht.
Auf eine Differenz zwischen Guido und Hanna ist hinzuweisen: An ihrem Erstbeichttag glänzten ihre Gefährtinnen durch feine Kleidung und gepudertes Haar. Sie dagegen trug ein grobes Kleid und litt darunter, dass die Mutter ihr keinen Puder kaufen konnte (392,22–27). Später beim Jagdfest ist dann allein Guido nicht gepudert. Während die anderen Herren alle weiß gepudert sind (411,4), will Guido mit seinen schönen Locken auffallen (413,14–16). Was soll diese Differenz bedeuten? Sie mag auf die unterschiedlichen Ausgangspunkte hinweisen: Hanna will ihre Schönheit in Reichtum verwandeln. Guido ist sein Reichtum so selbstverständlich, dass er seine Schönheit in der Unterscheidung von seinen Standesgenossen zur Geltung bringen will – er will anders sein als sie.70
Charakteristikum dieser adeligen Gesellschaft ist die Orientierung an glänzender Selbstdarstellung, am Scheinen. Die kostbaren Kleider, die ihr so wichtig sind, bezeugen, dass es ihr vor allem um ihr Ansehen, ihre Geltung bei den anderen geht. Wenn aber so das Ansehen bei den anderen, ihre Anerkennung oder Bewunderung zum entscheidenden Kriterium des Handelns und Verhaltens wird, macht man sich von den anderen, ihren Erwartungen und Meinungen abhängig, wie das bei Guido besonders deutlich wird. Das alles ist kritisch gemeint. Die Erzählung tadelt die Herren, weil sie die Maßstäbe des Volkes verderben, es zu einem illusionären Rausch verlocken. Dem Volk wird vorgeworfen, dass es sich so selbstverständlich darauf einlässt. Niemand distanziert sich von diesem Jahrmarktstreiben.
Dabei kann man das Jagdfest nicht als den Einbruch verdorbener höfischer Lebensweise in die archaisch heile Welt von Oberplan verstehen. Dazu lässt sich das Volk zu bereitwillig auf das Fest ein. Schon oben wurde auf die Spannung zwischen Oberplan und den Dörfern in seiner Umgebung hingewiesen. Sie wird durch das Erscheinen der Jagdgesellschaft gewissermaßen aktiviert. Von Jugend an orientiert sich Hanna an den Werten, die auch die Herren bestimmen; bei Hanns ist es anfangs ähnlich. Das Erscheinen der Herren hat Neigungen verstärkt, die schon vorher in Oberplan und seiner Umgebung virulent waren, aber bislang nicht offen hervorgetreten sind. Auch deshalb hat die Erzählung drei Hauptfiguren: Hanna und Hanns repräsentieren die beiden unterschiedlichen Lebensmöglichkeiten, die in der Gegend von Oberplan nebeneinander stehen; Guido dagegen repräsentiert die Lebensweise der Herren allein, weil es bei ihnen nichts zu differenzieren gibt.
Der Leser soll sehen, dass sich in dieser Heirat die Faszination außerordentlicher Schönheit ad absurdum führt, sie zeigt die Gefährdung dieser Gesellschaft, ihre innere Hohlheit und Oberflächlichkeit. Zudem richtet sich der Ruf des Volkes „Das ist das schönste Paar“ negativ gegen Hanns. Der Ruf ist auch als mehr oder weniger aggressive Äußerung des Unbehagens über die unmögliche Verbindung von Hanns und Hanna zu verstehen,71 als ein Anruf an Hanna, sich nicht auf einen so unansehnlichen Kerl einzulassen. Erst durch die unvorhergesehene Reaktion Guidos gewinnt die Akklamation eine positive Bedeutung. In dieser Rücksichtslosigkeit des Volkes Hanns gegenüber kommt die Wahrheit des Festes zutage. Die Orientierung an der Schönheit, das Streben nach Ansehen zerstört die Ordnung, droht in Gewalttätigkeit und sogar Mord abzugleiten.
4. Gewalt als Konsequenz
Hanna und Guido werden vom Volk als schönstes Paar ausgerufen, obwohl es weiß, dass Hanna schon mit Hanns verbunden ist. Mehrmals wird hervorgehoben, dass alle das wissen – so schon im Schlusssatz von Teil 2: „Alle Menschen wußten, daß sie Liebende und Geliebte seien.“ (396,23–24) Als Hanns später die Wallfahrtskirche betritt, um für das Gelingen seines Anschlags zu beten, trifft er dort „zwei sehr alte Mütterlein, die vielleicht die einzigen waren, welche von dem Verhältnisse zwischen Hanna und Hanns nichts wußten“ (424,25–27). Sogar die Kinder wissen darum: Als Hanns auf dem Weg zur Wallfahrtskirche ist, sieht ihn ein Mädchen und macht seine Mutter auf ihn aufmerksam. „ ‚Laß ihn gehen‘, sagte diese, ‚das ist eine sehr unglükselige Geschichte.‘ “ (423,28–29)72
Das Volk hat Hanns in eine Lage gebracht, dass ihm – beachtet man, wie er sich bislang in Konflikten verhalten hat – keine andere Möglichkeit bleibt, als sich gewaltsam gegen den erfolgreichen Rivalen zu wenden. Gegen Schluss von Teil 1 heißt es von Hanns: Er „litt keinen Schimpf und Hohn, wie gering er auch war, sondern nahm den Schimpfenden an dem Kragen des Hemdes oder an der Schulter, und warf ihn in das Gras, oder in den Sand, oder in eine Rinne, wie es kam“ (396,12–15). In Teil 2 heißt es: „Hanns war wie ein König in seinem [...] Schlage.“ (400,27–29) Als einer der drei Gründe für sein Ansehen wird angeführt: „... theils scheuten sich manche, weil er große Körperkräfte besaß“ (400,31–32) – sich also in körperlichen Auseinandersetzungen durchzusetzen wusste. Das herausfordernde oder einschüchternde Auftreten von Hanns mag sich in der Aussage spiegeln: „... die Leute sagten, Hanna fürchte und liebe ihn“ (396,7–8).73 Es ist naheliegend, dass ein Holzfäller mit so „ungemeiner Kraft in seinem Körper“ (396,7) zu seinem vertrauten Werkzeug als Mordwaffe greift. Schon in Teil 2 wird bei der Beschreibung von Hanns’ Arbeit im Wald hervorgehoben, dass er oft „die Axt oder die Keile auf der Schulter tragend“ auftritt (403, 22–23), wie es bei den Holzfällern üblich ist (400,17–18).
Gemeinsam drängen die Herren, Hanna und das Volk Hanns in eine Situation, in der Gewalt für ihn fast unausweichlich wird. Damit kommt seine Rolle einem Sündenbock recht nahe. Diesen Vergleich rechtfertigt auch der Bezug auf weit verbreitete Sündenbock-Motive: Hanns ist ziemlich unansehnlich – „vielleicht weniger schön, als alle Andern“ (396,5–6). Zudem hat er „röthlich leuchtendes Haar“ (401,16), ein traditionelles Zeichen, das Außenseiter und Bösewichte kennzeichnet.74 Das Volk ist vom Jagdfest und der Schönheit, die es feiert, so fasziniert, dass ihm die Unansehnlichkeit von Hanns anstößig wird. Hanns wird zum Außenseiter gemacht. Man kann fast sagen: Er wird dafür bestraft, dass er nicht schön ist. Oder: Das Volk bestraft ihn für den Ehrgeiz, Hanna erobern zu wollen.
Die Aggressivität des Jagdfestes hat eine Dynamik, die auf den Menschen ausgreift.75 Auf Hanns konzentriert sich die latente Gewalttätigkeit der Gesellschaft. Erst treibt sie ihn in die Enge, dass ihm Gewalt als einziger Ausweg erscheint, aber beginge er dann einen Mord, würde sie sich mit aller Wucht gegen ihn wenden. Nur weil Hanns fast in letzter Minute seinen Mordplan aufgibt, kann diese Dynamik ins Leere laufen.
Eine analoge Situation gab es schon bei der früheren Netzjagd, die der alte Schmied als Kind miterlebt hat: Damals war ein Bär ins Netz geraten,76 er diente „bald zum allgemeinen Ergözen [...], indem Jeder so schnell als möglich sein Geschik an ihm versuchen wollte“ (406,28–29). Obwohl bereits verwundet, gelang es dem Bären, das „furchtbar starke Geflecht“ zu zerreißen (407,1): „Der Bär und der ganze gehezte Schwarm, der noch übrig war, fuhr nun mit großem Getöse durch das Loch hinaus ...“ (407,4–6) Entsprechend wird vor der zweiten Netzjagd gefragt, ob sich unter dem eingekesselten Wild ein Bär befinde. Die Antwort lautet: „Ob ein Bär eingegangen sei, wisse man nicht genau, aber gewiß sei auch einer darunter.“ (409,27–29) Zwischen der Netzjagd und dem Schicksal von Hanns besteht eine Analogie. Wie es dem Bären gelungen ist, der tödlichen Hetzjagd zu entkommen, so wird sich Hanns seinem Verhängnis entziehen.
Dass Gewalt Gegengewalt herausfordert, dass das Jagdfest in ein allgemeines Chaos zu führen droht, wird auch indirekt angedeutet: Bei der Netzjagd bildeten Herren und Volk einen Ring um die Tiere in der Mitte. Bei den anschließenden Festen bildet das Volk einen Ring um die Herren in der Mitte77 und schaut ihrem Treiben staunend zu – zuerst beim „Mittagsmahl“ nach der Netzjagd (415,9), dann zum Schluss beim nächtlichen „Tanzfest“ (430,24).
Bei diesem Maskenball wird der gewalttätige Hintergrund des Jagdfestes direkt angesprochen: „Das Höchste waren Spiele und Masken. Es waren Schäfer und Schäferinnen, Bauern und Bäuerinnen, Jäger, Bergleute, Zauberinnen, dann Götter und Göttinnen, insbesondere Venus und Adonis zugegen. Hanna nahm schon an dem Feste in dem kostbaren Gewande der vornehmen Frauen Antheil.“ (431,4–9) Hanna wird Gestalten der antiken Mythologie zugesellt. Man erinnere sich: Auch Adonis war „außerordentlich schön“ und deshalb wurde er zum Geliebten der Venus bzw. der Aphrodite. Er war ein leidenschaftlicher Jäger, Venus mahnte ihn immer zur Vorsicht. Umsonst – er wurde von einem wilden Eber getötet, der vom eifersüchtigen Mars bzw. Ares geschickt war.78 Also: Nichtsahnend spielen die adeligen Herren auf dem Fest, was in diesen Tagen – durch ihren Leichtsinn provoziert – beinahe Realität geworden wäre: die Tötung des Schönlings durch den eifersüchtigen Rivalen. In dem unscheinbaren Hinweis auf Venus und Adonis erreicht die hintergründige Kritik am Jagdfest ihre Spitze. Dieser Maskenball ist ein Tanz auf dem Vulkan. Die Kehrseite der Schönheit, die die Jagdgesellschaft feiert, ist Rivalität und Mord. Oben hatte es bei der Netzjagd geheißen, die Frauen der Jagdgesellschaft dürften nicht selbst jagen; „die Sitte erlaube nicht einmal, daß die Frauen bei dem Tödten der Thiere zugegen seien, weil sie zu zart und zu fein sind, so daß sich nur das Schäferspiel für sie schike“ (411,14–17). Jetzt, in der Rückschau muss man feststellen, dass das nur ein Moment im Selbstbetrug ist, den diese Gesellschaft inszeniert.
5. Die Verblendung von Herren und Volk
Herren wie Volk sind gleichermaßen in Blindheit und Verblendung gefangen;79 sie können den inneren Zusammenhang zwischen ihrer Fixierung auf Schönheit als äußerlichem Ansehen und der Gewalt nicht sehen, wollen ihn nicht sehen. Es besteht ein greller Gegensatz zwischen dem Streben von Herren und Volk nach Ansehen und ihrer Unfähigkeit zur Selbstwahrnehmung, geschweige zur Selbstkritik. Die Gewalt, in Form der Jagd noch gehegt und begrenzt, droht auszubrechen und sich gegen Menschen zu richten. Zwischen dem Streben nach Schönheit und der Gewalt besteht ein innerer Zusammenhang, den Herren und Volk weder erkennen wollen noch erkennen können. Verblendete können ihre Situation nicht durchschauen. Der „Tännling“ beschreibt sie, überlässt es aber dem Leser, das zu erfassen.
Ist damit die Bedeutung der Verblendung in der Erzählung nicht zu stark betont? Das Wort kommt nur einmal vor, als die Leute kritisieren, wie sich Hanns gegen Hanna verhält: „... daß er so verblendet ist, und ihr Alles anhängt“ (402,31–32).80 Doch ist die Erwähnung der Masken von Venus und Adonis ein zwar zurückhaltender, aber eindeutiger Hinweis. Vor allem ist die „Erscheinung“ am beschriebenen Tännling als Befreiung des Hanns von Blindheit bzw. Verblendung zu verstehen, die allein er erfährt, wie weiter unten analysiert wird.
Um Verblendung geht es auch in einem anderen Werk Stifters, der kleinen Erzählung „Zuversicht“ aus dem Jahre 1846 (HKG 3,1; 83–91), auf die kurz eingegangen sei. Sie berichtet von einer „großen Gesellschaft“ (85,1), in der sich das Gespräch auf eine Diskussion über die französische Revolution zuspitzt, besonders darauf, dass viele ihrer Akteure Untaten begangen haben, die man ihnen nie zugetraut hätte. Nach längerem Hin und Her einigt man sich auf die „Phrase [...], daß es ein Unglück sei, daß gerade diese merkwürdige Zeit auf Menschen getroffen sei, die in ihrer entsetzlichen Gemüthsart dieselbe verdreht haben und ihr einen so abscheulichen Stempel aufdrückten, daß sich jedes Gefühl davon abwenden müsse“ (85,22–86,1). Da widerspricht ein alter Mann, der bislang noch kein Wort gesagt hatte: Nicht die Zeit sei auf problematische Charaktere gestoßen, vielmehr habe sie dieselben gemacht: „Mancher, der einen ganzen Berg von Thaten gethürmt hatte, und zuletzt davon erdrückt worden war, wäre zu einer andern Zeit ein harmloser Mensch und ein guter Hausvater gewesen.“ (86,6–9) Als ihm das bestritten wird, geht er noch weiter: „Wir Alle haben eine tigerhafte Anlage, so wie wir eine himmlische haben, und wenn die tigerartige nicht geweckt wird, so meinen wir, sie sei gar nicht da, und es herrsche blos die himmlische, darum beurtheilen wir die Charaktere stürmender Zeiten so ganz unrecht.“ (86,13–17) Als eine Dame darauf beharrt, es gäbe doch „gewisse Dinge [...], von denen man gewiß weiß, daß man nie fähig wäre, sie zu begehen“ (87,3–4), erzählt er die Geschichte eines Vatermords, zu dem es in den Wirren der Revolution gekommen ist. Danach ruht das Gespräch „eine Weile“ (91,3) und wendet sich dann gleichgültigen Dingen zu: „Da die Stunde der Trennung gekommen, sagten sie sich schöne Dinge, gingen nach Hause, lagen in ihren Betten und waren froh, daß sie keine schweren Sünden auf dem Gewissen hätten.“ (91,11–13)
Der Titel „Zuversicht“ mag befremden;81 er wird verständlich, wenn man ihn mit dem eben zitierten Schlussabsatz verbindet; er ist ein ironischer Kommentar zur Gemütsruhe, mit der sich die guten Bürger zu Bett begeben.82 Es wäre besser um sie bestellt, wenn ein solches Gespräch sie nicht schlafen ließe und sie sich nach ihrer tigerhaften Anlage fragten.83 Im „Tännling“ geht es um das Böse, das im Hinter- oder Untergrund menschlichen Handelns wirkt und zum Ausbruch drängt. Es geht darum, sich diese Gefährdung einzugestehen und so die eigene Blindheit zu erkennen.84 Das ist ein personales Geschehen und deshalb wird dem Kollektiv der Jagdgesellschaft, zu der sich Herren und Volk zusammengefunden haben, ein einzelner gegenübergestellt: Hanns, der einsam im Wald seinen Ausweg aus der Krise findet.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.