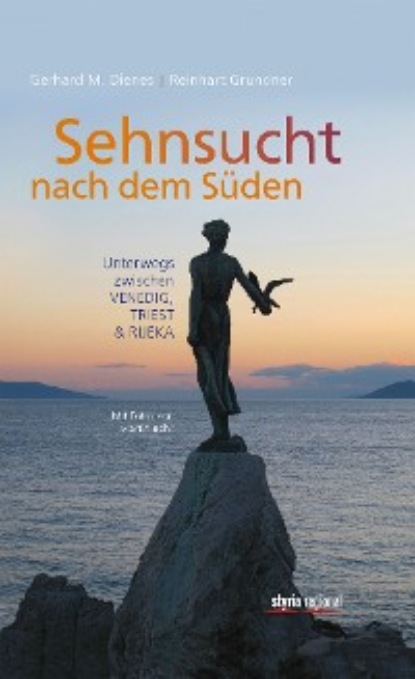- -
- 100%
- +
Das architektonische Juwel kann aber nicht über die Schattenseiten Roms hinwegtäuschen. In Theatern wie jenem von Pula suchte das „Proletariat“, bei den Spielen seine Leiden zu vergessen, indem es sich, so Lewis Mumford, „lasziv-genießerisch über Menschen freute, die noch schlimmere Qualen und Würdelosigkeiten erdulden mussten“. Durch Brot und Spiele wollte Rom die Menschen beruhigen und von ihren Nöten ablenken. Die Spiele sind durchaus mit den heutigen großen Sportveranstaltungen zu vergleichen, nur dass damals Sport fast in jedem Fall Mord war. Die Spieler hatten immer ihr Leben zu riskieren: Blutiger Sport als Unterhaltung! Man amüsierte sich – frei nach Neil Postman – zu Tode. Sportkämpfe, die, wie bei den alten Griechen, wirklich solche waren, gaben den Römern zu wenig. Blut, Todesangst und Schrecken waren gefragt. Die Wagenrennen boten Nervenkitzel, wenn ein „Bolide“ umkippte und der Fahrer zertrampelt wurde. Das heimliche Verlangen nach Blutvergießen war damit befriedigt. Und dies gilt genau so heute noch, man erinnere sich an den Hit von Rainhard Fendrich aus dem Jahr 1982 „Es lebe der Sport“, darin an den Refrain: „Und haut es einen aus der Wäsch, wird ein Grand Prix erst richtig fesch.“
Auf der Jagd nach immer höher gepeitschten Sensationen verfielen die Römer darauf, dem alten Brauch der religiösen Schlachtopfer in der Arena eine neue weltliche Gestalt zu geben: durch die Gladiatorenspiele. Mit diesen konnten die Beauftragten des Regimes ihre teuflische Erfindungsgabe auf das Quälen und Vernichten von Menschen verwenden. Aus ganz Istrien kamen die Schaulustigen und Sensationslüsternen in das Theater von Pula. Hektoliterweise floss der Wein und zum Entzücken der Massen wurden auch Löwen, Panther und Bären auf die Gladiatoren gehetzt. Um den beißenden Gestank des Blutes zu überdecken, besprenkelten Diener die Zuschauerränge mit Rosenöl.
Das römische Theater von Pula zieht heute mit dem Filmfestival an langen Sommerabenden die Menschen an, Luciano Pavarotti ließ hier sein „Vincerò“ erschallen und mit den Gladiatorenspielen von Pula Superiorum wird man zurückversetzt in die Antike, in das Rom der Verfallszeit.
Je schlechter es Rom ging, desto mehr Spieltage gab es, an denen das Volk in die Arenen zu den gigantischen Massenveranstaltungen strömte. Niemals haben so viele Menschen so viel Freizeit mit so vielen sinnlosen Beschäftigungen ausfüllen können wie im alten Rom. – Gibt es da nicht Parallelen zu unserer Zeit?
Diese Frage stellte sich Neil Postman schon vor Jahrzehnten und kam zum Schluss:
„Wenn ein Volk sich von Trivialitäten ablenken lässt, wenn das kulturelle Leben bestimmt wird als eine Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen …, als gigantischer Amüsierbetrieb …, dann wird das Absterben der Kultur zur realen Bedrohung.“
Zeichen des Absterbens der römischen Kultur fand man auf der gesamten istrischen Halbinsel. Dort hatten die, die es sich leisten konnten und andere ausbeuteten, ihre luxuriösen Sommervillen, wie etwa im heutigen Cervar (zwischen Novigrad und Poreč). Hier frönten sie dem feudalen, aber auch dem zusehends exzessivdekadenten Landleben.
Von einer ungeheuren Ausschweifung erzählt Romano Farina (1929 – 2000):
„So wie sich viele Jahrhunderte später die Briten in Indien neuen kulturellen Strömungen öffneten, gaben sich die Römer in ihren istrischen Villen im Namen der Cybele (der asiatischen Göttin der Fruchtbarkeit) geheimen, mystisch verschlüsselten Zeremonien“ hin:
Geheime Feste als endlose orgiastische Bacchanale!
Die Ausschweifungen erfolgten im Zeichen eines erigierten männlichen Gliedes. In den Gärten von Koper fand man Säulenbruchstücke aus Stein, Phallen überdimensionaler Größe darstellend!
„Die Zeremonien verliefen nach der Regie des Großen Meisters, des Archigallo, ab. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Kastraten eingeschlossen, praktizierten diverse sexuelle Handlungen. Dabei wurden Jungfrauen defloriert, man ‚brauchte‘ die Knaben und genoss, ‚per via anale‘, die Alten, die unmittelbar danach geviertelt und beigesetzt wurden.“ Farina schließt nicht aus, dass der istrische Wein seinen Anteil an diesem orgiastischen Wahnsinn hatte.
Im Archäologischen Museum der zur Römerzeit so bedeutsamen Stadt Aquileia fällt ein Relief mit Priapus-Szenen auf. Dieser war der Gott der Fruchtbarkeit und wird hier als kleiner Bub dargestellt, den Venus, die Göttin der Liebe, und ihre Mägde in einer Wanne baden. Sein übermäßig großes Glied erregt ihre Aufmerksamkeit und sie betrachten es mit Abscheu – oder mit Lust?
Aquileia war eine Stadt, in der die Reichen reicher als reich waren. Ihr Luxus lässt sich im erwähnten Museum erahnen: ein Schleier, übersät mit unzähligen kleinen Goldfliegen, Parfumfläschchen aus Bernstein, geschmückt mit Amoretten und Akanthusblättern, Haarnadeln aus Elfenbein, ausgestattet mit plastischen Porträtköpfen, mit orientalischen Ornamenten verzierte Öllampem et cetera.
Und wie waren die lukullischen Genüsse der Reichen? Per Schiff kamen die kostbarsten Früchte und Gewürze, die ausgefallensten Tiere und Spezereien von den afrikanischen und orientalischen Märkten. Spitzenköche, die so viel wie drei Pferde kosteten, bereiteten ihrer schwer wohlhabenden Klientel immer absurdere Gerichte: Flamingo- und Storchenzungen, Ragout aus Nachtigallenleber oder Schweinevagina, Zitzen und Gebärmutter von der Jungsau. Verbreitet war die Marotte, die Esser durch Saucen darüber zu täuschen, was ihnen vorgesetzt wurde. Im Kochbuch des Apicius (um 25 v.–42 n. Chr.) heißt es bei einem Rezept stolz: „Keiner an der Tafel wird wissen, was es ist.“ So wurden die Schweinshaxe zum Huhn und das Saueuter zum Fisch! Die High Society von „anno dazumal“ versuchte, sich an Aufwand und Extravaganz zu übertreffen. Von dem Geld für ein Galadinner der oberen Schichten hätte sich ein Normalbürger mehrere Jahre ernähren können. Aber selbst Superreiche trieb die Völlerei bisweilen in den Bankrott.
Ob das Aufgetischte unseren Gaumen gemundet hätte? Wer weiß. Zeiten und Geschmäcker sind verschieden. Klar scheint, dass wir das zur Zeit der Römer als besonders erlesen erachtete Liquamen-Gewürz nicht als solches eingestuft hätten, denn:
In ein Gefäß wurden Eingeweide von Fischen und auch kleinere Fische gelegt und eingesalzen. Dann ließ man diese Mischung in der Sonne stehen, bis sie gärte. Das konnte bis zu zwei Monate dauern. Wenn die Masse gut durchgefault war, trieb man sie durch ein Sieb und diese Flüssigkeit war dann das liquamen. Es war schlechthin das Universalgewürz im alten Rom.
Von der Esskultur zur Sprachkultur
Das nach dem Forum des Julius Caesar benannte Friaul ist eine Landschaft, in der die Geschichte, auch wenn sie Vergangenheit geworden ist, nicht stirbt. Vielmehr lebt sie in den Gebräuchen des Volkes und auch in mannigfachen Gewohnheiten, Kulturschöpfungen sowie im Furlanischen, einer eigenen romanischen Sprache, fort. Im Friaul sagt man demnach nicht buongiorno, sondern mandi, ein im übrigen Italien völlig unbekannter Gruß. Seine Herkunft ist ungewiss. Vielleicht leitet sich das Wort vom lateinischen manibus dei, also „in Gottes Hand“, ab.
Pier Paolo Pasolini hatte seine Wurzeln im Friaul. Auch die seines Denkens und seiner Sprache fußen hier. In der Sprache seiner friulanischen Mutter schrieb er die ersten Gedichte.
Pasolini setzte sich für das Furlanische oder auch Friulanische ein und forderte die Gründung einer „Academiuta di lenga furlana“. Nicht mehr vom Friulanischen als Dialekt, sondern als Sprache sollte die Rede sein.
Pasolini: „Der Dialekt ist die bescheidenste, die gewöhnlichste Ausdrucksweise, er wird nur gesprochen, keinem fällt ein, ihn zu schreiben. Doch wenn jemand auf diese Idee käme? Ich meine, mit dem Dialekt seine Gefühle, seine Leidenschaft auszudrücken? Wohlgemerkt, nicht, um Leute mit Dummheiten zum Lachen zu bringen oder ein paar alte Geschichten aus seinem Heimatdorf zu erzählen …, sondern mit dem Ehrgeiz, anspruchsvollere, schwierigere Dinge zu sagen. Wenn jemand diese Idee gut umsetzt und andere, die denselben Dialekt sprechen, seinem Beispiel folgen und so allmählich eine Menge schriftliches Material zusammenkommt, dann wird dieser Dialekt zur ‚Sprache‘.“ Und Pasolini gibt uns eine Lektion Friulanisch.
„Ich gehe das Vieh füttern und melken. Und du wirst mir helfen, sofort.“
„I vai a governà e molzi. E tu ven a judami, e subit.”
„Der Wille des Herrn geschehe!”
„Ch’a si fedi la voluntàt dal Signòur.“
„Lass mich in Ruhe.“
„Va e tàs.“
„Habt ihr schon zu Abend gegessen?“
„Vèizu belzà senàt?“
Aus: Pier Paolo Pasolini, I Turcs tal Friùl.
Die Türken im Friaul (1944).
Pasolinis Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Heute ist das Friulanische oder Furlanische als Minderheitensprache anerkannt.

Armut ist keine Schande
Friaul war die längste Zeit seiner Geschichte eine arme Region, ein Landstrich, der von den Mächtigen nicht wirklich geliebt wurde, ein Übergang vom mächtigen Norden in den Süden. Ein Land zwischen Kaiser und Papst, zwischen Apfel- und Zitronenblüte.
Heute ist Friaul reich. Eine der reichsten Regionen Italiens. Die Ursprünge seiner Küche liegen aber, wie Christoph Wagner schreibt, in seiner „armen Vergangenheit“. Heute würde man die vielfältigen Einflüsse, die diese Küche geprägt haben, als „Multikulti“ bezeichnen. Die traditionellen Speisen werden aus Rüben, Sauerkraut, Bohnen, Reis, Mais und Kartoffeln zubereitet.
Ein Beispiel dafür ist der Frico, die Antwort Friauls auf die Schweizer Rösti.
Für dieses Erdäpfel-Käse-Gericht werden würfelig geschnittene Kartoffeln in der Pfanne zusammen mit einer Zwiebel in wenig Öl gebraten. Dann wird frischer Käse (höchstens einen Monat alt) untergemengt und gebraten, bis man auf beiden Seiten eine schöne Kruste bekommt. Üblicherweise wird der Frico mit Polenta serviert.
Weil wir schon beim Käse sind: In Friaul gibt es zahlreiche köstliche Käsesorten, deren bekanntester Vertreter der Montasio ist. Diesen Käse, den man hier seit dem 13. Jahrhundert kennt, verdanken die Friulaner den Benediktinern der Abbazia di Moggio Udinese. Ihre Produktions- und Konservierungsmethode verbreitete sich in Karnien und der friulanisch-venetischen Ebene sehr rasch. Das Geheimnis der Benediktiner war die sanfte Technik der Milchverarbeitung und diese Art hat sich bis heute erhalten.
Die meisten Käse werden nach den Orten ihrer Herkunft benannt. Es sind in erster Linie Kuhmilchkäse (Schafkäse sind eher selten) und sie haben üblicherweise einen hohen Fettanteil. In Scheiben geschnitten und unter die heiße Polenta gelegt (die mit Pilzen bedeckt sein kann), sodass der Käse leicht schmilzt, ergibt es ein köstliches, typisch friulanisches Gericht.
Fleisch war meist den Festtagen vorbehalten. Hier spielt heute noch der „Fogolar“ eine wichtige Rolle. Eine Art Kamin, über dessen offenem Feuer Geflügel und Bratenstücke von Rind und Schwein zubereitet werden. Die Betreiber jener Lokale, die einen Fogolar besitzen und ihn auch noch benützen, sind jedenfalls überzeugt, dass dieser eine große Anziehungskraft auf die Gäste ausübt.
Frico
ZUTATEN
für 4 Personen:
400 g würziger Käse
1 mittelgroße Zwiebel
600 g geschälte, gekochte Kartoffeln
ZUBEREITUNG
Die gekochten Kartoffeln zerstampfen, den Käse in Stücke schneiden. Eine fein gehackte Zwiebel in Olivenöl anlaufen lassen. Den Käse und die zerstampften Kartoffeln dazugeben und verrühren. Bei mäßiger Hitze den Käse schmelzen lassen. Immer wieder verrühren. Wenn sich der Käse an der Unterseite zu bräunen beginnt, Temperatur reduzieren und durch Rütteln der Pfanne verhindern, dass sich die Unterseite des Frico anlegt. Wenn die untere Schichte fest geworden ist, den Frico mithilfe einer zweiten Pfanne wenden (wie einen Deckel draufgeben und dann umdrehen). Mit Polenta anrichten.


Von Basiliken, Mosaiken und würdevollen Frauen
Aquileia war um die Zeitenwende zu einer mächtigen Großstadt mit circa 100 000 Einwohnern angewachsen, die einem ganzen Kosmos an Göttern und Göttinnen huldigten.
„Es begab sich aber zu der Zeit“ des Kaisers Augustus, dass ein Mensch namens Jesus als Sohn Gottes Begründer einer neuen Religion wurde. Es heißt, Petrus, der Felsen, auf dem die neue (römische) Kirche gebaut wurde, habe den Apostel Markus in die Provinz Venetia et Histria geschickt, um die Menschen dort zu christianisieren. Markus ging, verkündete das Evangelium und bekehrte viele, unter ihnen auch Hermagoras. Diesen nahm der Evangelist mit nach Rom. Dort beeindruckte Hermagoras Petrus dermaßen, dass dieser ihn zum Bischof von Aquileia erkor. Dort jedoch erlitt Hermagoras gemeinsam mit seinem Diakon Fortunatus das Martyrium.
Im 14. Jahrhundert stiftete Betrand de Saint-Geniès, Patriarch von Aquileia, den beiden Märtyrern einen Sarkophag. Hinein aber kamen nicht die Gebeine der Heiligen, sondern der Patriarch selbst, nachdem er im Jahr 1350 einem Mordanschlag zum Opfer gefallen war. Der Sarkophag mit Szenen aus dem Leben der beiden Heiligen ist im Dommuseum von Udine ausgestellt.
Hermagoras und Fortunatus waren nicht die Einzigen, die in Aquileia für den neuen Glauben starben. Der Sarkophag der Canziani in der Basilika von Aquileia zeigt uns gleich vier Märtyrer: Canzius, Canzianus, Canzianilla sowie Protos, ihren Lehrer. Als Christen verfolgt, verließen sie Rom, wurden aber in Aquileia festgenommen und in Aquae Gradate, dem heutigen San Canzian d‘Isonzo, hingerichtet.
Das Christentum musste in den Untergrund gehen, gewann aber, je mehr es mit Rom bergab ging, an Bedeutung.
In Aquileia hatte, noch bevor Kaiser Konstantin (272 – 337) im Jahr 313 das Toleranzpatent erließ, eine ansehnliche christliche Glaubensgemeinde bestanden. In keiner Stadt außer in Rom war das Christentum gegenwärtiger als in Aquileia, dessen Bischof bald zu den höchsten Würdenträgern der römischen Kirche zählte. Nachdem die Christen bislang in Privathäusern und/oder in unterirdischen Sälen zusammengekommen waren, konnte Bischof Theodorus († 319) die erste Kirche erbauen. Deren Fußbodenmosaik, mit 760 m2 das flächenmäßig größte frühchristliche der westlichen Welt, zeigt Christus als guten Hirten zwischen einer mystischen Herde von Schafen, Hirschen, Gazellen, Delfinen, Ziegen, Vögeln, Enten, Stelzvögeln und Fischen. Sie alle symbolisieren das Gottesvolk. Und als Hahn stellt Christus das Licht der Welt dar. Er kämpft gegen die Schildkröte an, die das Dunkel (im Griechischen bedeutet ihr Name „Bewohnerin der Finsternis“) verkörpert.
Der Sakralbau selbst, mehrfach verändert und erweitert, ist vom Typus her eine Basilika. Im antiken Rom dienten Basiliken als Markt- oder Gerichtshallen. Sie präsentierten sich als rechteckige, in eine Apsis mündende Räume mit einem hohen Mittelschiff und niedrigeren Seitenschiffen. Das Christentum versetzte die Apsis gegen Osten, also in Richtung Jerusalem, und schon war der kirchliche Bautypus geboren.
Feindliche Einfälle, wie jener der Hunnen im Jahr 452, veranlassten den Patriarchen von Aquileia, immer wieder nach Grado zu fliehen. Die dortige Isolation bedeutete Sicherheit. Als die Langobarden 568 erobernd ins Land kamen, entstand in Grado die Basilika Sant‘Eufemia. In den dogmatischen Auseinandersetzungen der Kirche blieb Grado im Gegensatz zu Aquileia byzantinisch beeinflusst. Die Folgen: Der einstige Fluchtort des Bischofs von Aquileia wurde ein eigenes Bistum. Und – innerkirchliche Zwistigkeiten und feindliche Einfälle ließen Aquileia zu einem „Banditennest“ verkommen. So zumindest wird der Ort in einem Lied aus dem 8. Jahrhundert bezeichnet.
Dem Niedergang folgte im Hochmittelalter eine neuerliche Blüte, als die römisch-deutschen Kaiser und Könige die Patriarchen von Aquileia förderten und mit ausgedehntem Landbesitz bedachten. Es waren ja Kirchenfürsten, die aus dem Norden kamen, wie Poppo (1019 – 1042), der mit weltlichem Namen Wolfgang hieß und aus dem Geschlecht der Traungauer stammte. Poppo ist im Apsisfresko in vornehmer Gesellschaft weltlicher wie kirchlichhimmlischer Persönlichkeiten, das Kirchenmodell haltend, dargestellt.
Später wurde der Bischofsitz nach Cividale bzw. nach Udine verlegt. Die Diözese blieb aber weiterhin flächenmäßig eine der größten und reichte über die Berge bis zur Drau, was diverse Hermagoras- und Kanzian-Patrozinien bzw. Ortsnamen in Kärnten verdeutlichen.
Viele Ähnlichkeiten mit Aquileia zeigt die Kirchengeschichte von Poreč. Die einstige Hauptstadt der Histrier erlangte eine wichtige Funktion im Rahmen der römischen Expansionspolitik. Wie Aquileia wurde Poreč eine Stätte frühen Christentums, hatte bald mit dem Bischof Maurus einen Märtyrer und auch hier finden wir das Fischmosaik als Symbol einer geheimen frühchristlichen Kultstätte.
Nach der Teilung des Römischen Imperiums überstrahlte Ostrom mit der Metropole Konstantinopel/Byzanz den Westen: „Ex oriente lux“!
Die Kirche von San Vitale in Ravenna steht für den Höhepunkt der byzantinischen Herrschaft. Und von Ravenna führte der Weg gleich nach Poreč, das mit Istrien im 6. Jahrhundert unter byzantinische Herrschaft gekommen war. Durch Künstler aus Ravenna, aber auch aus Konstantinopel entstand hier die dreischiffige Euphrasius-Basilika, ausgestattet mit Marmor vom Marmarameer. Wandmosaiken aus Perlmutt und Gold verleihen dem monumentalen Bau eine überirdische Sphäre. 1977 wurde die Kirche in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen.
Wie Poreč war auch Grado an der Ostkirche orientiert. Den Rang des Gradeser Patriarchen verdeutlicht die Basilika Sant‘Eufemia mit ihren antiken Säulen und ihrem Fußbodenmosaik, das die Wellenlinien des Meeresgrundes wiederholt. Die Kirchenheilige weist nach Byzanz: Euphemia erlitt 303/304 in Chalcedon den Märtyrertod. Als die Perser den Ort einnahmen, kamen ihre Reliquien nach Konstantinopel. Euphemia hatte Gott ihre Keuschheit gelobt. Zur Zeit der Christenverfolgung habe man sie in den Kerker geworfen, ihr alle Zähne ausgerissen und sie schließlich verbrannt.
Ebenfalls zu Byzanz gehörte Cividale. Im Jahr 568 machten die ursprünglich „Winiler“ genannten Langobarden den Ort zum Sitz eines Herzogtums. Die Langobarden waren Krieger, die von den gar nicht friedfertigen Römern als roh und wild, also „barbarisch“ erachtet wurden. Als abstoßendes Beispiel sei der Langobardenkönig Alboin († 572) genannt, der aus dem Schädel seines Schwiegervaters einen Becher machen ließ und seine Frau zwang, daraus zu trinken. Umso anziehender sind die künstlerischen Relikte der langobardischen Herrschaft. Der Altar des Langobardenherzogs Ratchis in Cividale weist mit seinen klobigen, expressionistisch verkürzten Figuren und deren entrücktem Blick auf byzantinische Ikonen. Und mit dem so genannten Tempietto Longobardo verabschiedet sich die Spätantike mit einzigartigen weiblichen Figuren aus Kalkstuck. Sie erinnern in ihrer Aufreihung sowie in ihrem hoheitsvollen Stehen an die Mosaikdarstellungen in San Vitale, womit wir wieder in Ravenna sind.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.