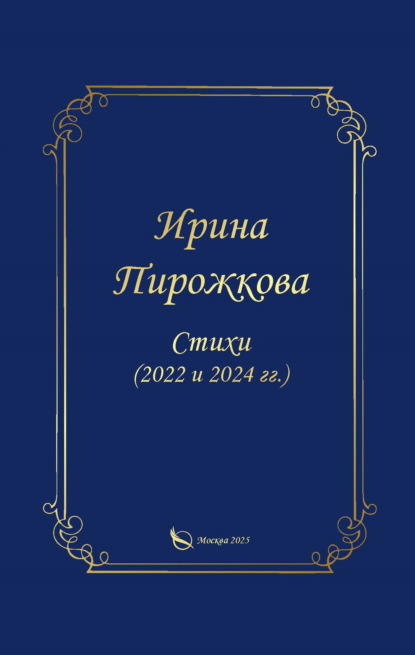Es war, als würde ich fallen

Verwirrte Gedanken, Aufenthalt in der Psychiatrie, Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle: Rosemarie Dingeldey schreibt über das, was sie erlebt hat. Mit 17 Jahren wurde sie psychisch krank. Ihr Leben verlief von da an ganz anders als geplant. Sie bekam Hilfe von Ärzten und nahen Angehörigen und durch Medikamente. Der Glaube an Gott spielte dabei die wichtigste Rolle. Rosemarie Dingeldey weiß, dass er sie in den Tiefen ihres Lebens gehalten hat, gerade auch dann, wenn sie davon nichts spüren konnte. Als sie ihren Mann kennenlernte, der verwitwet war und zwei Söhne hat, kamen neue Herausforderungen auf sie zu. Gott bedingungslos zu vertrauen, war auch jetzt die einzige Möglichkeit. Die Autorin macht Betroffenen und Angehörigen Mut, eine psychische Krankheit zu akzeptieren, und hilft, gut mit einer hochsensiblen Seele umzugehen.