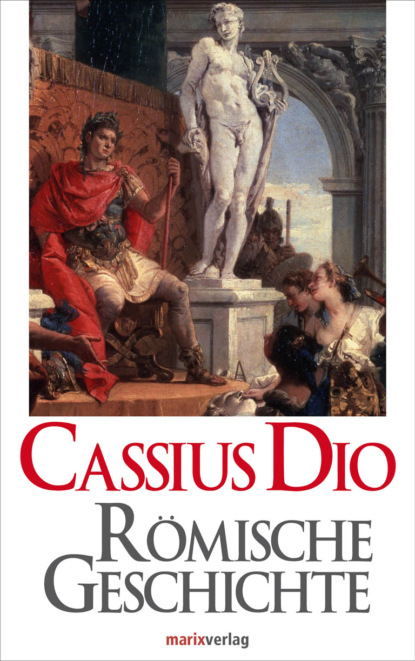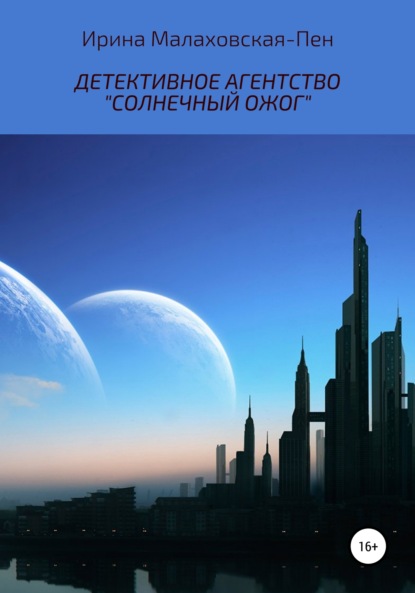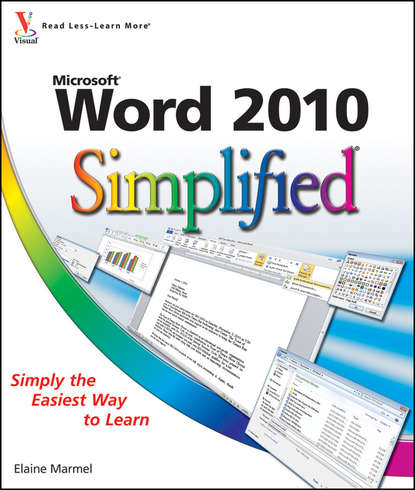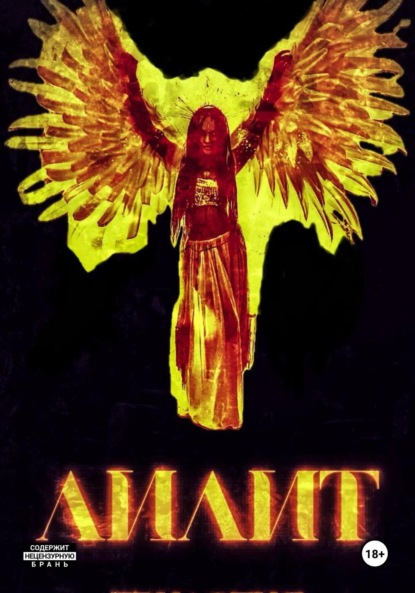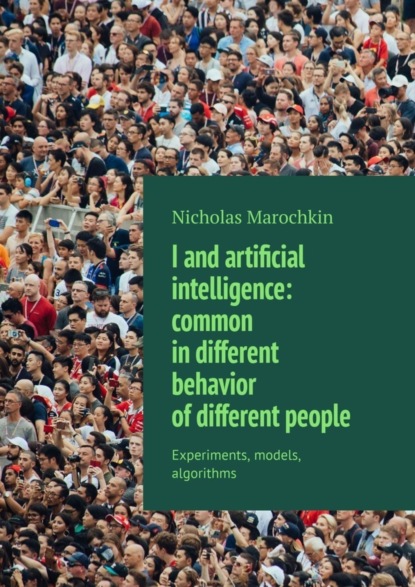- -
- 100%
- +
Aus diesem Vortrag überzeugte sich die Menge, dass die Mittel der Reichen auch die Armen erhielten, ließ sich berichten und versöhnte sich, da sie Nachlass der Zinsen und der Pfandrückgabe erlangt hatte und dasselbe durch einen Senatsbeschluss bestätigt wurde.
37. Die Sache schien außerhalb des menschlichen Bereichs zu liegen, und viele andere teils mit, teils gegen ihren Willen […]. Wenn viele sich zusammentun und eine Überlegenheit erringen, so sind sie vermittels eines klugen Einverständnisses für den Augenblick äußerst kühn, trennen sie sich aber, so wird der eine unter diesem, der andere unter jenem Vorwand zur Strafe gezogen. – Von Natur sind die meisten gegen ihre Amtsgenossen feindselig; denn es fällt schwer, dass viele, zumal wenn sie ein Amt bekleiden, zusammenstimmen. Alle ihre Kraft wurde zerteilt und aufgehoben; denn es war offenkundig, dass sie nichts ausrichteten, wenn auch nur einer von ihnen Einspruch erhob. Dadurch nämlich, dass sie ihren Posten nur dazu erhielten, um sich dem, der gegen andere Gewalt brauchte, zu widersetzen, wurde derjenige, welcher die Ausführung einer Sache verhinderte, mächtiger als diejenigen, welche sie betrieben.8
38. Coriolanus. 261 (493 v.Chr.).
Ein gewisser Marcius Coriolanus schlug nach einer glänzenden Waffentat gegen die Volsker, als er vom Konsul mit viel Geld und Gefangenen beschenkt wurde, alles andere aus und begnügte sich mit einem Kranz und einem Streitross, unter den Gefangenen erbat er sich einen, der sein Freund war, und man ließ ihn frei.
39. Im Jahr der Stadt 263 (491 v.Chr.).
Denn nicht leicht besitzt einer in allem gleiche Stärke, gleiches Geschick in Angelegenheiten des Kriegs und des Friedens. So sind die körperlich Starken gewöhnlich schwachen Geistes; was plötzlich errichtet wurde, pflegt nicht lange zu blühen. So wurde er, von seinen Mitbürgern zu den ersten Ehrenstellen gehoben und bald darauf verbannt. Er, der die Stadt der Volsker seiner Vaterstadt unterworfen hatte,9 brachte diese dagegen mit der Hilfe jener in die äußerste Gefahr.
40. Im Jahr der Stadt 263 (491 v.Chr.).
Als er sich um die Prätur bewarb und sie nicht erhielt, war er erbost auf das Volk; und da er gegenüber den viel vermögenden Tribunen aufsässig war, sprach er sich mit größerem Freimut aus, als ihm in Vergleich mit den anderen, die sich gleicher Verdienste zu rühmen hatten, zukam. Als eine große Hungersnot eintrat und Siedler in die Stadt Norbae geführt werden sollten, klagte das Volk wegen beidem die Vornehmen an, dass es durch sie der Nahrung beraubt und geflissentlich dem sicheren Verderben mitten unter den Feinden preisgegeben werde. Denn wo man sich einmal gegenseitig beargwöhnt, wird alles, was auch zum Besten geschieht, aus Parteienhass falsch gedeutet, und Coriolan, der auch sonst wohl dasselbe geringschätzig behandelt hatte, war dagegen, dass das Getreide, welches von den Königen in Sizilien unentgeltlich gesandt worden war, wie sie es verlangten, verteilt werden sollte. Die Volkstribunen, deren Macht er vor allem zu vernichten strebte, klagten ihn beim Volk an, als trachte er nach der Alleinherrschaft und verbannten ihn; obgleich alle Patrizier dagegen schrien, und sich entrüsteten, dass das Volk sich eines solchen Urteils wider einen der Ihrigen vermessen sollte.
41. Aus dem Vaterland verbannt, ging er, in der Erbitterung über seinen Fall, zu den Volskern, obgleich sie seine ausdrücklichen Feinde waren. Er hatte sich als tapferer Mann bewährt und wartete wegen seines Ingrimms gegen seine Mitbürger auf günstige Aufnahme, indem er Hoffnung gab, dass er den Römern gleichen oder noch größeren Schaden zufügen würde, als ihn die Volsker erlitten hatten; denn der Mensch erwartet von denen, die ihm das größte Übel angetan haben, auch die größten Vorteile, wenn sie ihm nützen wollen und können.
Denn er war sehr aufgebracht, dass sie sich, während das eigene Land in Gefahr war, nicht einmal des fremden Besitzes begeben wollten. Aber auch diese Botschaft machte auf die Männer keinen Eindruck; so verstockt hatte sie der Parteienhass gemacht, dass sie selbst angesichts der größten Gefahren nicht an Versöhnung dachten.
42. Die Frauen aber, Coriolans Gattin Volumnia und seine Mutter Veturia, kamen unter einem Gefolge der angesehensten Römerinnen mit seinen Kindern zu ihm ins Lager; sie vermochten ihn aber nicht nur nicht zur Versöhnung mit seinem Vaterland, sondern nicht einmal zur Rückkehr zu bewegen. Er ließ sie, sobald er von ihrer Ankunft erfuhr, vor sich und erlaubte ihnen zu sprechen. Dies geschah auf folgende Weise: Die anderen schwiegen und weinten, Veturia aber sprach: »Was wunderst du dich, mein Sohn? Was bist du überrascht? Wir sind keine Überläufer, uns sendet das Vaterland – hörst du – als deine Mutter, deine Gattin, deine Kinder, wenn nicht als deine Beute. Zürnest du jetzt noch weiterhin, so töte uns als Erste. Hörst du uns? Was wendest du dich ab? Weißt du nicht, dass wir aufhörten, über das Schicksal der Stadt zu wehklagen, um dich zu sehen? Versöhne dich mit uns und höre auf, deinen Mitbürgern, deinen Freunden, den Tempeln zu zürnen. Falle nicht mit feindlichem Ungestüm über die Stadt her; belagere nicht die Vaterstadt, in der du geboren und erzogen wurdest und dir den großen Namen Coriolanus erwarbst. Gehorche mir, Sohn, lass mich nicht unerhört von dir scheiden, auf dass du mich nicht durch eigene Hand vor dir gemordet siehst.
43. Mit diesen Worten weinte sie laut auf, zerriss ihr Kleid, entblößte ihre Brüste und lief auf ihren Leib zeigend: »Dieser hat dich geboren, Sohn, diese dich gesäugt!« Indem sie so sprach, brachen seine Gattin, seine Kinder und die anderen Frauen in Wehklagen aus, sodass auch er ergriffen war. Jetzt hielt er nicht mehr an sich, er umarmte und küsste die Mutter, indem er sprach: »Siehe Mutter, ich gehorche dir. Du besiegst mich, dir mögen’s auch alle anderen danken. Denn nicht anschauen mag ich sie, die so viele Wohltaten mir so vergalten. Nie kehre ich in die Stadt zurück. Du aber freue dich, da du’s so willst, auch an meiner statt des Vaterlands. Ich aber gehe weit von dannen!« Damit erhob er sich; und nahm aus Furcht vor dem Volk und aus Scham vor seinen Standesgenossen, dass er gegen sie zu Felde gezogen war, die ihm angebotene Erlaubnis zur Rückkehr nicht an, sondern kehrte ins Land der Volsker zurück, wo er, sei es durch Meuchelmord, sei es am hohen Alter, starb.
44. Cassius. 269 (485 v.Chr.).
Spurius Cassius wurde, nachdem er sich um die Römer verdient gemacht hatte, von denselben zum Tode verurteilt. Wieder ein deutlicher Beweis, wie treulos die Menge ist; ihre verdientesten Freunde stürzen sie gleich den größten Verbrechern ins Verderben. Wenn sie sie ausgenutzt hat, so gelten sie ihr nicht mehr als die tödlichsten Feinde. Cassius, der es so gut mit ihnen meinte, töteten sie ob derselben Handlung, die er sich zum Ruhm anrechnete; und es ist erwiesen, dass er aus Eifersucht und keines Verbrechens wegen mit dem Tod bestraft wurde.
45. Wenn die Männer, welche den Staat verwalteten, das Volk auf keine Weise in Ordnung halten konnten, so begannen sie geflissentlich Kriege auf Kriege, damit dasselbe, mit diesen beschäftigt, keine Umtriebe wegen Ackerverteilungen machte. So wurden sie von beiden aufgereizt, dass sie den Führern den Sieg zuschworen; denn in ihrer augenblicklichen Kampfeslust glaubten sie sich Herren des Glücks.
Die meisten Menschen pflegen sich dem, der sich widersetzt, selbst wider ihren Vorteil entgegenzustellen, dem Nachgebenden aber oft über ihre Kräfte gefällig zu sein.
46. Die Fabier. 277 (477 v.Chr.)
Die Fabier, welche sich durch Geschlecht und Reichtum den Vornehmsten gleichstellen konnten, hatten nicht so bald ihren Kleinmut bemerkt […]. Oft geschieht es, dass Menschen, wenn sie in viele und schwierige Geschäfte verwickelt worden sind, gegen die Menge und das Unvorhergesehene, der Gefahren des Rates ermangelnd, an den leichtesten Dingen verzweifeln und, ohne Not Besinnung und Vertrauen verlierend, als hätten sie sich bisher vergebens angestrengt, freiwillig ihre Sache aufgeben und am Ende, den blinden Wechselfällen des Schicksals sich überlassend, erwarten, was immer das Glück ihnen bringen würde.
Die Fabier wurden, 306 an der Zahl, von den Tyrrhenern erschlagen; […] wer seiner Tapferkeit zu viel vertraut, geht oft durch eben diese Zuversicht zugrunde, und wer sich seines Glücks überhebt, kommt durch seinen Übermut zu Fall.
Die Fabier, welche sich durch Geschlecht und Reichtum den Vornehmsten gleichstellen konnten, wurden, 306 an der Zahl, von den Tyrrhenern erschlagen; und größer, als sich nach der Zahl der Gefallenen erwarten ließ, war in Rom die Trauer vonseiten der Einzelnen wie des Staates. Aber auch ihre Zahl schon war immerhin für eine Patrizierfamilie nicht unbedeutend; hinsichtlich ihres Wertes und hoher Gesinnung dagegen glaubten sie, ihre ganze Stärke verloren zu haben. Deshalb zählten sie den Tag, an welchem jene gefallen waren, zu den unglücklichen und belegten das Tor, durch welches sie ausgezogen waren, mit dem Namen Unglückstor, sodass keiner der Staatsbeamten durch dasselbe gehen durfte. Auch wurde der Feldherr Titus Menenius, unter welchem sich dieses Unglück ereignete, weil er ihnen nicht zu Hilfe gekommen war und darauf eine Schlacht verlor, vor dem Volk angeklagt und verurteilt.
47. Im Jahr der Stadt 281 (473 v.Chr.).
Die Patrizier traten öffentlich nur selten, und auch dann nur mit Verwünschungen, gegen sie auf, insgeheim aber brachten sie viele der Verwegensten ums Leben.
48. Im Jahr der Stadt 281 (473 v.Chr.).
Neun Tribune (die von den Patriziern getötet worden waren) wurden einmal vom Volk verbrannt; dies schreckte aber die anderen nicht ab; mehr Hoffnung aus ihrer Beharrlichkeit als Furcht aus dem Schicksal der Früheren schöpfend, wurden sie nicht nur nicht eingeschüchtert, sondern vielmehr in ihrem Trotz noch bestärkt; die Ermordeten betrachteten sie mehr als Vorwand ihrer Rache und stellten sich hoch erfreut, dass sie wider Erwarten noch ungefährdet am Leben waren, sodass mehrere Patrizier die Niedrigkeit des Volks bei der Aussicht auf das Tribunat höher als die Ohnmacht ihrer patrizischen Ehren erachteten, besonders da viele, obgleich es vom Gesetz verboten war, zum zweiten, dritten Mal und noch öfter ununterbrochen Tribunen wurden, und sich in bürgerliche Familien aufnehmen ließen.
49. Hierzu wurde jedoch das Volk von den Patriziern selbst angetrieben. Denn was diese zum Vorteil der eigenen Partei zu tun glaubten, dass sie immer neue Kriege veranlassten und sie durch die Gefahren nach außen bei Vernunft zu halten suchten, machte sie nur noch trotziger. Denn da sie nicht zu Felde ziehen wollten, wenn man ihren Wünschen nicht willfahrte, oder, wenn sie auch auszogen, verdrossen kämpften, so setzten sie alles durch, was sie wollten; und in der Tat fingen auch viele der Grenznachbarn, mehr auf die Uneinigkeit jener als auf die eigene Stärke vertrauend, Feindseligkeiten an.
Sowohl im Lager als auch in der Stadt gab es Unruhen, die Soldaten setzten ihren Ruhm darein, den Machthabenden nicht zu gehorchen, und gaben aus freien Stücken sowohl das eigene wie das Gemeinwohl preis; und die in der Stadt freuten sich nicht mit über den Untergang der Ihrigen durch die Feinde, sondern richteten selbst viele der Tatkräftigeren, welche die Sache des Volkes begünstigten, zugrunde, woraus sich ein nicht unbedeutender Aufstand unter ihnen entwickelte.
50. Übermut der Aequer. 296 (458 v.Chr.).
Nach der Einnahme Tusculums und dem Sieg über Marcus Minucius wurden die Aequer so übermütig, dass sie den Gesandten, welche die Römer an sie abgeordnet hatten, um sie über die Besitznahme der Stadt zur Rede zu stellen, auf ihre Beschwerde keine Antwort gaben, sondern durch ihren Feldherrn Coelius Gracchus eine Eiche zeigen ließen: Dieser sollten sie sagen, was sie wollten.
51. Cincinnatus. 361 (393 v.Chr.).
Als die Nachricht nach Rom kam, dass Minucius mit einem Teil des Heeres in einem hohlen, mit Buschwerk bewachsenen Platz eingeschlossen sei, wählte man zum Diktator wider sie (die Aequer) den Lucius Quintius, einen unbemittelten Mann, der mit eigener Hand sein einziges Landgütchen bebaute. Denn er war überhaupt an Verdienst Roms ersten Männern gleich und übertraf alle an Mäßigkeit. Sein Haar, das er in Locken wachsen ließ, gab ihm den Beinamen Cincinnatus (dt.: der Gelockte).
52. Die Eroberung von Falerii. 361 (393 v.Chr.).
Die Römer belagerten die Stadt der Falisker, und sie hätten noch lange Zeit vor ihr liegen müssen, wenn nicht folgender Vorfall sich ereignet hätte. Ein Schulmeister, welcher daselbst viele vornehme Kinder unterrichtete, führte sie alle, sei es aus Ärger oder aus Gewinnsucht, unter irgendeinem Vorwand aus der Stadt (denn man hatte noch so wenig zu fürchten, dass man wie zuvor die Kinder die Schule besuchen ließ) und brachte sie zu Camillus, mit den Worten, er übergebe ihm mit ihnen die ganze Stadt, denn die Belagerten würden nicht länger widerstehen, wenn sie ihr Teuerstes in Feindes Händen wüssten.
Er richtete jedoch nichts aus. Denn Camillus hielt es, der römischen Tugend und der Wechselhaftigkeit menschlicher Schicksale eingedenk, für unwürdig, die Stadt durch Verrat in seine Gewalt zu bekommen. Er ließ vielmehr dem Verräter die Hände auf den Rücken binden und ihn so durch die Knaben selbst in die Stadt zurücktreiben. Auf diesen Vorfall leisteten die Falisker nicht mehr Widerstand, obgleich ihre Stadt schwer zu erobern war und sie Mittel im Überfluss hatten, den Krieg noch weiter zu führen, sondern ergaben sich freiwillig, indem sie in ihm einen trefflichen Freund erwarteten, den sie als Feind so gerecht befunden hatten. Camillus aber wurde darob von seinen Mitbürgern nur noch mehr gehasst und von den Volkstribunen angeklagt, dass er von der Vejenterbeute nichts in den Staatsschatz gelegt habe. Er ging noch vor dem Urteilsspruch in die Verbannung.
53. Im Jahr der Stadt 361 (393 v.Chr.).
Die Römer begannen, nachdem sie in vielen Schlachten gegen die Falisker teils gesiegt hatten, teils besiegt worden waren, die hergebrachten gottesdienstlichen Gebräuche zu vernachlässigen und bei Fremden ihr Heil zu suchen. Denn die Menschen lieben es, in Unglücksfällen das Gewohnte, wenn auch göttlichen Ursprungs, zu missachten und das Unbekannte zu bewundern. Von jenem erwarten sie für den Augenblick keine Hilfe und versprechen sich auch für die Zukunft nichts Gutes; vom Fremden aber, als von etwas Neuem, hoffen sie alles, was sie sich nur wünschen. Ihre Eifersucht und Zwietracht erreichte einen solchen Grad, dass sie nicht mehr zusammen, wie früher, sondern einzeln der Reihe nach herrschten; woraus nichts Gutes entspross. Da jeder nur auf den eigenen, nicht auf den Vorteil des Ganzen sah und lieber das Ganze in Schaden als den Amtsgenossen zu Ehren kommen ließ, geschah viel Ungebührliches.
54. Die Volksherrschaft besteht nicht darin, dass alle ohne Unterschied das Gleiche haben, sondern dass jeder das seinem Verdienst Gemäße erhalte.
55. Im Jahr der Stadt 364 (390 v.Chr.).
Denn nicht allein das Volk und diejenigen, die nach seinem Ansehen trachteten, sondern selbst seine Freunde und Verwandten beneideten ihn ganz unverhohlen. Als er sie bat, ihn zu verteidigen und durch ihre Stimme zu unterstützen, versprachen sie ihm nichts weiter, als, wenn er verurteilt würde, die Geldstrafe für ihn zusammenzulegen. Deshalb betete er zu den Göttern, dass die Stadt seinen Verlust empfinden möge, und noch vor Fällung seines Urteils ging er zu den Rutulern in die Verbannung.
55. Der Feldzug der Gallier hatte folgende Veranlassung: Die Clusiner, von ihnen im Krieg bedrängt, nahmen ihre Zuflucht zu den Römern, indem sie begründete Hoffnung hegten, weil sie den Vejentern, obgleich Stammesgenossen, nicht beigestanden hatten, jetzt von ihnen unterstützt zu werden. Die Römer bewilligten ihnen zwar keinen Beistand, schickten aber Gesandte an die Gallier, unterhandelten für sie einen Frieden und hätten ihn beinahe zustande gebracht. Denn er wurde ihnen gegen einen Teil des Landes angeboten.
Sie kamen aber mit den Barbaren von Worten zu Tätlichkeiten und nahmen die Gesandten der Römer zu Hilfe. Die Gallier waren aufgebracht, dass sie sich ihnen im Kampf gegenüberstellten, und schickten zuerst Gesandte nach Rom, um sich über sie zu beschweren. Als jene aber nicht nur nicht bestraft, sondern alle zu Kriegstribunen erwählt wurden, gerieten sie in Zorn, wozu sie ohnedies sehr geneigt sind, und eilten, ohne sich weiter an die Clusiner zu kehren, gegen Rom.
56. Die Römer, welche den anrückenden Galliern entgegenzogen, konnten nicht zu Atem kommen, sondern mussten an demselben Tag vom Marsch weg in die Schlacht ausrücken und wurden besiegt. Denn erschreckt über ihren plötzlichen Einfall, ihre Menge, Körpergröße und die fremd und furchtbar klingenden Stimmen, vergaßen sie Kriegskunst und Zucht, und entäußerten sich so ihrer Tapferkeit; denn zum Mut trägt sehr viel die Kenntnis bei, und steht einem die zur Seite, so stärkt sie auch die Kraft, schwindet aber diese, so löst sie auch jenen auf, und das weit mehr, als wenn sie jenem gleich anfangs abgegangen wäre; denn der ungestüme Mut siegt oft ohne Erfahrung durch rohe Gewalt; wer aber aus der gewohnten Zucht und Ordnung fällt, verliert auch die Kraft der Besinnung. Dies brachte die Römer zu Fall.
57. Die Römer, auf dem Capitol belagert, hatten außer der Hilfe der Götter keine Hoffnung auf Rettung mehr. In deren Dienst waren sie in all ihrer Bedrängnis so gewissenhaft, dass bei einem Opfer, das die Oberpriester an einem anderen Ort der Stadt zu verrichten hatten, Kaeso Fabius, den die Reihe des Dienstes traf, im Priestergewand, wie sonst, vom Capitol stieg, mitten durch die Feinde schritt und nach Vollendung des Opfers noch an demselben Tag zurückkehrte.
Wundern muss ich mich zwar über die Barbaren, dass sie ihn – sei es aus Scheu vor den Göttern oder aus Achtung vor seinem Pflichtgefühl – schonten; weit mehr aber bewundere ich jenen, teils weil er sich allein zu den Feinden hinabwagte, teils weil er sich nicht, wie er doch konnte, anderswohin in Sicherheit begab, sondern freiwillig unter augenscheinlicher Gefahr auf das Capitol zurückkehrte. Er wusste freilich, dass sie den einzigen Platz, der ihnen noch von ihrer Vaterstadt übrig geblieben war, nicht so leicht verlassen würden, sah aber auch ein, dass sie, wenn sie es auch noch so sehr wünschten, wegen der Menge der Belagerer nicht durchkommen konnten.
58. Camillus schlug den ihm angetragenen Oberbefehl aus, weil er ihn als Verbannter gemäß den Landesgesetzen nicht annehmen dürfte. So streng und gewissenhaft beobachtete dieser Mann die Gesetze, dass er selbst bei so drohender Gefahr für das Vaterland seinen Pflichten getreu blieb und es für unrecht hielt, den Nachkommen ein Beispiel von Gesetzwidrigkeit zu hinterlassen.
59. Als die Stadt von den Galliern eingenommen war und die Römer sich auf das Capitol geflüchtet hatten, kündigte ihnen der verbannte Camillus an, dass er die Gallier angreifen werde. Als der Überbringer des Briefes in die Burg gelangte, gewahrten die Barbaren die Fußtritte desselben; und beinahe hätten sie sich auch dieses letzten Zufluchtsorts bemächtigt, wenn nicht die heiligen Gänse, welche dort gehalten wurden, die Nähe der Feinde verkündet, die Römer geweckt und zu den Waffen gerufen hätten.
Die Gallier waren erstaunt, dass die Römer solchen Brotüberschuss hätten und aus Üppigkeit die Brote herabwürfen, und verstanden sich zu einem Vertrag.
Ein Spruch der Sibylle prophezeite, dass das Capitol bis aus Ende der Welt das Haupt des Erdkreises bleiben werde.
60. Im Jahr der Stadt 365 (389 v.Chr.).
Februarius hatte, aus Neid gegen Camillus diesen beabsichtigter Alleinherrschaft angeklagt; als derselbe verbannt und wieder zurückberufen worden war, weil er, der Verbannte, seiner vom Feind belagerten Vaterstadt zu Hilfe kam, wurde Februarius vor Gericht gefordert und verurteilt. Camillus verkürzte sogar den ihm gleichnamigen Monat gegen die übrigen.
61. Nachdem Camillus seinen Triumph über die Tyrrhener gehalten hatte, suchte Konsul Februarius, seinem Geschlecht nach ein Gallier, aus Eifersucht gegen ihn auf der Rednerbühne zu behaupten, nicht dem Camillus, sondern dem Glück der Römer verdanke man den Sieg; auch brachte er Briefe und falsche Zeugnisse vor, dass jener nach der Alleinherrschaft strebe. Hierdurch hatte er das Volk wider jenen aufgebracht und seine Verbannung aus der Stadt bewirkt. Als Camillus nach der Einnahme Roms zurückgekehrt und die Feinde unter Brennus vernichtet hatte, brachte er die Sache vor Gericht und zeigte, dass an allem, was geschehen, Februarius schuldig sei; worauf er von den Dienern des Volkstribuns, vernaculi genannt, entkleidet und mit einer Binsendecke umgeben, unter Streichen mit Bogensehnen aus der Stadt getrieben wurde. Auch verkürzte er den ihm gleichnamigen Monat gegen die übrigen.
62. Marcus Manlius Capitolinus. 371 (383 v.Chr.)
Capitolinus verdammte das Volk zum Tode. Sein Haus wurde niedergerissen, sein Vermögen eingezogen, sein Name und sein Bild, wo es zu finden war, ausgelöscht und vertilgt. Auch jetzt noch geschieht alles dies, das Niederreißen des Hauses ausgenommen, bei Hochverrätern. Auch verordnete das Volk, dass kein Patrizier auf der Burg wohnen sollte, weil jener daselbst gewohnt hatte. Das Geschlecht der Manlier machte es zum Hausgesetz, dass keiner von ihnen den Vornamen Marcus, weil jener in gehabt hatte, in Zukunft führen sollte.
Ein solcher Wechsel trat bei Capitolinus in seinem Betragen wie in seinem Glück ein. Im Krieg ausgezeichnet, wusste er im Frieden sich nicht zu benehmen; das Capitol, das er gerettet hatte, wählte er zum Sitz der Alleinherrschaft. Er, der Patrizier, fiel durch Henkershand, als anerkannter Kriegsheld wurde er wie ein Sklave gebunden und von demselben Felsen, von dem er die Gallier abgewehrt hatte, hinabgestürzt.
63. Capitolinus wurde von den Römern vom Felsen gestürzt. So hat denn nichts in der Welt Bestand; das Glück führt viele zu ebenso großem Unglück; nachdem es sie zum Gegenstand der Hoffnungen ihrer Mitbürger erhoben und in ihnen Wünsche nach Höherem erweckt hat, stürzt es die Getäuschten ins äußerste Verderben.
64. Die List der Tusculaner. 374 (380 v.Chr.)
Camillus zog gegen die Tusculaner zu Felde, mit einer bewunderungswürdigen List aber entzogen sie sich aller Gefahr. Als hätten sie nichts verbrochen und die Römer keinen Unwillen gegen sie, als kämen diese als Freunde zu Freunden oder zögen durch ihr Gebiet gegen andere, veränderten sie nichts in ihrer Lebensweise und ließen sich nicht in ihrer Ruhe stören, sondern blieben alle bei ihren gewöhnlichen Geschäften und Tagewerken wie im Frieden an Ort und Stelle, nahmen das Heer in ihre Stadt auf, gaben ihm gastliche Zehrung und taten ihm auch im Übrigen alle Ehre als Freunde an. Die Römer taten ihnen daher auch nicht nur nichts zuleide, sondern erteilten ihnen später sogar das Bürgerrecht.
65. Im Jahr der Stadt 386 (368 v.Chr.)
Die Gattin des Rufus,10 deren Schwager, zu jener Zeit Tribun, nach einem Geschäft auf dem Markt zurückkehrte, erschrak, als der Liktor, einer herkömmlichen Sitte gemäß, an die Tür schlug, da ihr früher nichts dieser Art vorgekommen war, und fuhr zusammen. Als sie nun von ihrer Schwester und den anderen ausgelacht und verspottet wurde, dass sie sich mit den Sitten bei den Staatsämtern nicht auskenne, weil ihr Mann noch keine der oberen Ehrenstellen bekleidet hatte; grämte sie sich darüber, wie bei dem durch Kleinigkeiten reizbaren Frauenvolk zu geschehen pflegt, und ruhte nicht eher mit ihren Umtrieben, bis sie die ganze Stadt in Aufruhr gebracht hatte. So führen oft kleine und geringe Anlässe viele und große Übel herbei, wenn dabei Neid und Eifersucht ins Spiel kommen.
66. Im Unglück beredet oft die Hoffnung auf Rettung, selbst Ungereimtheiten zu glauben.
Mehr und mehr lösten sie durch ihre fortwährenden Aufstände die Zucht des Staates, sodass sie alles, worüber sich früher die heftigsten Kämpfe erhoben, mit der Zeit zwar nicht ohne Widerstand, aber doch ohne viel Schwierigkeit durchsetzten. Dion bemerkt: »Deshalb erwähnte ich ihn, obgleich ich sonst keine Abschweifungen liebe, und schrieb die Olympiade dazu, damit die den meisten unbekannte Zeit der Wanderung daraus deutlicher hervorgehe.
67. Im Jahr der Stadt 378 (376 v.Chr.)
Publius [Manlius] hätte den Parteikampf der Römer beinahe beschwichtigt. Denn er wählte [als Diktator] den Licinius Stolo, einen Plebejer, zu seinem Reiterobersten. Diese Neuerung verdross zwar die Patrizier, gewann aber die anderen in dem Maße, dass sie für das folgende Jahr nicht auf dem Konsulat bestanden, sondern Kriegstribunen wählen ließen. Da sie hierauf auch in anderen Stücken einander nachgaben, so hätten sie sich vielleicht gänzlich ausgesöhnt, wenn sie nicht der Volkstribun Stolo durch das Sprichwort, wer nicht äße, der sollte auch nicht trinken, beredet hätte, von nichts abzustehen, sondern alle ihre Forderungen als unerlässlich durchzusetzen.