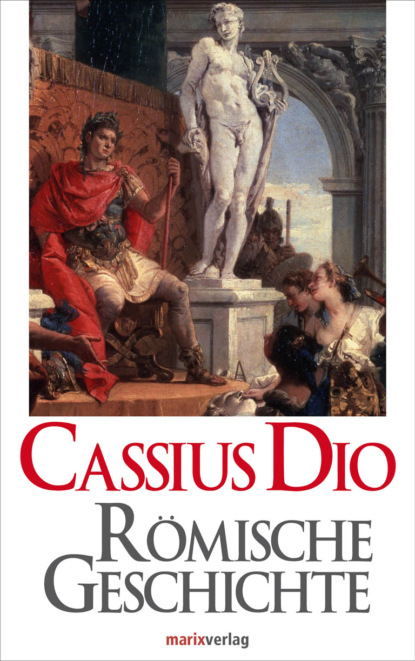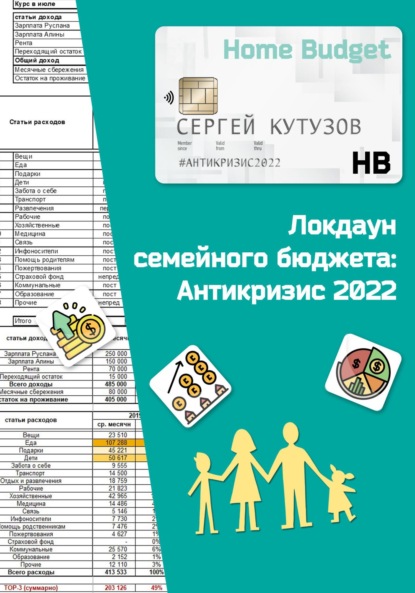- -
- 100%
- +
68. Marcus Curtius. 393 (361 v.Chr.)
Als sich durch ein Erdbeben in Rom auf dem Markt ein Schlund öffnete, sollte sich nach einem Sibyllinischen Spruch der Schlund schließen, wenn das Kostbarste auf Erden in denselben hineingeworfen würde. Da nun viele, die einen diese, die anderen jene Kostbarkeiten hinabwarfen und der Schlund sich immer noch nicht schloss, so erklärte Curtius, an Leib und Geist der trefflichste Mann, dass er den Sibyllenspruch besser als die anderen verstünde, denn der kostbarste Schatz für die Stadt sei des Mannes Tapferkeit; damit legte er sich die Waffen an, bestieg sein Schlachtross und sprengte mit unverwandtem Gesicht in den Abgrund hinab; da schloss sich die Erde; er aber wird als Heros verehrt.
Im Konsulat des Quintus Servilius öffnete sich mitten auf dem Markt ein Erdschlund. Als die Römer aus den Sprüchen der Sibylle ersahen, dass die Erde sich schließen werde, wenn das Kostbarste auf Erden in den Schlund geworfen würde, so brachten die einen Gold, die anderen Silber, andere Früchte, wieder andere anderes, als das Kostbarste herbei und glaubten so dem heiligen Spruch zu genügen; da aber nichtsdestoweniger der Schlund geöffnet blieb, so erklärte Curtius, der schönste und trefflichste Mann, dass er den Sibyllenspruch besser als die anderen verstünde. Denn der kostbarste Schatz für die Stadt sei des Mannes Tapferkeit, und diese fordere der Orakelspruch. Mit diesen Worten legte er sich die Waffen an und bestieg sein Schlachtross, und während alle staunten, sprengte er unverwandt in den Abgrund hinab. Als die Erde sich schloss, verordneten die Römer, den Mann mitten auf dem Markt jedes Jahr als Heros zu verehren, nannten den Ort Libernus, und errichteten einen Altar, womit auch Vergil einen Gesang beginnt.11
[Kein sterbliches Geschöpf ist besser oder stärker als der Mensch. Oder seht ihr nicht, dass alle anderen sich niederbeugen und immer erdwärts schauen und nichts tun als das, was sich auf Nahrung und Befriedigung des Geschlechtstriebs bezieht; und dazu sind sie auch von der Natur selbst verdammt; wir allein schauen aufwärts und haben Verkehr mit dem Himmel selbst, verachten, was auf der Erde ist, und gehen mit den Göttern selbst wie mit unsersgleichen um; indem wir nicht deren irdische, sondern himmlische Sprösslinge und Geschöpfe sind; weshalb wir sie auch nach unserem Ebenbild malen und gestalten; darf ich mich der Rede vermessen, so ist der Mensch nichts anderes als ein Gott mit sterblichem Körper noch Gott etwas anderes als ein körperloser Mensch und deshalb unsterblich. Dies auch gibt uns den Vorzug vor all den anderen Geschöpfen; kein Geschöpf auf dem Land gibt es, das wir nicht durch Schnelligkeit einholen, durch Stärke bändigen oder auch durch Kunstgriffe fangen und uns dienstbar machen, keines im Wasser, keines in der Luft; jene ziehen wir aus Abgründen, wohin unser Auge nicht reicht, herauf, diese aus den Lüften herab, wohin wir selbst nicht gelangen.]
[Marcus Curtius aber, ein Patrizier, der schönste, stärkste, tapferste, verständigste junge Mann, erkannte den Sinn des Orakelspruchs und sprach unter das Volk tretend folgendermaßen: »Was klagen wir, Männer Roms, die Göttersprüche der Dunkelheit oder uns der Dummheit an? Wir sind das, was gefordert und worüber gezweifelt wird; nicht wird man das Leblose höher als das Belebte, das Geist-, Vernunft- und Sprachlose höher als das mit Geist, Vernunft und Sprache Begabte achten; wem sollten wir vor dem Menschen den Vorzug geben, um durch dessen Opfer den Erdschlund zu schließen? Darf ich mich der Rede vermessen, so ist der Mensch nichts anderes als ein Gott mit sterblichem Körper noch Gott etwas anderes als ein körperloser Mensch und daher unsterblich; und nicht allzu fernstehen wir der Götter Macht. Davon bin ich überzeugt und wünschte auch euch davon zu überzeugen; glaubt nicht, dass ich zum Los, zum Opfertod eines Mädchens, eines Knaben rate; ich selbst weihe mich für euch, dass ihr mich heute, in diesem Augenblick, als Herold und Machtboten den unterirdischen Göttern sendet, auf dass ich hinfort euer Fürsprecher und Mitkämpfer werde.« Als Curtius dies gesprochen usw.]
69. Manlius Torquatus. 394 (360 v.Chr.).
Manlius erlegte in einem Zweikampf den König der Kelten, zog ihm die Rüstung aus, nahm ihm die Halskette, den gewöhnlichen Schmuck der Kelten, ab und legte sie sich an, weshalb er von seinen Mitbürgern Torquatus, d.h. der Halskettenträger, genannt wurde und diesen Beinamen, als Denkmal seiner Waffentat, seinen Nachkommen hinterließ.
[Als die Lager einander gegenüberstanden, nahm es Manlius, ein ausgezeichneter Römer aus dem Senatorenstand mit dem König der Kelten auf, welcher prahlerisch hervortretend den tapfersten Römer zum Zweikampf aufgefordert hatte, und streckte ihn tödlich verwundet zu Boden. Er zog ihm die Rüstung aus, nahm ihm die Halskette, den gewöhnlichen Schmuck der Kelten, ab und legte sie sich an, weshalb er von seinen Mitbürgern Torquatus, d.h. der Halskettenträger, genannt wurde und als Denkmal seiner Waffentat diesen Beinamen seinen Nachkommen hinterließ.]
70. Im Jahr der Stadt 401 (353 v.Chr.).
Auf die Nachricht, dass die Römer einen Zug gegen sie vorhätten, schickten die Einwohner von Caere, ehe noch ein Beschluss gefasst war, Gesandte nach Rom, und sie erhielten gegen Abtretung der Hälfte ihres Gebietes Frieden.
71. Im Jahr der Stadt 405 (349 v.Chr.)
Als sich Valerius zum Zweikampf mit einem Aufrührer der Kelten anschickte, setzte sich diesem ein Rabe auf den rechten Arm, mit dem Schnabel dem Kelten zugekehrt, und mit den Krallen das Gesicht ihm zerkratzend und seine Augen mit den Flügeln bedeckend, gab er ihn, der sich nicht vorsehen konnte, in die Gewalt des Valerius; woher dieser den Beinamen Corvinus erhielt, denn corvus heißt Rabe.
[Bald zerkratzte er die Wangen mit den Krallen, bald hackte er mit dem Schnabel nach den Augen; als er aber aus der Mitte seiner Leute vortrat, setzte sich ein Rabe auf des Mannes rechten Arm, und während des Kampfes mit dem Schnabel wider den Kelten gekehrt, auf ihn losfliegend, mit den Krallen das Gesicht ihm zerkratzend und seine Augen mit den Flügeln bedeckend, gab er ihn, der sich nicht vorsehen konnte, in die Gewalt des Valerius, indem er ihm mit dem Sieg zugleich den Beinamen schenkte, denn er wurde von da an Corvinus genannt.]
72. Im Jahr der Stadt 415 (339 v.Chr.).
Dieses und anderes der Art schützten sie auf solche Weise vor, nicht weil sie hofften, etwas davon durchzusetzen, denn sie kannten vor allem den stolzen Sinn der Römer; sondern um durch Verweigerung ihrer Bitte als Beleidigte einen Vorwand zu Beschwerden zu haben. Denn es war offensichtlich, dass sie nur den Ausgang erwarteten, um sich dem Sieger anzuschließen. Torquatus kümmerte sich nicht um sie, damit sie nicht anlässlich des Krieges gegen die Latiner Feindseligkeiten anfangen möchten; er war nämlich nicht in allen Dingen so rau noch verfuhr er überall so streng, wie gegen seinen Sohn.
Torquatus war nicht in allen Dingen so rau, noch verfuhr er überall so streng, wie gegen seinen Sohn, sondern war nach dem Urteil aller ein guter Ratgeber und geschickter Soldat. Daher erkannten sowohl seine Mitbürger als auch seine Feinde an, dass die Entscheidung des Krieges in seinen Händen lag und er, an der Spitze der Latiner stehend, unfehlbar den Sieg auf ihre Seite gewendet hatte.
73. Im Jahr der Stadt 415 (339 v.Chr.).
Konsul Manlius bekränzte seinen Sohn, weil er den Latiner Pontius in einem Zweikampf erlegt hatte, als Sieger, ließ ihn aber, weil er seine Befehle überschritten hatte, unter dem Beile bluten. Diese grässliche Tat machte die Römer äußerst folgsam gegen ihre Oberen.
74. Im Jahr der Stadt 415 (339 v.Chr.).
Als die Römer gegen die Latiner im Felde standen und der Wahrsager den Römern den Sieg verhieß, wenn einer der Konsuln sich den Göttern der Unterwelt weihen würde, legte der Konsul Decius [Mus] sein Kriegskleid ab, zog das heilige Gewand an und stürzte sich ins dichteste Gedränge der Feinde. Von allen Seiten von Geschossen getroffen starb er, die Schlacht aber entschied sich für die Römer.
75. Dio sagt: Wir finden es höchst wundersam: Wenn nämlich wirklich der Tod des einzigen Decius die Schlacht wiederherstellte, die Sieger besiegte, den Besiegten den Sieg gab, so sehe ich nicht, wie das alles zuging. Wenn ich die Taten gewisser Männer lese und weiß, dass viele dergleichen Angaben zusammentrugen, so kann ich denselben den Glauben nicht versagen; wenn ich dagegen die Ursachen der Ereignisse erwäge, so ist mir das Ganze unbegreiflich. Denn wie will einer glauben, dass eine solche Selbstaufopferung eines einzigen Mannes einer solchen Menge Menschen Heil und Sieg bringen würde? Wie und durch welche Mittel dies geschieht, mögen andere untersuchen.
76. Obgleich die Römer dem [Manlius] Torquatus seines Sohnes wegen so sehr gram waren, dass sie die gräulichsten Taten davon manlianische nannten und ihm nicht verziehen, dass er, obwohl sein Sohn und sein Mitkonsul tot waren, einen Triumph feierte; so erwählten sie ihn doch, als ein anderer Krieg sie drängte, zum vierten Mal zum Konsul; er aber schlug das Konsulat aus und verschwor sich mit den Worten: »Ich könnte euch, und ihr könntet mich nicht ertragen.
77. Im Jahr der Stadt 416 (338 v.Chr.).
Die Römer söhnten sich wieder mit den Latinern aus und schenkten denselben das Bürgerrecht, sodass sie die gleichen Rechte mit ihnen teilten. Sie gestanden, was sie den mit Krieg Drohenden verweigert hatten und um dessen willen sie so viele Gefahren bestanden hatten, den Besiegten aus freien Stücken zu, indem sie den einen dafür, dass sie im Krieg beigestanden, den anderen, dass sie während desselben ruhig geblieben waren, vergalten.
78. Im Jahr der Stadt 426 (328 v.Chr.).
Die Römer beschlossen, die Privernaten zu fragen, welche Strafe sie nach solchem Unterfangen verdienten. Sie antworteten kühn: »Die Strafe freier Männer, welche die Freiheit lieben.« Als der Konsul wieder fragte: »Was werdet ihr tun, wenn ihr den Frieden erhaltet?«, so erwiderten sie: »Erhalten wir ihn unter billigen Bedingungen, so werden wir ruhig bleiben, wenn man uns aber Unerträgliches befiehlt, werden wir wieder Krieg beginnen.« Sie bewunderten ihre Freisinnigkeit und machten ihnen nicht nur bessere Friedensbedingungen, als den anderen […]12
79. Im Jahr der Stadt 430 (324 v.Chr.) Rede von Rullus’ Vater vor dem Volk.13
»Bedenkt, dass Todesstrafen, an solchen Männern vollzogen, die Schuldigen verderben, die noch gebessert werden könnten, die anderen aber um nichts besonnener machen. Die menschliche Natur will nicht, dass man bei Drohungen ihr Gesetz überschreitet. Durch den Zwang der Furcht, den Übermut der Kühnheit, die Unbesonnenheit der Unerfahrenheit und das Ungestüm des Kraftgefühls oder durch andere Reizmittel, wie sie einen so oft wider Vermuten anwandeln, führte sie, die einen nicht einmal der Strafen gedenkend, sondern ohne Rücksicht auf sich selbst dem vorgesteckten Ziel zueilend, die anderen die Erreichung des Gegenstands ihrer Wünsche höher als sich selbst erachtend, zum Fehltritt; die bedachtsame Menschlichkeit bewirkt von allem das Gegenteil; denn Verzeihung am rechten Ort hat schon manchen umgewandelt, besonders wenn einer aus einem Überdrang von Mut, nicht aus Bösartigkeit, aus Ehrgeiz, nicht aus Schlechtigkeit gefehlt hat; vernünftige Schonung zähmt und mäßigt edlen Übermut und stimmt auch die anderen, wenn sie ihn gerettet sehen, unwillkürlich zum Gehorsam um; denn jeder gehorcht lieber, als er sich zwingen lässt, und hört lieber freiwillig auf das Gesetz, als durch Gewalt genötigt; der freie Wille erscheint als Selbstbestimmung, was befohlen wird, das wird als etwas Unfreies abgewiesen. Die höchste Tugend und Macht besteht nicht im Töten, was auch der Schlechteste und der Schwächste kann, sondern im Schonen und Retten anderer, was keiner unter uns wider seinen Willen kann. Ich wünschte ein Ende meiner Klagen; mein Geist ist erschöpft, meine Stimme versagt und wird durch Tränen gehemmt, die Angst schließt mir den Mund; und doch weiß ich nicht, wie ich schließen soll. Mein Unglück scheint mir, änderst du nicht deinen Sinn, noch lange nicht vollständig geschildert, es erlaubt mir nicht zu schweigen; da, was immer ich zuletzt für die Rettung meines Sohnes spreche, mich wie im Gebet zu Weiterem drängt.«
80. Denn er, der Diktator (Papirius) fand es noch bedenklich, von der Hoheit der Gewalt, die er bekleidete, etwas zu vergeben; und als er ihm schon, auf Rullus’ Rede, und weil er die ihm günstige Stimmung des Volkes sah, das Leben schenken wollte, hielt er noch an sich, jenem zu willfahren, und nahm sich, nachdem er ihm bereits verziehen hatte, noch Zeit zur Abwägung, dann wandte er sein Gesicht um, erhob, mit einem scharfen Blick auf das Volk, seine Stimme und sprach: […].«14 Tiefes Stillschweigen erfolgte; allein die Menge blieb, wie es in solchen Fällen zu geschehen pflegt, nicht ruhig, sondern seufzte ihm zu und murmelte unter sich. Zwar hörte man niemanden sprechen, es war aber klar, dass sie die Rettung des Reiterobristen wünschte. Als dies Papirius gewahrte und einen Aufstand befürchten musste, ließ er von der Strenge seines Amtes, die er, zu ihrer Besserung, länger als er sollte, behaupten zu wollen sich stellte, ab und gewann durch größere Milde die Liebe und Ergebenheit (der Soldaten); sodass sie sich im Kampf mit den Feinden wacker hielten.
81. Im Jahr der Stadt 432 (322 v.Chr.)
Von den Römern besiegt, schickten die Samniten Gesandte nach Rom und gaben ihnen alle Gefangenen, welche sie hatten, zurück, auch plünderten sie das Eigentum des Papirius, eines ihrer angesehensten Männer, auf den sie die ganze Schuld des Krieges schoben, und zerstreuten die Gebeine desselben, weil er sich vorher entleibt hatte.
Sie erhielten aber den Frieden nicht. Weil man ihnen nicht trauen zu dürfen glaubte und sie immer nur aus Not, um ihren jeweiligen Besieger zu täuschen, Friedensanträge zu machen schienen, bekamen sie nicht nur keine friedliche Antwort, sondern mussten sich auch auf einen unversöhnlichen Krieg gefasst machen. Denn die Römer beschlossen, obgleich sie die Gefangenen behielten, einen unversöhnlichen Krieg gegen sie zu führen.
82. Im Jahr der Stadt 433 (321 v.Chr.).
Unter den vielen wunderbaren Wechselfällen des menschlichen Lebens zeichnet sich nicht wenig auch derjenige aus, der sich damals ereignete: Die Römer, welche in ihrem Übermut beschlossen hatten, von den Samniten keinen Friedensherold mehr anzunehmen, und gehofft hatten, sie allesamt in einer Schlacht in den Untergang zu treiben, kamen in große Gefahr und erlitten einen Schimpf, den sie noch niemals erlebt hatten. Jene, welche über die Nichterlangung des Friedens in größter Furcht geschwebt hatten, bekamen das ganze Heer in ihre Gewalt und schickten es durch das Joch. So sehr hatte sich ihr Glück gewendet.
83. Die Feindschaften werden durch Wohltaten aufgehoben; und je größere Feindschaft einer hegt, desto eher macht er sich, wenn er nun wider Erwarten Rettung statt Rache findet, frei von dieser und gibt sich von jener besiegt. Wie der Hass derer, die sich entzweien und von Freundschaft zur Feindschaft übergehen, größer ist, so lieben diejenigen, welche nach einem Zerwürfnis Gutes erfahren, die Täter mehr, als die, welche jederzeit Wohltaten genossen. Die Römer zumal wollen im Krieg die Ersten sein, schätzen aber auch die Tugend und buhlen um den Preis der Ehre, indem sie Gleiches mit Gleichem im Übermaß zu vergelten trachten.
Die Wohltaten sind ein Ergebnis freier Entschließung bei den Menschen, nicht der Unwillkürlichkeit, der Übereilung, der Hinterlist oder eines sonstigen Beweggrundes, durch freie Wahl werden sie mit willigem, geneigtem Sinn vollbracht! Und deshalb muss man diejenigen, die sich etwas zuschulden kommen ließen, bemitleiden, ermahnen, zurechtweisen, lieben, denselben mit Gutem vergelten; und wenn auch von den Menschen beides geschah, so ziemt es unseren Sitten weit mehr, des Guten als des Unrechten zu gedenken.
Großes darf man sich darauf einbilden, wenn man dem Beleidiger vergilt, noch mehr aber, wenn man sich dem Wohltäter erkenntlich zeigt. – Die Menschen schmerzt durchaus mehr die angetane Schmach, als die Wohltat sie erfreut; sie verfolgen mehr diejenigen, welche ihnen etwas zuleide taten, als sie dem Wohltäter vergelten; indem sie die Schande der Undankbarkeit gegen ihren Retter für nichts achten, wenn es ihren Vorteil gilt, und selbst wenn es gegen ihren Nutzen ist, ihre Leidenschaft gewähren lassen. – Aus solchen Gründen ermahnte er sie, nach seiner Weisheit und der dem Alter eigenen Erfahrung, nicht die augenblickliche Lust, sondern das künftige Leid vor Augen zu haben.
84. Die Capuaner kränkten die besiegten Römer, als sie nach Capua kamen, weder durch Worte, noch durch die Tat, gaben ihnen vielmehr Nahrung und Pferde, und nahmen sie wie Sieger auf. Sie, welchen sie wegen des durch sie Erlittenen den Sieg nicht wünschten, bemitleideten sie in dem jetzigen Unglück. Die Römer waren auf die Kunde von diesem Unglück in großer Not, und sie wussten nicht, ob sie sich über die Rettung der Soldaten freuen oder ärgern sollten! Sie verwünschten die unwürdige, unerhörte Beschimpfung, zumal durch die Samniten, und hätten lieber die Ihrigen alle verloren gegeben; wenn sie aber bedachten, dass in diesem Fall auch alle Übrigen gefährdet gewesen wären, so kam ihnen doch ihre Rettung nicht unerwünscht.
Alle Menschen müssen, ohne dass man es ihnen verargen dürfte, auf ihre Rettung bedacht sein, und, wenn sie in Gefahr sind, kein Rettungsmittel unversucht lassen.
Bei Göttern und Menschen findet Verzeihung, wer wider seinen Willen etwas tut.
Die Samniten schlossen die Römer in Engpässe ein und nötigten sie zu schimpflichen Verträgen, indem sie dieselben unbewaffnet einzeln durch das Joch ziehen ließen. Die Stadt aber erklärte den Vertrag für nichtig und lieferte die Konsuln, die diesen Vertrag geschlossen hatten, den Feinden aus, indem sie auf sie die Sühne des gebrochenen Vertrages abwälzte.
Als die Samniten sahen, dass man weder den Vertrag hielt noch sonst erkenntlich war, vielmehr statt der vielen wenige unter Umgehung der eidlichen Verpflichtungen auslieferte, wurden sie äußerst aufgebracht und riefen, die Rache der Götter erflehend, einige namentlich auf, forderten, an ihre Eidschwüre mahnend, die Kriegsgefangenen zurück und hießen sie nackt zu demselben Joch zurückkehren, von dem sie sie aus Mitleid entlassen hatten, damit sie die Heilighaltung ihrer Eide durch die Tat bewiesen; die Ausgelieferten aber schickten sie zurück, sei es, weil sie diejenigen, die nichts verbrochen hatten, nicht verderben oder dem Volk den Eidbruch zuschieben und durch die Bestrafung einzelner Männer die anderen nicht für entbunden erklären wollten; dies taten sie, indem sie auf eine billige Genugtuung hofften.
85. Im Jahr der Stadt 434 (320 v.Chr.).
Die Römer wussten den Samniten für die Schonung der Ausgelieferten nicht nur keinen Dank, sondern begannen, als hätten sie dadurch eine neue Unbill erlitten, voll Erbitterung den Krieg, besiegten sie und taten ihnen dieselbe Strafe an; denn die Waffen sprechen gewöhnlich anderes Recht als die Gesetze; der Sieg ist nicht immer aufseiten der Beleidigten; der Krieg verfügt eigenmächtig alles zum Vorteil des Siegers und verkehrt oft die Satzung des Rechts in das Gegenteil.
Die Römer besiegten die Samniten und schickten auch ihrerseits die Kriegsgefangenen unter das Joch, indem sie durch Vergeltung gleicher Schmach die ihrige hinlänglich gerächt zu haben glaubten. So zeigte das Glück, das beiden Teilen in kürzester Frist zum Gegenteil umschlug und den Samniten durch die von ihnen mit Schmach Belegten wiedervergalt, seine Allgewalt.
86. Im Jahr der Stadt 435 (319 v, Chr.).
Papirius rückte gegen die Samniten ins Feld, schloss sie (in der Stadt) ein und belagerte sie. Als ihm hier einer vorwarf, dass er zu viel Wein trinke, sagte er: »Dass ich kein Säufer bin, ersieht jedermann schon daraus, dass ich am frühesten aufstehe und am spätesten schlafen gehe; weil ich aber bei Tag und bei Nacht für das Gemeinwohl sorge und nicht leicht einschlafe, genieße ich den Wein, um mich in Schlaf zu bringen.«
Als er einmal selbst die Wachen besuchte und den Anführer der Pränestiner nicht auf dem Posten fand, ließ er ihn kommen und befahl dem Liktor, das Beil bereitzuhalten. Als jener erblasste und erschrak, begnügte er sich mit dessen Furcht und verfügte weiter nichts gegen ihn, sondern befahl dem Liktor, einige Wurzeln neben den Zelten auszurupfen, damit die Vorbeigehenden sich nicht daran stoßen.
87. Das Glück bleibt meistens einem nicht immer getreu, sondern verführt sogar viele zur Unvorsichtigkeit.
88. Fabius Rullus. 445 (309 v.Chr.).
In der Stadt wünschte man den Papirius zum Diktator. Da man aber besorgt war, Rullus möchte ihn wegen dessen, was ihm als Reiterobristen begegnet war, nicht ernennen wollen, bat man ihn durch Abgeordnete, das Gemeinwohl seiner Feindschaft vorzuziehen. Er gab den Abgesandten keinen Bescheid; als es aber Nacht wurde (denn zur Nachtzeit musste herkömmlicherweise der Diktator ernannt werden), erklärte er ihn dazu und erwarb sich dadurch das größte Ansehen.
89. Im Jahr der Stadt 457 (297 v.Chr.).
Appius der Blinde und Volumnius gerieten miteinander in Streit; wobei Volumnius, als Appius in der Versammlung gegen ihn äußerte, dass er durch ihn weiser geworden sei und es ihm nicht danke, zugab, dass er weiser geworden sei; dass aber jener an Kriegserfahrung nichts gewonnen habe.
90. Im Jahr der Stadt 459 (295 v.Chr.).
Im Augenblick wusste das Volk nicht, sollte es der Wahrsagung glauben oder nicht, denn es wollte überhaupt nicht hoffen, weil es nicht wollte, dass davon irgendetwas geschehe; dagegen wagte es auch nicht, allem den Glauben zu versagen, weil es lüstern nach dem Sieg war; so lebte es nun unter Schrecken und Furcht in der peinlichsten Ungewissheit. Als aber alles nacheinander eintraf, passten sie die Deutung der Erfahrung an, und er selbst suchte aus der Voraussicht des Unbekannten den Ruhm der Weisheiten erlangen.
91. Im Jahr der Stadt 459 (295 v.Chr.).
Die Samniten, ergrimmt über die ungünstigen Ergebnisse und nicht verwindend, dass sie immer die Besiegten waren, beschlossen, in einem entscheidenden verzweifelten Kampf entweder zu siegen oder männlich umzukommen. Sie hoben die ganze waffenfähige Mannschaft aus und ließen sie die furchtbarsten Eide schwören, dass sie selbst nicht von der Wahlstatt fliehen und jeden, der es zu tun versuchte, niederstoßen wollten.
92. Im Jahr der Stadt 463 (291 v.Chr.).
Auf die Nachricht, dass der Konsul [Quintus] Fabius [Maximus Gurges] eine Schlacht gegen die Samniten verloren habe, wurden die Römer sehr aufgebracht, riefen ihn in die Stadt und zogen ihn zur Rechenschaft. Er wurde in der Volksversammlung heftig angeklagt (seines Vaters Ruhm lag schwerer auf ihm als alle andere Beschuldigungen), und man erlaubte ihm nicht ein Wort zu seiner Verteidigung.
Der Greis sprach zwar nichts zu des Sohnes Entschuldigung, zählte aber seine und seiner Vorfahren Taten auf und verbürgte sich, dass er nichts so Unwürdiges tun werde. So besänftigte er ihren Zorn, besonders da er die Jugend seines Sohnes zur Entschuldigung anführte.
Er ging nun sogleich mit ihm zum Heer ab, schlug die auf ihren Sieg stolzen Samniten und eroberte ihr Lager nebst vieler Beute. Die Römer priesen jenen jetzt hoch und ließen dem Sohn auch künftig als Prokonsul den Oberbefehl, nur sollte er den Vater als Unterbefehlshaber bei sich behalten. Ohne Schonung des Alters unterstützte ihn dieser überall mit Rat und Tat; auch die Bundesgenossen gingen, seiner früheren Taten eingedenk, ihm willig an die Hand. Bei all dem merkte man nicht, dass alles durch ihn geschah; er blieb, als wäre er wirklich nur des Sohnes Ratgeber und Untergebener, sehr bescheiden und schrieb allen Ruhm der Taten diesem zu.
93. Im Jahr der Stadt 463 (291 v.Chr.).
Die Soldaten, welche mit Iunius und Postumius ausgezogen, erkrankten auf dem Weg; als Ursache wurden die Anstrengungen bei der Fällung des Waldes angegeben. Deswegen zurückgerufen gab er ihnen aber auch hier nicht viel Gehör, indem er sagte, dass der Senat über die Privatleute, aber nicht über die Konsuln zu befehlen habe.
94. In den Jahren der Stadt 461–468 (293–286 v.Chr.).
[…] Als ihnen endlich die Vornehmen viel mehr, als sie anfangs gehofft hatten, zugestehen wollten, gaben sie sich nicht mehr zufrieden, sondern wurden, je mehr sie jene nachgeben sahen, als hätten sie ein Recht darauf gewonnen, nur noch dreister; und wegen der fortwährenden Zugeständnisse schlugen sie diese, als wären sie notwendig, für nichts mehr an und trachteten nach anderem, indem sie das bereits Errungene als Brücke gebrauchten.