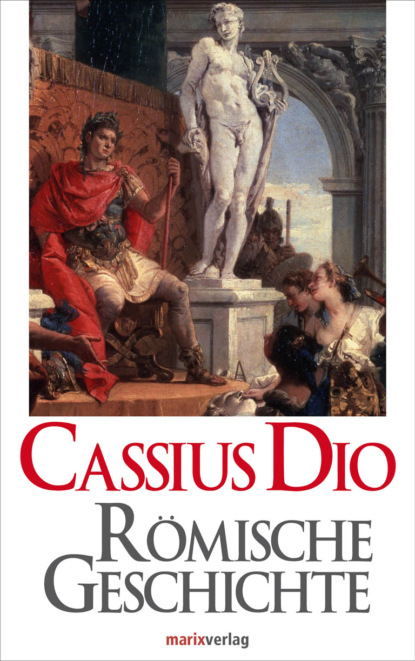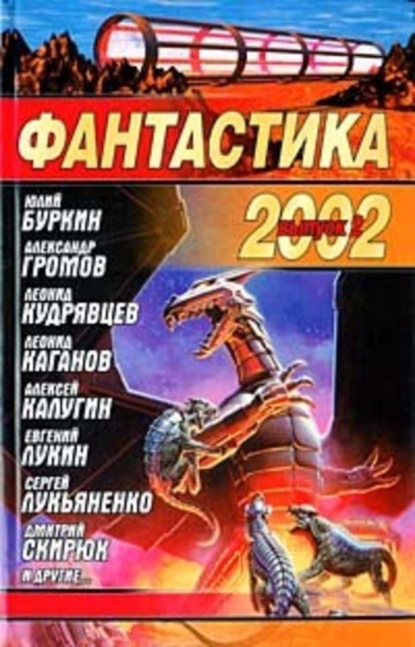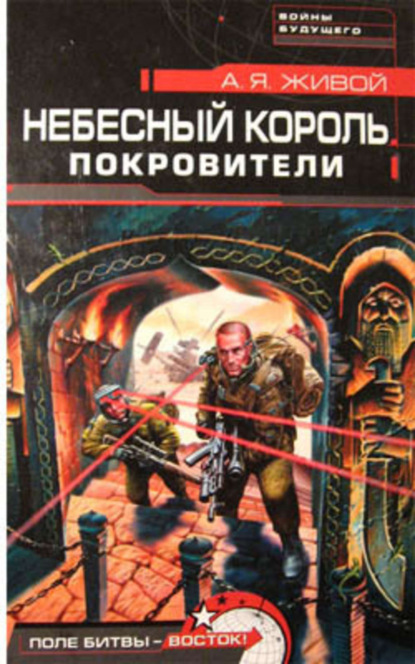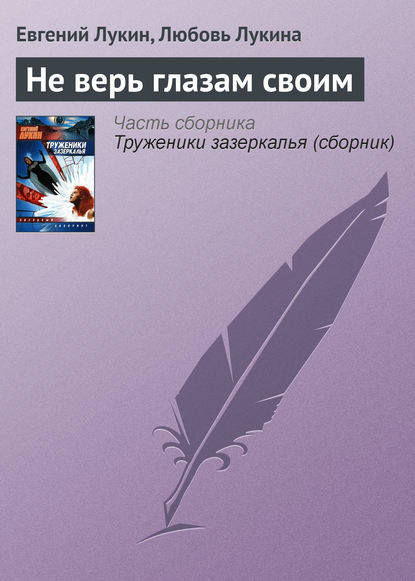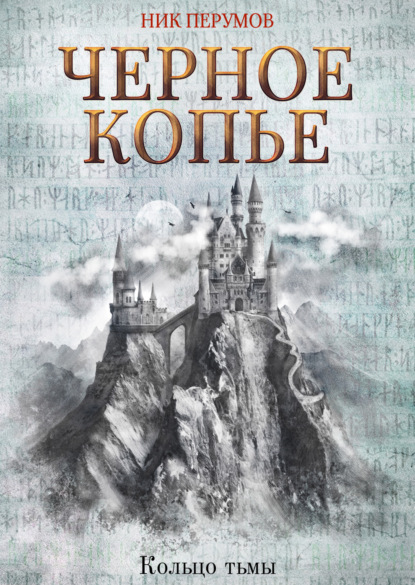- -
- 100%
- +
95. Im Jahr der Stadt 469 (285 v.Chr.).
Als die Feinde einen zweiten Feldherrn ankommen sahen, waren sie nicht mehr auf das gemeinsame Heil des Heers bedacht, sondern jeder suchte, wie er sich selbst retten möchte, wie es bei Heeren zu geschehen pflegt, die nicht aus einem Volk bestehen, nicht die gleichen Veranlassungen zum Krieg haben noch unter einem Feldherrn stehen; solange es gut geht, stimmen sie zusammen, bei Unglücken aber hat jeder bloß sich selbst im Auge. Sobald es dunkel wurde, ergriffen sie ohne gegenseitige Rücksprache die Flucht, denn in Masse glaubten sie sich weder durchschlagen, noch unvermerkt entkommen zu können; wenn es aber jeder für sich und, wie sie glaubten, allein täte, so würde es ihnen leichter gelingen, weshalb sie sich auch, jeder nach dem eigenen Gutdünken, mit so viel Sicherheit, wie sie konnten, auf die Flucht begaben.
96. Im Jahr der Stadt 471 (283 v.Chr.).
Als die Römer erfuhren, dass die Tarentiner und einige andere zu einem Krieg gegen sie rüsteten, schickten sie [Gaius] Fabricius [Luscinus] als Gesandten zu den verbündeten Städten, um sie vor Neuerungen zu warnen. Die aber nahmen ihn fest und verleiteten durch Gesandtschaften an die Tyrrhener, Umbrier und Gallier – die einen gleich jetzt, die anderen nicht lange danach – zum Abfall.
97. Im Jahr der Stadt 471 (283 v.Chr.).
Dolabella griff die Tyrrhener, als sie über den Tiber setzten, an, und der Fluss wurde mit Blut und Leichen angefüllt, sodass den Römern in der Stadt der Anblick der Flussströmung, ehe noch Botschaft kam, den Ausgang der Schlacht bezeichnete.
Von der Mündung des Tiber bis nach Rom sind es 18 Stadien.15
98. Im Jahr der Stadt 472 (282 v.Chr.).
Die Tarentiner stellten sich, obgleich sie selbst den Krieg angefacht hatten, immer noch, als ob sie friedliche Gesinnung hegten. Die Römer erfuhren zwar ihre Umtriebe, ließen sie jedoch unter den gegebenen Umständen unangefochten. Als sie aber später glaubten, dass die Macht der Römer nicht bis zu ihnen reiche bzw. dass sie selbst stets unbeachtet bleiben würden, weil nicht einmal eine Beschwerde zu ihnen drang, trieben sie ihren Übermut noch weiter und zwangen die Römer gegen deren Willen in einen Krieg und bestätigten so den Ausspruch: Wen das Glück im Übermaß begünstigt, den stürzt es ins Unglück, denn es verführt zur Überhebung und zur Aufgeblasenheit und bringt ihn so zu Fall.
So sind auch sie aus ihrer Blüte und ihrem Glück in ebenso großes Unglück gestürzt.
99. Im Jahr der Stadt 472 (282 v.Chr.)
[Lucius] Cornelius wurde von den Römern nach Tarent gesandt.16 Die Tarentiner, welche gerade das Bacchusfest feierten und am Abend voll des Weines im Theater saßen, argwöhnten, er komme mit seinen Schiffen in feindlicher Absicht, und, von Zorn und Trunkenheit getrieben, liefen sie ohne Weiteres wider ihn aus, fielen über ihn her, der keine Hand zur Gegenwehr rührte und nicht im Geringsten eine Feindseligkeit vermutete, und warfen ihn nebst vielen anderen ins Meer. Die Römer, auf diese Kunde, wie sich denken lässt, höchst aufgebracht, beschlossen dennoch, nicht sogleich wider sie ins Feld zu rücken. Um aber nicht den Schein zu haben, als wollten sie ganz dazu schweigen, und um sie dadurch nicht noch dreister zu machen, schickten sie Gesandte ab. Die Tarentiner, weit entfernt, sie, wie es sich gebührte, aufzunehmen, oder ihnen die geeignete Antwort zu geben, verhöhnten sie, ehe sie ihnen noch Gehör gegeben hatten, sowohl wegen anderer Sachen als auch wegen ihrer Kleidung. Es war dies die städtische, die wir auf dem Markt tragen. Diese hatten sie angelegt, sei es der größeren Feierlichkeit wegen oder um denselben dadurch Ehrfurcht einzuflößen.
Sie standen nun gruppenweise zusammen und verhöhnten sie. Denn auch damals feierten sie gerade ein Fest, das sie, die auch sonst nicht sehr bescheiden waren, noch mutwilliger machte. Zuletzt stellte sich einer neben Postumius, bückte sich, verrichtete seine Notdurft und beschmutzte Postumius’ Kleid. Als alle anderen darüber aufschrien, es als eine Heldentat lobpriesen, viele mutwillige Spottlieder auf die Römer sangen und mit Hand und Fuß den Takt dazu schlugen, sprach Postumius: »Lacht nur, lacht, solange ihr noch könnt. Denn lange werdet ihr weinen, wenn ihr dies Kleid mit eurem Blut abwaschen müsst.« Auf diese Rede enthielten sie sich des Spotts, taten aber nichts, sich für die Verhöhnung zu entschuldigen, sondern rechneten es sich noch als Wohltat an, dass sie dieselben unversehrt ziehen ließen. Als Meton die Tarentiner vergeblich ermahnt hatte, keinen Krieg mit den Römern anzufangen, entfernte er sich aus der Versammlung, bekränzte sich und kehrte mit Festgenossen und einer Flötenspielerin zurück. Als er nun sang und den Cordax17 tanzte, hörten sie mit der Beratung auf und schrien und klatschten ihm zu, wie es in solchen Fällen zu geschehen pflegt. Er aber erbat sich Stille und sprach: »Jetzt noch dürfen wir uns im Wein ergehen und guter Dinge sein; wenn ihr aber tut, worüber ihr zurate geht, werden wir als Sklaven dienen.
100. Gaius Fabricius.
Gaius Fabricius war in allem dem Rufinus gleich, bezüglich der Unbestechlichkeit aber übertraf er ihn weit. Er war absolut keinem Geschenk zugänglich und fand deshalb an jenem keinen Gefallen, war vielmehr beständig mit ihm entzweit; gleichwohl gab er ihm seine Stimme zum Konsulat. Denn er hielt ihn zur Führung des Krieges für den Geeignetsten und setzte seine Privatfeindschaft dem Vorteil des Staates nach. Dadurch erwarb er sich Ruhm, da er sich auch über den Neid erhaben zeigte, den oft auch bei den verdienstvollsten Männern der Ehrgeiz in so hohem Grade erzeugt. Denn als echter Patriot, dem nichts an Auszeichnung lag, hielt er es für einerlei, ob dem Staat durch ihn selbst oder einen anderen, wenn er auch sein Feind wäre, geholfen würde.
101. Kineas.
Durch Kineas soll Pyrrhos mehr Städte als durch das eigene Schwert erobert haben. Er war, nach Plutarch18 ein guter Redner und an Stärke in der Beredsamkeit allein mit Demosthenes zu vergleichen. Weil er nun, als verständiger Mann, das Törichte des Feldzugs einsah, machte er dem Pyrrhos Vorhaltungen dagegen. Dieser plante, kraft seiner Tapferkeit, den ganzen Erdkreis sich zu unterwerfen; jener riet ihm, er sollte sich mit dem eigenen Land als hinreichend zur Glückseligkeit begnügen. Die Kriegslust des Mannes und seine Herrschsucht, mächtiger als des Kineas Rat, hatten zur Folge, dass er nach dem Verlust vieler Tausende von Kriegern in den Schlachten aus Sizilien und Italien schimpflich abziehen musste.
102. Der König Pyrrhos herrschte über das sogenannte Epirus und hatte sich den größten Teil Griechenlands teils durch Wohltaten, teils durch den Schrecken seiner Waffen zu eigen gemacht. Die damals mächtigen Aitoler, der Makedonier Philipp19 und die Fürsten Illyriens, buhlten um seine Gunst. Denn durch seine glänzenden Anlagen, seine hohe Bildung und seine Gewandtheit in Geschäften tat er sich vor allen hervor; sodass seine Persönlichkeit seine und seiner Bundesgenossen Macht, so groß sie auch war, überwog.
103. Pyrrhos, der König von Epirus, trug den Sinn noch höher, da er von den auswärtigen Völkern als der geeignetste Gegner der Römer angesehen wurde, und betrachtete es als glücklichen Umstand, dass er den Schutzsuchenden, zumal den Griechen, zu Hilfe kommen sollte; und dass er jene unter einem schicklichen Vorwand zuvor angriff, ehe ihm von denselben etwas zuleide getan worden war. Denn so sehr war er auf guten Ruf bedacht, dass er, obgleich schon längst es auf Sizilien absehend20 und der Römer Macht zu demütigen trachtend, Bedenken hatte, als nicht Beleidigter die Feindseligkeiten gegen sie zu beginnen.
Pyrrhos schickte nach Dodona21 und ließ das Orakel über den Feldzug um Rat fragen. Als ihm der Spruch zuteilwurde: Wenn er nach Italien übersetze, ‘Ρωμαιούς νικήσειν,22 legte er ihn nach seinen Wünschen aus (so sehr verblendet oft die Begierde) und wartete nicht einmal den Frühling ab.
104. Im Jahr der Stadt 474 (280 v.Chr.)
Die Rheginer hatten sich von den Römern eine Besatzung erbeten; diese wurde von Decius befehligt. Die meisten von ihnen ließen sich, durch den Überfluss an Lebensmitteln, das müßige Leben und die, mit der heimischen verglichen, weit ungebundenere Zucht, besonders auf Antrieb des Decius, in den Sinn kommen, die vornehmsten Rheginer zu töten und sich der Stadt zu bemächtigen. Weil die Römer mit den Tarentinern und dem Pyrrhos zu tun hatten, glaubten sie, nach Willkür schalten zu dürfen. Ein weiterer Beweggrund war, dass sie auch Messana im Besitz der Mamertiner sahen. Denn diese, Campaner und von Agothokles, dem Beherrscher Siziliens, zur Beschützung der Stadt bestellt, hatten die Einwohner ermordet und sich in den Besitz der Stadt gesetzt.23
Sie trauten sich indessen nicht, ihren Anschlag offen auszuführen, da sie zu wenige waren; Decius unterschob Briefe, worin einige Bürger dem Pyrrhos anboten, sie (die Besatzung) durch Verrat in seine Hände zu überliefern, rief die Soldaten zusammen, las ihnen die angeblich abgefangenen Briefe vor und versetzte sie durch eine passende Rede in Wut, besonders als ein von ihm aufgestellter Bote die Nachricht brachte, es seien Schiffe des Pyrrhos in der Gegend gelandet, um mit den Verrätern Absprachen zu treffen. Andere, von ihm vorbereitet, vergrößerten die Sache und schrien durcheinander, man müsse den Rheginern zuvorkommen, ehe man von ihnen gefährdet werde; wenn man sie unversehens überfalle, könnten sie schwerlich Widerstand leisten. Die einen stürzten jetzt in ihre Quartiere, die anderen in die Häuser und machten die meisten nieder. Einige wenige lud Decius zum Gastmahl und tötete sie.
105. Der Befehlshaber der Besatzung, Decius, ermordete die Rheginer und schloss ein Bündnis mit den Mamertinern, indem er sie, die sich der gleichen Tat vermessen hatten, für die treusten Bundesgenossen hielt, weil ihm die Erfahrung sagte, dass viele Menschen sich wegen gleicher Verbrechen einander weit enger zusammenschließen, als es bei rechtmäßiger Genossenschaft und Verwandtschaft zu geschehen pflegt.
Die Römer kamen deswegen in bösen Leumund, bis sie endlich gegen sie zu Felde rückten; weil sie nämlich durch wichtigere und dringlichere Angelegenheiten beschäftigt waren, glaubten einige, dass sie gar nichts aus der Sache machen wollten.
106. Die Römer gerieten auf die Nachricht, dass Pyrrhos komme, in große Furcht, denn sie hörten von ihm, dass er ein guter Kriegsmann sei und ein kriegerisches, noch nie besiegtes Heer befehlige; wie es zu gehen pflegt, wenn man sich nach unbekannten, durch den Ruf gepriesenen Männern erkundigt.
Menschen, die unter verschiedenen Sitten aufgewachsen sind und nicht dieselben Begriffe von Schlecht und Gut haben, können sich niemals befreunden.
Ehrgeiz und Argwohn sind die beständigen Begleiter der Tyrannen, weshalb sie auch keinen wahrhaften Freund haben können; denn wer beargwöhnt und beneidet wird, kann nicht von Herzen lieben. Die gleiche Sinnesart und Lebensweise, dass man auf demselben Weg sein Glück und Unglück findet, macht allein wahre und beständige Freunde; gebricht es an einem dieser Dinge, so wird man bloß den äußeren Schein, keine zuverlässige Stütze der Freundschaft finden.
107. Wenn die Feldherrnkunst über ansehnliche Mittel verfügt, so trägt sie sehr viel zur Rettung und zum Sieg bei; für sich allein aber vermag sie nichts; denn auch keine andere Kunst richtet ohne den Dienst und die Beihilfe anderer etwas aus.
Publius Valerius bekam die Kundschafter des Pyrrhos gefangen und ließ sie, nachdem sie sich im Lager gehörig umgesehen hatten, unversehrt frei, um dem Pyrrhos die schöne Haltung des Heeres und gegen welche und in welcher Zucht gehaltene Männer er zu streiten hätte, zu verkündigen.
Als Megakles gefallen war und Pyrrhos den Hut abwarf, änderte sich das Glück der Schlacht. Denn den einen gab die Rettung des Königs, und dass er gegen ihre Hoffnung nach solcher Gefahr noch am Leben war, weit mehr Mut, als wenn man ihn gar nicht gefallen geglaubt hätte.
Die anderen, zum zweiten Mal getäuscht, verloren den guten Willen, da sie wiederum vergeblich Mut gefasst hatten und wegen dieses plötzlichen Übergangs zur Furcht vor Schlimmerem auch nicht mehr hofften, dass er sich später wieder ermannen werde.
108. Als einige Pyrrhos zum Sieg beglückwünschten, nahm er zwar die Ehre des Kampfes hin, sagte aber, wenn er einen zweiten Sieg wie diesen erkämpfe, sei er verloren. – Auch erzählt man von ihm, dass er die besiegten Römer bewundert und denselben vor seinen Soldaten mit folgenden Worten den Vorzug gegeben habe: »Den ganzen Erdkreis wollte ich überwältigen, wenn ich König der Römer wäre.«
Pyrrhos ließ die in der Schlacht gefallenen Römer mit aller Sorgfalt beerdigen. Den Ausdruck von Trotz bewundernd, der auf den Gesichtern der Männer lag, und dass sie alle Wunden vorne am Körper hatten, soll er die Hände zum Himmel gehoben und um solche Bundesgenossen gebeten haben. Denn so würde er leicht den ganzen Erdkreis bezwingen.
Dieser Sieg verherrlichte den Pyrrhos und machte ihm einen so großen Namen, dass viele, die bisher parteilos geblieben waren, zu ihm übertraten und alle säumigen Bundesgenossen sich bei ihm einstellten. Zwar zeigte er keinen offenen Ärger über sie, vermochte aber doch sein Misstrauen nicht ganz zu verbergen; stattdessen machte er ihnen Vorwürfe über ihre Lässigkeit, doch so, dass er sie sich nicht entfremdete. Denn hätte er nichts geäußert, so müssten sie ihn, glaubte er, für einen Toren halten, der nicht einsehe, dass sie sich verfehlten, oder argwöhnen, dass er geheimen Groll wider sie trage, und ihn deshalb verachten oder hassen und ihm nachstellen, um seiner Rache vorzubeugen. Daher sprach er freundlich mit ihnen und teilte ihnen selbst von der Beute etwas zu.
109. Im Jahr der Stadt 475 (279 v.Chr.).
Pyrrhos suchte anfangs die gefangenen Römer, deren er viele hatte, zu überreden, unter ihm gegen Rom zu dienen. Da sie sich aber weigerten, suchte er sie auf jede Weise zu gewinnen, ließ keinen fesseln noch ungütig behandeln, sondern wollte sie ohne Lösegeld freilassen und sich durch sie ohne weiteren Kampf der Ergebenheit der Stadt versichern.
Die Römer, welche die Elefanten, da sie noch nie zuvor solche Tiere gesehen hatten, in Schrecken versetzten, gewannen bei dem Gedanken, dass auch sie sterblich seien und dass kein Tier dem Menschen überlegen sei, sondern wenn auch nicht seiner Gewalt, doch seiner List unterliege, wieder Mut.
Die Soldaten des Pyrrhos waren teils aus angeborener Raubsucht, teils weil sie als Bundesgenossen kamen, sehr aufs Plündern erpicht, zumal sie nur zuzugreifen brauchten und nichts dabei zu fürchten hatten.
Die Epiroten, unwillig darüber, dass sie, unter großen Hoffnungen ausgezogen, nichts als Anstrengungen hatten, plünderten selbst in Freundesland und leisteten dadurch der Sympathie für die Römer großen Vorschub. Denn die Bewohner Italiens, welche der Partei Pyrrhos’ beigetreten waren, wurden ihm entfremdet, da sie sahen, dass sie ohne Unterschied das Gebiet der Verbündeten wie der Feinde verheerten; denn sie richteten ihr Augenmerk mehr auf das, was Pyrrhos tat, als auf das, was er verhieß.
Pyrrhos fürchtete sehr, von den Römern in unbekannten Gegenden eingeschlossen zu werden,24 und als sich seine Bundesgenossen darüber aufhielten, sagte er, er sehe an dem Land selbst, wie weit sie von den Römern abstünden, denn das jenen unterstehende Land habe allerlei Bäume, Weinpflanzungen und kostbare Landbauarbeiten, das seiner Freunde aber sei so verheert, dass man ihm nicht einmal ansehe, dass es jemals bewohnt worden sei.
112. Als er bei seiner Rückkehr das Heer des Laevinus weit stärker als das frühere sah, meinte er, die niedergehauenen Heere der Römer wüchsen wie die der Hydraköpfe wieder nach. Er wagte deshalb keine Schlacht, stellte sich zwar in Schlachtordnung auf, griff aber nicht an.
113. Auf die Nachricht, dass der Gefangenen wegen Gesandte kämen und sich unter diesen Fabricius befinde, schickte er ihnen, um sie vor Misshandlungen der Tarentiner zu schützen, bis an die Grenzen eine Bedeckung entgegen und holte sie dann noch in Person ein. Er führte sie in die Stadt, bewirtete sie herzlich und behandelte sie sehr zuvorkommend; indem er hoffte, sie würden um Frieden bitten und Bedingungen, wie sich von Besiegten erwarten ließ, annehmen.
Als aber Fabricius erklärte: »Die Römer haben uns gesandt, um die Rückgabe der in der Schlacht Gefangenen zu unterhandeln und für sie ein Lösegeld zu zahlen, über welches beide Teile übereinkommen würden, war er sehr verlegen, weil er nicht sagte, sie kämen, um Friedensanträge zu stellen. Er ließ sie abtreten und beriet sich mit seinen Vertrauten, die er beizuziehen pflegte, über die Rückgabe der Gefangenen, hauptsächlich aber über den Krieg und die Führung desselben, ob er ihn mit aller Macht verfolgen oder auf irgendeine Weise […] – »[…]25 zu richten und in ungewisse Kämpfe und Schlachten zu stürzen. Deswegen, Milo, folge mir und meinem erfahrenen Rat, und wende überall, wo es angeht, lieber Weisheit als Gewalt an. Denn Pyrrhos versteht alles, was zu tun ist, aufs Beste und braucht nicht erst von uns darauf gebracht zu werden.« So sprach er, und alle stimmten ihm zu, besonders da sie auf diesem Wege weder zu Schaden noch in Gefahr kamen, auf dem anderen aber beides zu befürchten hatten. Auch Pyrrhos war dieser Ansicht und sprach zu den Gesandten: »Weder habe ich euch früher willentlich bekriegt, Römer, noch tue ich es jetzt. Es ist mir alles an eurer Freundschaft gelegen, und deshalb entlasse ich die Gefangenen alle ohne Lösegeld und schließe Frieden.« Hierauf bezeigte er ihnen noch besonders alle Auszeichnung, damit sie ihm geneigt würden oder wenigstens den Frieden daheim bewirken möchten.
Pyrrhos suchte nicht nur die anderen für sich zu gewinnen, sondern besprach sich auch mit Fabricius auf folgende Weise: »Ich brauche nicht länger mit euch Krieg zu führen, Fabricius; ja ich bereue sogar, dass ich mich von Anfang an von den Tarentinern bereden ließ, hierher zu kommen, obgleich ich euch in einer großen Schlacht besiegt habe. Ich wünschte nun aller Römer Freund, vorzüglich aber der deinige zu werden, denn ich habe in dir einen äußerst wackeren Mann gefunden. Ich bitte dich nun, mir den Frieden zu bewirken und mir dann nach Hause und nach Epirus zu folgen. Denn ich habe einen Feldzug gegen Griechenland vor und bedarf deines Rates und deines Feldherrntalents.«
Fabricius erwiderte: »Ich lobe es, dass du den Feldzug bereust und Frieden wünschst, auch werde ich dir, wenn er uns nützt, dazu behilflich sein; denn gegen mein Vaterland zu handeln, wirst du von mir als einem wackeren Mann, wie du mich nennest, nicht verlangen. Einen Rat und Feldherrn nimm dir aber nicht aus einem Freistaat26, ich wenigstens habe auch keine Muße dazu. Ich nähme auf keinen Fall dergleichen an, weil es überhaupt nicht ziemen will, dass ein Gesandter Geschenke nimmt. Ich frage dich nun, ob du mich für anständig hältst oder nicht? Denn wenn ich schlecht bin, wie achtest du mich dann der Geschenke würdig? Wenn ich aber anständig bin, wie mutest du mir deren Annahme zu? Wisse denn, dass ich sehr viel besitze und mehr nicht bedarf, denn mir genügt, was ich habe, und ich begehre auch des Fremden nicht. Wenn du dich auch für noch so reich hältst, so bist du doch bitterarm; denn du hättest nicht Epirus noch deine anderen Besitzungen verlassen und wärest hierher übergesetzt, wenn dir jenes genügte und du nicht nach mehr begehrtest. Wenn einer so geartet ist und nimmer satt werden kann, so ist er der ärmste Mann. Warum? Weil er nach allem, was er nicht hat, wie nach einem notwendigen Besitz giert, als ob er ohne Selbiges nicht leben könnte. Wie gerne möchte ich dir, der du dich meinen Freund nennst, von meinem Reichtum abgeben, denn er ist viel zuverlässiger und unsterblicher als der deinige; ihn beneidet, ihn belauert kein Volk, kein Tyrann, und was das Schönste ist, je mehr ich davon abgebe, desto mehr nimmt er zu. Und worin besteht derselbe? Im freudigen Genuss dessen, was man hat, als hätte man an allem Überfluss; in der Enthaltung von Fremdem, als ob es großes Unglück brächte [es zu nehmen]; darin, dass ich niemandem Unrecht, vielen aber Gutes tue, und in tausend anderen Dingen, deren Aufzählung ermüden würde. So wollte ich lieber, wenn mir die Wahl nicht bliebe, durch fremde Gewalt als durch Selbstbetrug zugrunde gehen; denn das eine verlangt oft so das Geschick, das andere geschieht aus Betörung und schmutziger Habsucht. Daher ist es mir noch immerhin lieber, durch die Gewalt höherer Mächte als durch eigene Schlechtigkeit zu fallen; denn in jenem Fall wird der Leib besiegt, in diesem geht auch die Seele mit zugrunde. So wird einer gewissermaßen Selbstmörder, weil er, wenn er sich nicht daran gewöhnt, sich mit dem Vorhandenen zu begnügen, in eine unersättliche Habsucht verfällt.«
114. Und ließen sich aufs Willigste zum Kriegsdienst einschreiben, indem jeder glaubte, was er für sich unterlasse, würde zum Verderben des Vaterlands den Ausschlag geben. Solcher Art ist die Rede und hat solche Kraft, dass sie jene anderen Sinnes machte, mit Hass und Kampfeslust gegen Pyrrhos erfüllte und für die Zurückweisung der Geschenke stimmte.
115. Als der Redner Kineas, welcher von Pyrrhos als Gesandter nach Rom geschickt worden war, bei seiner Rückkehr von dort nach dem Glanz der Stadt Rom und anderem befragt wurde, antwortete er, er habe die Vaterstadt vieler Könige gesehen, indem er damit andeutete, dass alle Römer solche Männer seien, wie er selbst (Pyrrhos) bei den Hellenen seiner Vorzüge wegen geschätzt würde.
116. Wessen Selbstvertrauen unvermutet geschmäht wird, der verliert auch an leiblicher Stärke.
Pyrrhos ließ Decius sagen, dass es ihm, wenn er dies vorhätte, d.h. ohne gefangen zu werden, sich töten zu lassen, es ihm nicht gelingen werde, und er fügte die Drohung hinzu, dass er, wenn er lebendig gefangen werde, eines schimpflichen Todes sterben müsse. Die Konsuln erwiderten, dass sie einer solchen Tat nicht bedürften, denn auf jeden Fall würden sie auch ohne eine solche Tat mit Pyrrhos fertig werden.
117. Als die Lager des Fabricius und des Pyrrhos einander gegenüberstanden, kam bei Nacht ein Arzt oder ein höherer Hofbeamter des Königs zu Fabricius und erbot sich, Pyrrhos durch Gift aus dem Wege zu schaffen, wenn er von ihm eine gewisse Geldsumme erhalten würde. Fabricius aber verabscheute das Anerbieten und schickte ihn Pyrrhos gebunden zu. Pyrrhos soll, voll Bewunderung über diese Tat, ausgerufen haben: »Dies ist Fabricius und kein anderer, den man schwerer von seiner angestammten Tugend als die Sonne von ihrer gewohnten Bahn abbrächte. Pyrrhos aber wurde, nachdem er alles aufs Spiel gesetzt hatte, gänzlich besiegt.
118. Im Jahr der Stadt 478 (276 v.Chr.).
Da die Bundesgenossen dem Pyrrhos keinen Beistand leisten wollten, vergriff er sich an den Schätzen der Persephone, die für sehr reich gehalten wurden. Er plünderte sie und schickte den Raub auf Schiffen nach Tarent. Die Schiffsmannschaft kam beinahe vollständig in einem Sturm um, die Schätze und die Weihgeschenke aber wurden ans Land geworfen.
119. […], da er sonst äußerst scharf gegen sie verfuhr, und seiner eigenen Sicherheit wegen mehr darauf Bedacht nahm, dass keiner, wenn er auch wollte, ihm schaden könnte, als dass er nicht den Willen dazu fasste. Weshalb er viele der obrigkeitlichen Personen und selbst die, die ihn herbeigerufen hatten, teils weil er es ihnen verdachte, dass sie sagten, sie hätten ihn in den Besitz der Stadt gesetzt, teils weil er befürchtete, sie möchten sich, wie früher ihn, so jetzt irgendeinem anderen ergeben, verbannte oder ermordete.
Wegen Folgendem wurde Pyrrhus allgemein gelobt. Als einige junge Leute ihn bei einem Gastmahl verspottet hatten, wollte er anfangs die Sache untersuchen, um sie zu bestrafen; als sie aber sagten: Wir hätten noch viel mehr und Ärgeres gesagt, wenn uns der Wein nicht ausgegangen wäre, lachte er und ließ sie frei.
120. Er wusste nicht, ob er den einen zuerst oder beide zugleich angreifen sollte, und war in großer Verlegenheit. Denn er traute sich nicht, das Heer zu teilen, weil er schwächer als die Feinde war, und doch wollte er dem anderen nicht ohne Weiteres das Land zur Plünderung überlassen.
121. Im Jahr der Stadt 481 (273 v.Chr.).
Als König Ptolemaios Philadelphos von Ägypten hörte, dass Pyrrhos schlecht davon gekommen war und die Macht der Römer stieg, schickte er ihnen Geschenke und schloss ein Bündnis. Die Römer, erfreut, dass er aus so großer Ferne ihnen solche Ehre bewies, ordneten eine Gegengesandtschaft an ihn ab. Als diese die von ihm erhaltenen prächtigen Geschenke in die Schatzkammer abliefern wollten, nahmen die Römer dieselben nicht an.