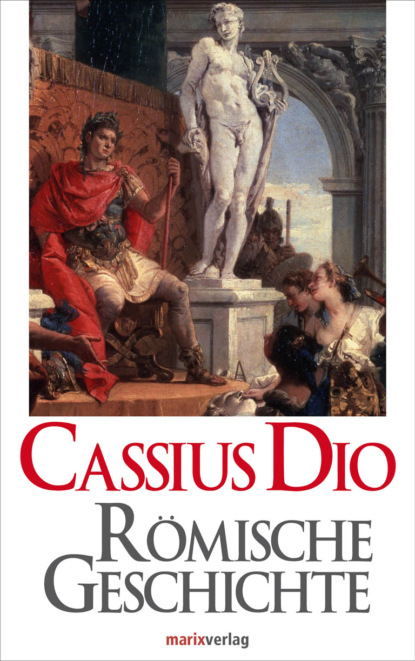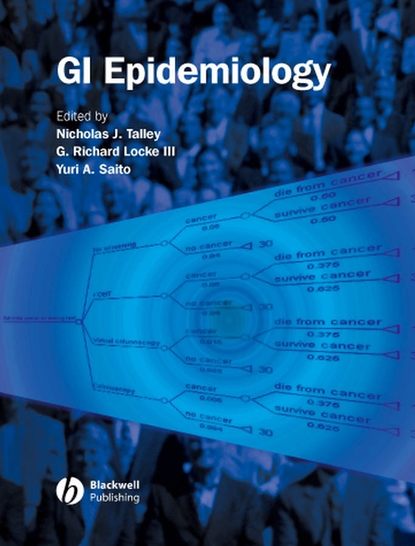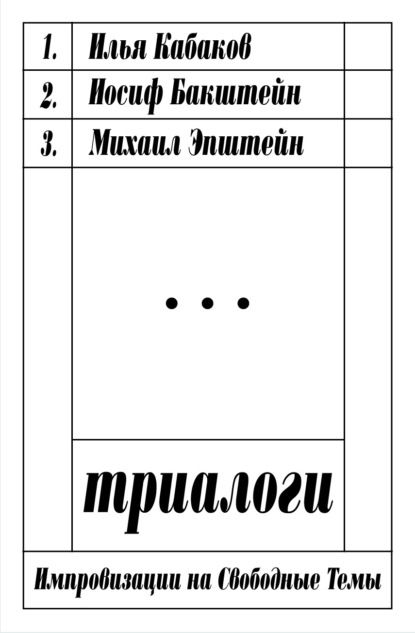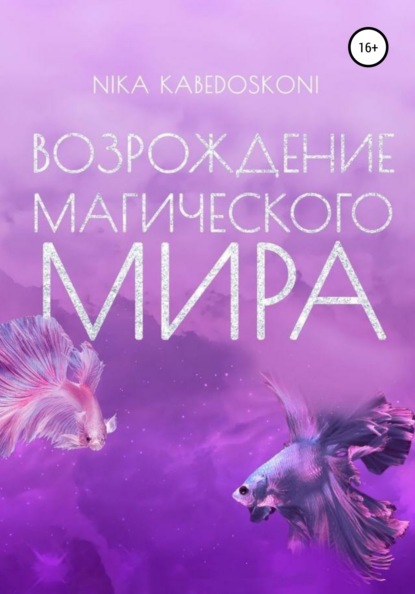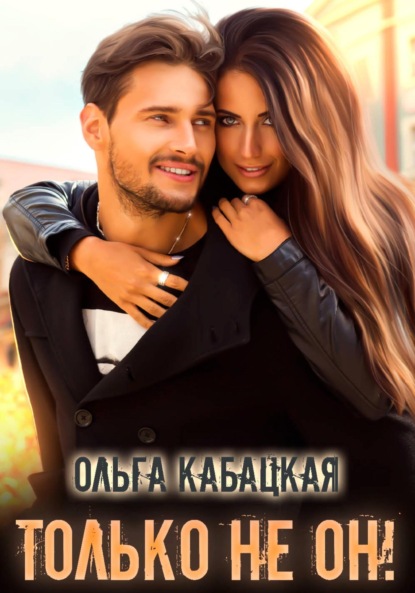- -
- 100%
- +
122. Im Jahr der Stadt 488 (266 v.Chr.).
Die Römer wurden, obgleich sie nach diesen Taten zu größerer Macht gelangt waren, nun doch nicht übermütig, vielmehr lieferten sie den Senator Quintus Fabius den Bürgern von Apollonia, einer am Ionischen Meerbusen gelegenen korinthischen Kolonie aus, weil er einige Gesandte derselben beschimpft hatte. Diese taten ihm jedoch nichts zuleide, sondern schickten ihn nach Hause zurück.
123. Im Jahr der Stadt 489 (265 v.Chr.)
Die Veranlassung des Zerwürfnisses war vonseiten der Römer, dass die Karthager den Tarentinern zu Hilfe kamen, vonseiten der Karthager aber, dass die Römer mit Hiero Freundschaft schlossen. Wie immer sich dies auch verhielt, so nahmen sie, die in der Tat Größeres als dies beabsichtigten, aber nicht dafür angesehen sein wollten, solchen Vorwand. In Wahrheit aber verhielt es sich anders. Die Karthager, im Besitz großer Macht, und die Römer, bereits erstarkend, beobachteten sich eifersüchtig und wurden teils aus Begierde nach mehr, die allen Menschen, besonders im Glück, eigen ist, teils aus Furcht zum Krieg getrieben, indem beide Teile den Besitz des Ihrigen nur durch die Zueignung des Fremden gesichert glaubten. Überhaupt war es schwer und fast unmöglich, dass zwei freie, mächtige und stolze Völker, um es kurz zu sagen, als Rivalen in der Schifffahrt über andere zu herrschen sich begnügten, einander selbst aber fernblieben. Dies und Ähnliches, durch Zufall zusammengetroffen, bewirkte die Auflösung des Bündnisses und fachte den Krieg an. Dem Schein nach galt der Kampf nur Messana und Sizilien, in der Tat aber waren sich beide Teile schon bewusst, dass von dort aus um die eigene Herrschaft gestritten wurde, und nahmen an, dass die Insel, zwischen beiden in der Mitte liegend, den Siegern einen sicheren Anlauf gegen die anderen geben werde.
124. Im Jahr der Stadt 490 (265 v.Chr.)
Gaius Claudius trat in die Versammlung und erklärte unter anderem, womit er die Gemüter zu gewinnen suchte, dass er zur Befreiung der Stadt gekommen sei. Denn die Römer bedurften Messanas nicht; er werde, wenn er ihre Angelegenheiten geordnet haben würde, sogleich in die Schiffe steigen.
Deshalb verlangte er, dass auch die Karthager abziehen, oder, wenn sie Rechtsansprüche machten, dieselben zur Beurteilung beibringen sollten. Da sich aber von den Mamertinern aus Furcht keiner verlauten ließ und die Karthager, welche die Stadt mit Waffengewalt innehatten, nicht auf ihn achteten, sprach er: »Ein vollgültiges Zeugnis gibt das Stillschweigen beider, der einen, dass sie unrecht haben (denn wenn sie etwas Vernünftiges zu sagen wüssten, hätten sie es vorgebracht), der anderen, dass sie frei zu sein wünschten (denn sonst hätten sie, zumal unter dem Schutz der Macht, sich freimütig für die Sache der Karthager erklärt).« Er schloss mit dem Versprechen, sowohl weil sie italischer Abkunft waren als auch weil sie um Beistand nachgesucht hatten, ihnen Hilfe zu leisten.
125. Gaius Claudius verlor einige Dreiruderer und rettete sich mit knapper Not; allein weder jener noch die Römer in der Stadt befassten sich deshalb weniger mit der See. Sonst wohl hätten sie in einem fehlgeschlagenen Versuch eine Götterweisung gesehen und wären an künftigem Gelingen verzweifelt. Aus anderen Gründen und vornehmlich aus Eifersucht warfen sie sich aber jetzt nur um so eifriger darauf, um sich nicht den Schein zu geben, als hätte sie der Unfall abgeschreckt.
126. Im Jahr der Stadt 492 (262 v.Chr.).
Hanno, der den Krieg mit Nachdruck zu führen wusste, wenn er unvermeidlich war, die Schuld des Friedensbruchs aber auf jenen schieben wollte, damit man nicht glaube, er hätte angefangen, schickte ihm die Schiffe und die Gefangenen zu, ermahnte ihn zum Frieden und riet ihm, sich nicht weiter mit dem Meer zu befassen. Als dieser aber nichts annahm, ließ er die übermütige, leidenschaftliche Drohung hören: »Die Römer sollten ihm nicht einmal die Hände im Meer waschen dürfen.« Und gleich darauf verlor er Messana.
127. Claudius fand die Mamertiner im Hafen beisammen, berief sie in eine Versammlung und erklärte: »Nicht bedarf ich der Waffen, euch selbst überlasse ich, darüber zu entscheiden.« Er bewog sie, Hanno zu berufen. Da dieser aber nicht (von der Burg) herabkommen wollte, zog er aufs Heftigste über ihn los und sagte, wenn die neuen Ankömmlinge auch nur die geringste Rechtfertigung hätten, so würden sie sich zur Rede stellen, und nicht mit Gewalt die Stadt besetzt halten. –
Konsul Claudius27 sprach den Soldaten Mut zu, sie sollten sich über des Hauptmanns Verlust nicht erschrecken lassen. Denn die Siege würden immer den besser Vorbereiteten zuteil, ihre Tapferkeit sei der Kunst der Feinde bei Weitem überlegen; sie würden sich das Seemannsgeschick in kurzer Zeit zu eigen machen, den Karthagern aber werde nie die gleiche Tapferkeit zuteil. Denn das eine könnte erworben werden und würde bald durch Aufmerksamkeit und Übung angeeignet, diese aber werde, wenn sie nicht von Natur aus in einem sitze, durch keine Belehrung eingeübt.
128. Die Afrikaner, die nicht auf die Beschaffenheit des Ortes vertrauten, sondern sich durch die eigene Tapferkeit ermannten, versuchten sich durchzuschlagen. Claudius aber jagte ihnen solchen Schrecken ein, dass sie sich sogar keinen Schritt aus dem Lager hervorwagten. Denn gewöhnlich entkommen die aus Vorbedacht Flüchtenden durch gründliche Vorsicht der Gefahr, die unvorsichtig etwas Wagenden aber gehen durch ihre Planlosigkeit zugrunde.
Besonnenheit erwirbt und sichert die Siege. Frechheit gewinnt nichts. Und wenn sie irgendwo glücklich ist, so verliert sie das Gewonnene sehr leicht wieder. Wenn einer aber auch damit größeren Erfolg hat, so wird er durch das unvernünftige Glück noch schlimmer und hat davon nicht nur keinen Nutzen, sondern geht eben dadurch umso eher zugrunde. Die Überlegung festigt den Geist durch Vorsicht, begründet die Hoffnung durch die Gewähr derselben und lässt so weder verzweifeln noch übermütig werden. Unvernünftige Dreistigkeit fürchtet auch ohne Grund. Unbesonnenes Ungestüm aber erhebt viele im Glück und drückt sie im Unglück nieder, da es keinen festen Haltepunkt bietet, sondern die Zufälle verworren zusammenwirft.
129. Im Jahr der Stadt 494 (260 v.Chr.)
Die Römer und die Karthager kamen in die Seeschlacht, an der Zahl der Schiffe wie am Mut der Kämpfenden gleich. Mit gleicher Vorrichtung begannen sie das Treffen und hofften durch dieses eine den ganzen Krieg zu entscheiden, indem sie Sizilien als Siegespreis vor Augen hatten und um Knechtschaft und Herrschaft kämpften, auf dass sie jener nicht als Besiegte verfielen, diese aber als Sieger errängen.
Die einen hatten das große Geschick der Ruderer aufgrund ihrer langen Seeherrschaft, die anderen die Stärke und den kühnen Mut der Kämpfenden voraus. Je unerfahrener sie nämlich im Seewesen waren, desto unbedenklicher und kecker stritten sie. Denn die Erfahrung macht immer bedenklich und säumig, wenn man sich dennoch zuletzt auch dafür (für den Kampf) entscheidet. Die Unerfahrenheit vertraut sich selbst unbesonnen und führt zum Handgemenge.
130. Im Jahr der Stadt 497 (257 v.Chr.)
Als die Karthager die Seeschlacht gegen die Römer verloren, hätten sie beinahe Hannibal mit dem Tode bestraft. Denn alle, welche Heere aussandten, pflegen sich selbst die glücklichen Erfolge zuzuschreiben, für die Verluste aber den Aufrührern die Schuld zu geben. Auch hätten die Karthager die Besiegten ohne Weiteres zur Strafe gezogen, wenn er sie nicht sogleich nach der Niederlage, als ob alles noch im vorigen Stande wäre, hätte fragen lassen, ob sie ihm rieten, sich zu schlagen, oder nicht. Als sie, wie sich erwarten ließ, im Vertrauen auf ihre Überlegenheit zur See ihre Zustimmung gaben, erklärte er ihnen durch dieselben Boten: »Ich habe also nichts verbrochen, dass ich mit derselben Hoffnung wie ihr, mich zur Seeschlacht entschloss, denn des Entschlusses, nicht des Glückes bin ich Herr.«
131. Im Jahr der Stadt 498 (256 v.Chr.)
[…], denn mit gleichem Eifer auf den Schutz des Eigenen wie auf den Erwerb des Fremden bedacht, kämpften sie mit Mut und Nachdruck. Während nämlich die anderen das Ihrige nach Kräften wahren, an Fremdes aber sich nicht wagen, legten jene auf das Erworbene und das zu Erwerbende gleichen Wert und strengten sich für beides gleichermaßen an. Die Römer erachteten es für vorteilhafter, den Krieg nicht mehr in der Ferne zu führen und auf den Inseln Vorkämpfe zu halten, sondern auf dem eigenen Grund und Boden der Karthager zu streiten, weil ein Verlust ihnen nicht Abbruch tat und ein Sieg nicht bloße Hoffnungen gab, und zogen nach einer ihrem Entschluss entsprechenden Zurüstung in das Feld.
Die Römer zogen nach einer ihrem Entschlüsse entsprechenden Zurüstung gegen Karthago ins Feld. Den Oberbefehl hatten Regulus und Lucius [Manlius], welche ihrer Tapferkeit wegen hierzu ausersehen worden waren. Regulus lebte in solcher Dürftigkeit, dass er sich deshalb anfangs gar nicht vom Haus entfernen wollte und dass seiner Frau und seinen Kindern der Unterhalt aus dem öffentlichen Schatz zuerkannt wurde.
132. Hamilkar schickte, dem Schein nach um des Friedens willen, in der Tat aber um Zeit zu gewinnen, Hanno an die Römer ab. Als jene aber schrien, man solle ihn ergreifen, weil die Karthager Cornelius gefangen genommen hätten, sprach er: »Wenn ihr dies tut, dann werdet ihr um nichts besser als die Afrikaner sein!« Durch diese Schmeichelei am rechten Ort geschah ihm nichts zuleide.
133. Im Jahr der Stadt 499 (255 v.Chr.).
Die Karthager schickten, die Einnahme ihrer Stadt befürchtend, Gesandte an den Konsul,28 um ihn unter günstigen Bedingungen aus ihrem Land zu entfernen und der augenblicklichen Gefahr zu entgehen. Weil sie sich aber nicht dazu verstanden, ganz Sizilien und Sardinien abzutreten, die römischen Gefangenen ohne Lösegeld freizulassen, die ihrigen aber loszukaufen, den Römern alle Kriegskosten zu ersetzen und außerdem einen jährlichen Tribut zu zahlen, richteten sie nichts aus.
Außer dem Angeführten waren auch folgende harte Bedingungen: dass sie ohne Einwilligung der Römer weder Krieg führen, noch Frieden schließen, dass sie selbst nicht mehr als ein Kriegsschiff halten dürften, jenen aber, so oft es verlangt würde, mit 50 Dreiruderern zu Hilfe kommen müssten und anderes mehr, was nicht mit Billigkeit bestehen konnte. Da ein solcher Friede ihnen völlige Vernichtung schien, beschlossen sie, lieber den Krieg fortzusetzen.
134. Als Sparta den Karthagern Hilfstruppen schickte, rügte der Spartaner Xanthos29 gegen die Heerführer der Eingeborenen, dass sie das Heer, das seine Hauptstärke in der Reiterei und den Elefanten hätte, in Gebirgen und sonstigen ungünstigen Örtlichkeiten hielten. Er übernahm den Oberbefehl, stellte die Karthager in Schlachtordnung auf und hatte bald beinahe das ganze römische Heer vernichtet.
135. Er war der Ansicht, dass wer etwas insgeheim tun wolle, es durchaus niemandem sagen dürfe; denn keiner habe sich so in seiner Gewalt, dass er das Gehörte gerne für sich behalte und verschweige; im Gegenteil, je mehr einem verboten sei, etwas zu sagen, desto mehr jucke es ihn, dasselbe auszuschwatzen; so verbreite sich ein Geheimnis, indem es immer einer vom anderen als der einzige Vertraute zu erfahren pflege.
136. Die Karthager, von den Römern bekriegt, hatten sich in kürzester Zeit wieder Waffen und Dreiruderer verschafft; sie schmolzen die Bildsäulen ein und gebrauchten das Metall, verwandten das Holz von öffentlichen und Privatgebäuden zu Dreiruderern und Maschinen und bedienten sich des Haares der Frauen zu Seilen.
137. Im Jahr der Stadt 504 (250 v.Chr.).
Man erzählt, die Karthager hätten teils aus anderen Gründen, teils auch wegen der Menge der Gefangenen Gesandte an die Römer geschickt, besonders aber in der Absicht, unter billigen Bedingungen Frieden zu schließen, und gelänge dies nicht, wenigstens ihre Gefangenen auszulösen. Unter diesen Gesandten soll nun auch Regulus, seines Ansehens wie seiner Vorzüge wegen, geschickt worden sein. Denn sie meinten, die Römer würden in der Hoffnung, ihn zurückzuerhalten, alles zu tun bereit sein, um ihn allein gegen das Zugeständnis des Friedens oder gegen die anderen Gefangenen einzutauschen.
Sie ließen ihn also einen feierlichen Eid schwören, dass er zurückkehren wolle, wenn er nichts von beidem bewirken könne, und ordneten ihn mit den anderen ab. Er nun benahm sich in allem Übrigen wie ein Karthager, nicht wie ein Römer: Er ließ weder seine Frau vor sich noch ging er in die Stadt, weil er ja verbannt sei, und erbat sich, nachdem der Senat außerhalb der Stadt versammelt war, um wie üblich mit Gesandten der Feinde zu unterhandeln, dort, so erzählt man, mit den anderen Gehör.
138. Die Karthager schickten den Feldherrn der Römer, Regulus, den sie gefangen genommen hatten, samt ihren eigenen Gesandten nach Rom, indem sie glaubten, sie würden durch die Vermittlung dieses Mannes billige Friedensbedingungen und die Rückgabe der Gefangenen erlangen. Als er aber ankam, lehnte er die gegen konsularische Männer gebräuchlichen Ehren mit der Erklärung ab, dass er keinen Anteil am Vaterland mehr habe,30 seit ihm das Schicksal die Karthager zu Herren gegeben habe, und riet ihnen, die Friedensanträge zurückzuweisen, da die Feinde bereits selbst an ihrer Rettung verzweifelten. Die Römer bewunderten den Mann, entließen die Gesandten und wollten ihn zurückbehalten. Er aber sagte, er könne nicht in einem Staat bleiben, in welchem er nach den Satzungen des Landes nicht die gleichen Rechte genießen dürfte, die er durch das Gesetz des Krieges anderen zu dienen gezwungen sei, und folgte freiwillig den Karthagern. Dort beendete er unter vielen und schrecklichen Martern sein Leben.
139. Im Jahr der Stadt 514 (240 v.Chr.)
Unter den Konsuln Marcus Claudius und Titus Sempronius wurde zu Rom verordnet, dass nur der älteste Sohn den Zunamen des Vaters führen sollte.31
140. Im Jahr der Stadt 518 (236 v.Chr.)
Die Römer hatten mit den Ligurern Frieden geschlossen. Den Claudius, welcher den Krieg wieder anfing und sie überwand, lieferten sie zum Beweis, dass der Friedensbruch seine, nicht ihre Schuld sei, zuerst diesen aus, und als sie ihn nicht annahmen, verbannten sie ihn.32
141. Im Jahr der Stadt 519 (235 v.Chr.).
Die Römer erneuerten gegen Entrichtung einer Geldsumme den Karthagern den Frieden. Zuerst ließen sie ihre Gesandtschaft unfreundlich an, weil sie sich selbst ihrer vollständigen Rüstung bewusst waren, sich hingegen aber noch immer von nahen Feinden bedrängt sahen. Als aber darauf ein gewisser Hanno, ein in seinen Reden äußerst freimütiger junger Mann, gesandt wurde und dieser nach vielen unverhohlenen Äußerungen damit schloss: »Wenn ihr keinen Frieden wollt, so gebt uns auch Sardinien und Sizilien heraus, denn damit haben wir nicht zeitigen Waffenstillstand, sondern ewige Freundschaft erkauft«, schämten sie sich und wurden milder gestimmt.
142. Im Jahr der Stadt 519 (235 v.Chr.).
[…], jene aber, um nicht dasselbe zu erleiden. Während so die einen gerne das Glück der früheren Siege bewahrten, die anderen sich bei der Gegenwart beruhigten, zauderten beide. Ihren Drohungen nach bestand kein Friede mehr, der Tat nach aber, während sie reiflich überlegten, hielten sie ihn, sodass allen klar war, dass, welcher Teil den anderen reizte, auch das Zeichen zum Krieg geben würde. Denn meist hält man Verträge nur so lange, wie man es zuträglich findet, und der eigenen Bequemlichkeit wegen erscheint es oft sicherer, dem Bündnis nicht zuwiderzuhandeln.33
143. Im Jahr der Stadt 523 (231 v.Chr.).
Es kamen einmal der Kundschaft wegen Gesandte zu Gaius Papirius, obgleich die Römer damals noch nichts von Hispanien wollten. Er nahm sie freundlich auf, leitete ein passendes Gespräch ein und äußerte unter anderem, dass er gegen Hispanien Krieg führen müsste, um die Geldsummen einzutreiben, welche die Karthager den Römern noch schuldeten und sonst auf keine Weise zu bekommen wären. Die Gesandten waren in großer Not, wie viel sie geschätzt werden würden.
144. Im Jahr der Stadt 524 (230 v.Chr.).
Die Insel Issa34 ergab sich freiwillig den Römern. […] Weil sie es damals zuerst mit ihnen versuchen wollten und sie für milder und getreuer als jene hielten, die ihnen erst noch so furchtbar waren. […] Indem sie mehr Zuversicht auf das Unbekannte als auf das Bekannte setzten. […] Teils wegen der gegenwärtigen Bedrängnis, teils wegen der zu erwartenden Zukunft hegten sie gerechte Hoffnung. Die Römer, welche sich den zu ihnen übergetretenen Issäern, um sich in den Ruf zu setzen, dass sie denen, die sich zu ihnen hielten, beizustehen wüssten, sogleich gefällig erzeigten und sich an den Ardiaiern, weil sie die aus Brundisium Absegelnden beunruhigten, rächen wollten, schickten Gesandte an Agron, teils um für jene Fürsprache einzulegen, teils um diesen zur Rede zu stellen, warum er sich ohne Anlass von ihrer Seite Feindseligkeiten erlaube. Sie fanden ihn nicht mehr am Leben; er war mit Hinterlassung eines unmündigen Kindes mit Namen Pinnes gestorben. Seine Gemahlin Teuta, des Pinnes Stiefmutter, welche jetzt über die Ardiaier herrschte, gab denselben nicht nur eine trotzige Antwort, sondern ließ auch, unbesonnen als Frau und übermütig als Königin, einige der Gesandten in Fesseln legen, andere, die allzu freimütig gesprochen hatten, sogar töten.
Dies tat sie und gefiel sich in dem Wahn, sich durch ihre übereilte Grausamkeit das Ansehen von Macht gegeben zu haben. Bald aber verriet sie die Schwäche ihres Geschlechts, das bei beschränkter Einsicht ebenso schnell aufbraust, wie es aus Zaghaftigkeit in Furcht gerät. Sobald sie nämlich erfuhr, dass die Römer Krieg gegen sie beschlossen hätten, erschrak sie, versprach, die Abgesandten herauszugeben, die sie von ihnen hatte, und entschuldigte sich wegen der Getöteten, indem sie vorgab, sie seien von Räubern umgebracht worden. Als die Römer deshalb mit dem Feldzug innehielten und bloß auf die Auslieferung der Täter drangen, wurde sie, weil die Gefahr nicht mehr so nahe war, wieder übermütig, verweigerte die Auslieferung und schickte ein Heer gegen Issa. Als sie aber hörte, die Konsuln35 seien da, sank ihr wieder der Mut; und jetzt wollte sie in all ihre Forderungen einwilligen.
Doch wurde sie nicht ganz zur Besinnung gebracht. Denn als die Konsuln nach Korkyra übergesetzt waren, fasste sie neuen Mut, empörte sich und schickte ein Heer gegen Epidamnus.36 Da aber die Römer die Städte entsetzten und ihre mit Schätzen beladenen Schiffe wegnahmen, wollte sie sich von Neuem bequemen. Als sie aber bei der Überfahrt beim Berge Alyrius zu Schaden kamen, besann sie sich wieder anders, indem sie hoffte, dass sie, da es bereits Winter war, heimkehren würden. Auf die Nachricht aber, dass Albinus im Land bleibe und Demetrius37 wegen ihres sinnlosen Betragens und aus Furcht vor den Römern abgefallen sei und auch andere zum Übertritt beredet habe, geriet sie in die größte Angst und legte die Regierung nieder.
145. Im Jahr der Stadt 529 (225 v.Chr.).
Die Römer schreckte ein Sibyllenspruch, der sie vor den Galliern sich in Acht nehmen hieß, wenn ein Blitz in das Capitol nahe dem Apollotempel eingeschlagen haben würde. Die Gallier aber verloren den Mut, als sie die günstigsten Punkte von den Römern besetzt sahen. Die Menschen wagen sich, wenn sie das, wonach sie trachteten, erreicht haben, immer mit größerem Vertrauen an das Übrige; wenn es ihnen aber hier fehlschlägt, so werden sie für alles abgestumpft. Die Gallier aber, vor anderen auf die Erreichung ihrer Wünsche erpicht, verfolgen ihr Glück aufs Tapferste, wenn sie aber auch nur das geringste Hindernis finden, so geben sie die Hoffnung auch für das Übrige auf. In ihrer Unbesonnenheit dünkt ihnen jeder Wunsch erfüllbar, sie verfolgen ihre Pläne mit größter Leidenschaft und geben sich blindlings ihrem wütenden Ungestüm hin. Deshalb hat auch bei ihnen nichts Bestand. Denn unmöglich reicht tollkühner Wagemut lange aus. Sind sie aber einmal umgestimmt, so finden sie sich, zumal wenn noch Furcht hinzukommt, nicht mehr zurecht und geraten ebenso sehr in Bestürzung, wie sie früher furchtlose Kühnheit gezeigt hatten. Denn durch leichte Anregung werden sie plötzlich auf das Gegenteil geführt, da sie sich nicht nach feststehenden Vernunftgründen für das eine oder das andere entscheiden.
146. Im Jahr der Stadt 529 (225 v.Chr.).
Aemilius triumphierte über die besiegten Insubrer und führte dabei die Vornehmsten der Gefangenen aus Hohn bewaffnet auf das Capitol, weil er erfuhr, dass sie geschworen hatten, nicht früher ihre Panzer abzulegen, als bis sie das Capitol erstiegen hätten.
147. Im Jahr der Stadt 531? (223 v.Chr.).
Wenn bei feierlichen Versammlungen auch nur das geringste Versehen vorkam, wurden sie zum zweiten, dritten oder noch öfteren Mal wiederholt, bis sie glaubten, dass alles ohne Fehl geschehen sei.
148. Die Römer waren im Krieg berühmt und lebten unter sich in Eintracht. Während die meisten übermäßiges Glück zum Übermut und große Furcht zur Nachgiebigkeit führt, war bei ihnen das Gegenteil der Fall. Je glücklicher sie waren, desto gutmütiger wurden sie. Den Trotz der Tapferkeit zeigten sie gegen Feinde, im Verkehr unter sich aber Ruhe und Mäßigung. Ihre Kraft betätigten sie in Übung der Billigkeit, ihre Sittsamkeit in Erwerbung echter Tapferkeit, indem weder ihr Glück in Übermut noch ihre Nachgiebigkeit in Feigheit umschlug. So waren sie denn damals gemäßigt aus Tapferkeit. Denn sie meinten, dass Übermut durch Übermut untergehe, dagegen Mäßigung durch Tapferkeit sicherer und das Glück durch Ordnungsliebe dauerhafter werde. Und deswegen führten sie auch die gegen sie ausbrechenden Krieg mit dem glücklichsten Erfolg und verwalteten ihre und der Bundesgenossen Angelegenheiten auf das Beste.
149. Im Jahr der Stadt 535 (219 v.Chr.).
Durch die Vormundschaft über Pinnes und die Vermählung mit dessen Mutter Triteuta nach Teutas Tod übermütig, bedrückte Demetrius die Eingeborenen und verheerte das Gebiet der Grenznachbarn. Als die Römer, deren Freundschaft er zu diesen Bedrückungen zu missbrauchen schien, dies erfuhren, luden sie ihn vor. Da er nicht gehorchte, sondern sogar ihre Bundesgenossen angriff, zogen sie gegen ihn nach Issa zu Felde.
150. Im Jahr der Stadt 535 (219 v.Chr.).
Alle Völker diesseits der Alpen schlossen sich an die Karthager an, nicht dass sie die Karthager lieber zu Herren wollten als die Römer, sondern weil sie jede Herrschaft hassten und das noch Unversuchte liebten. Alle Völkerschaften waren mit den Karthagern gegen die Römer verbündet. Alle aber wog, sozusagen, Hannibal auf. Mit dem schärfsten Blick wusste er alles, was er wünschte, […] durchzuführen. Das eine erfordert Stetigkeit, das andere schnellen Entschluss und augenblickliche Ausführung […] und er war seines Erfolgs so sicher, dass er ihn sogar verbürgen konnte. Die gegenwärtigen Umstände nützte er mit Sicherheit und die Zukunft, […] über das Gewöhnliche der tüchtigste Ratgeber und der bestimmteste Vorherseher unerwarteter Ereignisse, weswegen er sie, wenn sie eintraten, aufs Schnellste und Geschickteste benutzte und die Zukunft wieder im Voraus in seinen Gedanken durchschaute. Daher wusste er auch unter allen am besten Reden und Handlungen den Umständen anzupassen, indem er den Besitz und das zu Hoffende gleich sehr in Anschlag brachte. Dies konnte er aber, weil er, außer seinen vortrefflichen Naturanlagen, nach Landessitte in punischer und selbst in griechischer Wissenschaft nicht unbewandert war, auch sich auf die Deutung der Eingeweide verstand. Diesen Geistesvorzügen entsprach auch sein teils von Natur, teils durch Lebensweise erstarkter Körper, sodass es ihm leicht war, alles, was er unternahm, zu Ende zu bringen. Denn er besaß Gewandtheit und Kraft in höchstem Grad. Er konnte deshalb ohne Beschwerde laufen, stehen und im gestrecktesten Galopp reiten. Nie fühlte er sich durch Speise überladen, nie durch Entbehrung erschöpft. Beides, das zu Viele und das zu Wenige, schien bei ihm das rechte Maß. Mühsale gaben ihm Spannkraft, Nachtwachen Stärkung.
Bei solchem Geist, solchem Körper war sein Benehmen in Geschäften folgendes: Überzeugt, dass die meisten ihm nur des Vorteils wegen treu seien, stellte er sich mit ihnen auf gleichen Fuß und hegte gegen sie den gleichen Verdacht, sodass er andere oft mit Erfolg hinterging und äußerst selten durch Überlistung zu Schaden kam. Da er jeden, der ihm schaden wollte, mit größter Härte strafte, indem er es vorteilhafter fand, Unrecht zu tun, als zu leiden, und wollte, dass andere in seiner, nicht er sich in der Gewalt anderer befände.