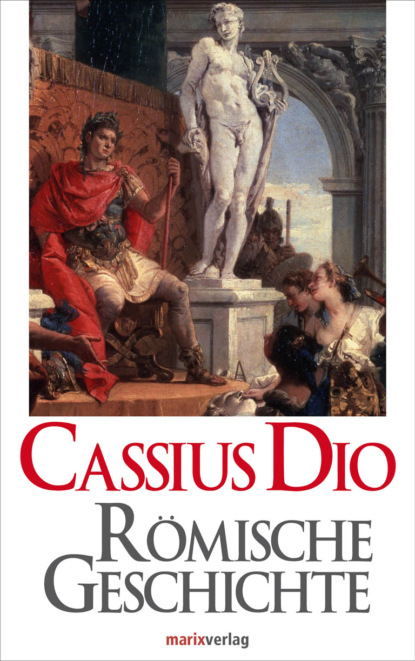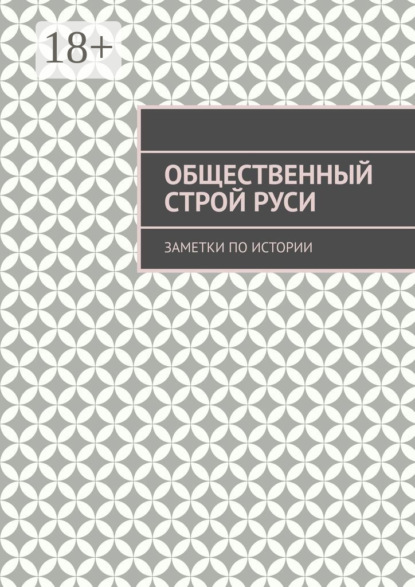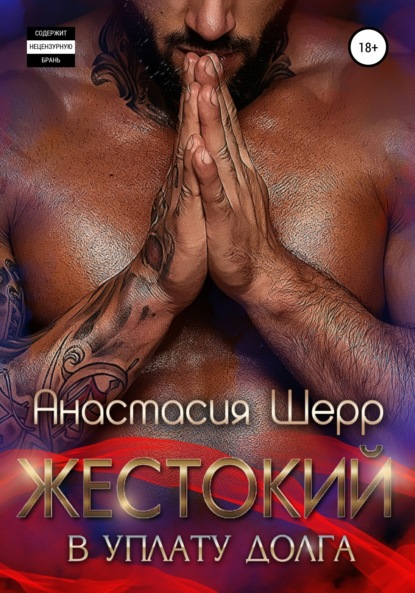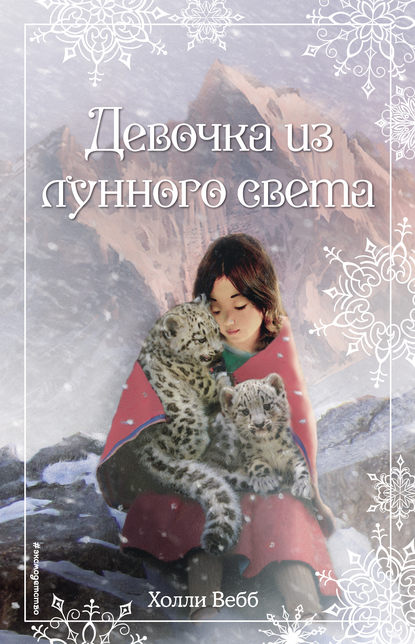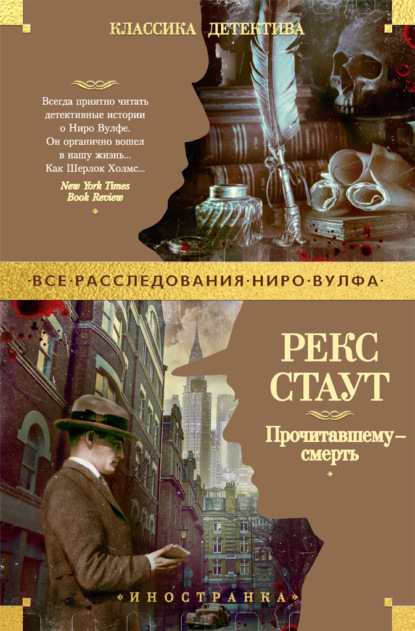- -
- 100%
- +
Überhaupt sah er mehr auf das Wesentliche an den Dingen als auf Berühmtheit, wenn sich nicht beides vereinigen ließ. Wen er nötig fand, den ehrte er sogar im Übermaß. Denn Sklaven der Ehrbegierde waren in seinen Augen die meisten, und die Erfahrung lehrte ihn, dass sie sich darum, selbst gegen ihren Vorteil, freiwillig in Gefahren stürzten, weshalb er sich oft Gewinn und Genuss versagte, um jenen beides in reichsten Maße zuzuweisen und sie dadurch zu freiwilligen Teilnehmern seiner Mühsale zu machen. Er teilte aber nicht nur die gleiche Kost, sondern auch die Gefahren mit ihnen, indem er allem, was er von ihnen forderte, sich zuerst unterzog; denn so, glaubte er, würden ihm jene, nicht durch bloße Worte befeuert, freiwillig und ohne Widerrede folgen. Gegen die Übrigen bediente er sich immer eines herrischen Tons, sodass ihm die einen, weil er sich in der Lebensart ihnen gleichsetzte, ergeben waren, andere ihn seines Hochmuts wegen fürchteten. Daher vermochte er den Übermütigen zu bangen, den Demütigen zu erheben, dem einen Furcht, dem anderen Vertrauen, dem Hoffnung, jenem Verzweiflung über die wichtigsten Dinge in kürzester Zeit, wie er nur wollte, einzuflößen.
Dass dies nicht ohne Grund von ihm behauptet wird, sondern wahr ist, beweisen seine Handlungen. Den größten Teil Hispaniens eroberte er in kurzer Zeit und trug von dort den Krieg durch das Land der Gallier, nicht nur nicht befreundeter, sondern selbst unbekannter Völker, nach Italien. Unter allen Nichteuropäern ging er, unseres Wissens, zuerst mit einem Heer über die Alpen, zog auf Rom los und riss fast alle Bundesgenossen teils durch Gewalt, teils durch Überredung von diesem los. Und dies tat er allein, für sich und ohne Mitwirkung der Karthager; denn er war weder anfangs von den heimischen Obrigkeiten ausgeschickt noch auch später von ihnen bedeutend unterstützt worden. Obgleich sie von ihm nicht geringen Ruhm und Vorteil ernteten, wollten sie doch mehr, sich den Schein geben, ihn nicht zu verlassen, als ihn nachdrücklich unterstützen.
151. »Der Friede erwirbt und erhält den Besitz, der Krieg dagegen verzehrt und verschwendet ihn.«38 – »Der Mensch fühlt einen natürlichen Trieb, über Untergebene zu herrschen und die Gunst des Glücks gegen solche, die freiwillig nachgeben, geltend zu machen. […] Uns aber, glaubt ihr, die ihr es wisst und erfahren habt, genüge gegen euch zur Sicherheit Nachgiebigkeit und Milde? Was Ihr uns heimlich oder mit Gewalt entführt habt, sollen wir für nichts erachten, uns nicht zur Wehr setzen, nicht vergelten, uns nicht rächen? Und zwar […] denken, dass ihr diese Dinge mit allem Fug gegeneinander tut, gegen die Karthager aber müsst ihr menschlich und ehrenhaft handeln. – Denn gegen Bürger muss man billig und bürgerlich verfahren. – Wenn einer wider Erwarten gerettet wird, so ist dies unsere Sache, bei den Feinden aber handelt es sich um Sicherheit; denn unsere Rettung hängt nicht davon ab, dass wir sie zu unserem Nachteil verschonen, sondern dass wir sie besiegen und schwächen.
152. »Der Krieg erhält oft das Eigentum und gewinnt noch das Fremde; der Friede aber lässt nicht nur das durch jenen Erworbene verloren gehen, er geht selbst mit verloren.« – »Es bringt Schande, vor der Überlegung sogleich zur Tat zu schreiten; denn habt ihr guten Erfolg, so hättet ihr mehr Glück als Verstand, habt ihr aber schlechten, so schilt man euch unbesonnen, weil ihr nichts ausgerichtet habt. Wer weiß nicht, dass Schimpfen und Klagen über solche, die uns bekriegt haben, leicht und jedermanns Sache ist; den Vorteil der Stadt selbst aber nicht nach dem Unwillen, den man fühlt über das, was einige getan haben, sondern nach dem Nutzen allein, den sie davon hat, zu ermessen, ist Pflicht des Ratgebers. Treibe und berede uns, Lentulus, nicht zum Krieg, bevor du uns dessen Nutzen dargetan hast, und bedenke vor allem, dass es etwas anderes ist, hier von Kriegsangelegenheiten zu schwatzen, und selbst auf dem Schlachtfeld mitzukämpfen.
Viele bringen Unglücksfälle zu Recht; oft kommen solche durch gute Ausnutzung derselben am Ende besser an, als diejenigen, die sich eines beständigen und vollkommenen Glücks erfreuten und eben darum übermütig wurden. Denn das Unglück scheint oft sehr heilsam, weil es die Menschen nicht mutwillig und übermütig werden lässt. Am besten aber ist es immerhin, wenn man von Natur einen Trieb zu dem Besseren hat und die Befriedigung der Begierde nicht nach der Macht, sondern nach der Vernunft bemisst. Wenn aber einer keine Neigung für das Bessere hat, so frommt es ihm, selbst wider seinen Willen zur Besinnung gebracht zu werden, sodass man es sich zum Glück rechnen darf, wenn man nicht immer glücklich ist.
Man muss auf der Hut sein, um nicht das Gleiche zum zweiten Mal zu erfahren. Das ist oft der einzige Nutzen, den einer aus dem Unglück zieht; denn nicht selten trügen Glücksfälle die, welche unbesonnen genug sind, sich der Hoffnung hinzugeben, dass sie zum zweiten Mal obsiegen werden. Unfälle aber nötigen jeden, aus der Erfahrung belehrt, einen sicheren Blick in die Zukunft zu tun. – Nicht wenig gewinnt uns die Gnade der Götter und den Ruhm vor den Menschen, wenn wir im Rufe stehen, dass wir nicht freiwillig Krieg anfangen, sondern genötigt werden, uns der Angreifenden zu erwehren.«
Nachdem man solcherlei Reden von beiden Seiten gehalten hatte, wurde für gut befunden, sich zum Krieg zwar zu rüsten, ihn aber nicht zu beschließen, sondern Gesandte nach Karthago zu schicken, um gegen Hannibal Klage zu führen. Wenn sie das von ihm Geschehene missbilligten, ihn zur Rechenschaft zu fordern. Schöben sie aber die Schuld auf jenen, seine Auslieferung zu verlangen und, wenn sie ihn auslieferten, ruhig zu bleiben, wenn nicht, ihnen den Krieg anzukündigen.
Als die Karthager den Gesandten keine bestimmte Antwort gaben, sondern wenig Kenntnis von ihnen nahmen, schlug Marcus Fabius39 die Hände unter das Gewand und hob sie auf mit den Worten: »Ich bringe euch hier den Krieg und den Frieden, Karthager; wählt mit offenen Augen, welchen ihr haben wollt.« Als aber jene darauf antworten, dass sie keinen von beiden wählten, sondern nähmen, was sie ihnen übrig ließen, kündigte er ihnen den Krieg an.
Die Römer forderten die Arbornesen40 zur Bundesgenossenschaft auf; diese aber erwiderten, dass ihnen von den Karthagern nichts zuleide noch von den Römern etwas zuliebe geschehen sei, um gegen jene Krieg zu führen oder diesen beizustehen; ja sie waren über sie höchst aufgebracht, indem sie ihnen vorhielten, dass sie ihren Stammgenossen mancherlei Unbilden angetan hätten.
153. Diese Erwartung hegten, wie Dio sagt, Römer und Karthager, und sie hatten ihren Hass für den Beginn des Krieges auf das Höchste gesteigert. – Hoffnung treibt alle Menschen zur Begierde und lässt sie mit mehr Mut und Sicherheit auf den Sieg vertrauen; die Niedergeschlagenheit aber treibt zum Kleinmut und zur Verzweiflung und raubt die Stärke der Tapferkeit. – Wie nun immer Unsicherheit und Ungewissheit viele in Unruhe zu versetzen pflegten, so flößten sie auch den Hispaniern nicht geringe Furcht ein. – Denn die Menge, die nicht aus eigenen Gründen, sondern der Bundesverwandtschaft wegen zu Felde zieht, hat meist nur so lange Mut, wie sie ohne Gefahr auf Gegendienste hoffen darf; wenn sich aber Kämpfe nahen, da schwinden ihre Hoffnungen auf Vorteil und sie weiß nichts mehr von ihren Versprechungen. Sie beredet sich, überall habe sie alles schon bestens ausgeführt, wenn sie aber irgendwo minder glücklich war, so gilt ihr dies nichts gegen die Hoffnungen, die sie gehegt hatte.
154. Als für das zahllose Heer keine Vorräte zureichen wollten und ihm einer deshalb riet, die Soldaten mit dem Fleisch der Feinde abzuspeisen, fand er den Vorschlag nicht abscheulich, sondern befürchtete nur, sie würden, wenn es ihnen an Feinden fehlte, einander selbst aufzehren.
155. Im Jahr der Stadt 536 (218 v.Chr.)
Vor der Schlacht rief Hannibal seine Soldaten zusammen, führte die auf dem Zug Gefangenen vor und fragte diese, ob sie lieber in Fesseln und schimpflicher Knechtschaft leben oder im Zweikampf einander gegenübertreten und als Sieger ohne Lösegeld entlassen werden wollten? Als sie das Letztere wählten, ließ er sie aufeinander los und, als sie miteinander kämpften, sprach er: »Ist es nicht eine Schande, Soldaten, dass eure Gefangenen so tapferen Sinnes sind, dass sie lieber sterben als in Knechtschaft leben wollen, ihr aber dafür, dass ihr nicht anderen dienet, vielmehr über sie herrschet, irgendeine Mühsal, eine Gefahr zu bestehen euch scheut?«
156. »Wer einmal besiegt worden ist, hat immer eine Scheu vor dem Sieger und wagt nicht mehr, seinen Sinn wider ihn zu erheben. […] Furchtsames und unzuverlässiges Volk, alle diese Gallier; wie es schnell sich bei Hoffnungen ermutigt, so wird es noch schneller in Furcht und Schrecken gesetzt […].« – »Was wir vom Feind besiegt erlitten, das wollen wir ihm als Sieger vergelten. Denn bedenkt wohl, dass wir als Sieger all das Vorerwähnte erhalten, als Besiegte aber nirgends eine sichere Zuflucht finden; denn dem Sieger ist, wenn man ihn auch hasst, alles alsbald befreundet; der Besiegte dagegen wird von allen, selbst seinen Freunden, verlassen.
157. Im Jahr der Stadt 537 (217 v.Chr.).
Von vielen teils wahren, teils fälschlich vorgegeben Schreckenszeichen wird berichtet. Wenn die Leute nämlich in heftige Angst geraten und sich ihnen eine ungewöhnliche Erscheinung zeigt, so deuten sie diese oft in etwas ganz anderes um, und sobald einmal etwas davon geglaubt wird, werden sogleich auch schon […]. Also die Opfer und das andere […] zur Sühne und zu […] gewohnt sind zu tun. Anderes […] solchem gegen die bessere Überzeugung ihrer Hoffnung wegen Glauben schenkten; und damals, wenn sie auch mehr wegen der Größe der erwarteten Gefahr glaubten, dass auch das Härteste davon […] werden besiegt werden.
158. Sei es, um dem Fabius, als einem Freund der Karthager, gefällig zu sein oder um ihn verdächtig zu machen, ließ er nichts von seinen Gütern beschädigen. Als daher bei einem Gefangenenaustausch zwischen den Römern und den Karthagern ausbedungen wurde, dass das Mehr auf der einen oder anderen Seite mit Geld gelöst werden sollte, aber die Römer sie aus dem öffentlichen Schatz nicht loskaufen wollten, so verkaufte Fabius seine Grundstücke und zahlte das Lösegeld für sie.
»Denn ich werde angeklagt, nicht dass ich übereilt in den Kampf gehe oder gefahrvolle Unternehmungen mache, um nach dem Verlust vieler Soldaten und der Erlegung gleich vieler Feinde als Imperator begrüßt zu werden und einen Triumph zu feiern, sondern weil ich zögere und zaudere und auf eure Erhaltung stets eifrigst bedacht bin.«41
»Ist es denn nicht widersinnig, das Auswärtige und Entfernte in gutem Stande zu wünschen, ehe man die Stadt selbst in Ordnung bringt? Ist es nicht töricht, über die Feinde siegen zu wollen, bevor man die eigenen Angelegenheiten beigelegt hat?«
»Wohl weiß ich, dass meine Rede euch hart erscheint; bedenket aber, dass auch die Ärzte viele nur dadurch allein heilen können, dass sie sie trennen und schneiden; und dann, dass es mir nicht Freude und Vergnügen macht, also zu sprechen, ja dass ich eben darum euch schelte, dass ihr mich zu solchen Reden nötigt, wenn ihr sie aber nicht gerne hört, so tut nicht Dinge, für die man euch nicht loben kann; wenn meine Worte einige von euch schmerzen, wie sollten nicht vielmehr mich und die anderen alle eure Handlungen schmerzen?«
»Denn die Sprache der Wahrheit enthält etwas Bitteres, wenn einer mit kühnem Freimut großer Güter Hoffnung hinweg nimmt; die Lügenworte des Schmeichlers dagegen haben den Beifall der Zuhörer.«
Die Römer setzten ihn deshalb zwar nicht ab, gaben aber dem Reiterobristen dieselbe Gewalt, sodass beide den gleichen Oberbefehl haben sollten. Fabius trug jedoch darüber weder Hass gegen die Mitbürger noch gegen Rufus. Er verzieh ihnen menschliche Schwachheit und war zufrieden, auf welche Weise sie auch siegen würden. Denn die Rettung und der Sieg des Vaterlands, nicht der eigene Ruhm waren seiner Wünsche Ziel; das Verdienst, glaubte er, liege nicht in Volksbeschlüssen, sondern in der Seele eines jeden, und Sieg oder Niederlage hänge nicht von Verordnungen, sondern von eines jeden Geschick oder Unerfahrenheit ab.
Rufus dagegen, schon früher nicht recht klug, wurde jetzt noch aufgeblasener, und konnte, da er, als Lohn seines Ungehorsams, gleiche Gewalt mit dem Diktator erlangt hatte, sich nicht mehr fassen, sondern verlangte, einen Tag um den anderen oder auch mehrere hintereinander den alleinigen Oberbefehl. Fabius aber, welcher fürchtete, er möchte, des ganzen Heeres mächtig, einen unbesonnenen Schritt tun, gestand ihm keines von beiden zu, sondern teilte das Heer, sodass sie gleich den Konsuln jeder seine eigenen Truppen hatten. Sogleich trennten sie die Lager, um durch die Tat deutlich zu machen, dass er für sich befehle und nicht mehr unter dem Diktator stehe.
Die Diktatoren, zufrieden, wenn […] veränderten, auf die Nachricht, dass Hannibal sich von seinem Zug nach Rom abgewendet habe und nach Campanien marschiere, gleichfalls in der Stille, nicht gar gerne, doch auch nicht gezwungen, der Sicherheit wegen ihren Standort.
Fabius war mehr auf die Sicherheit als auf gefährliche Wagnisse bedacht und traute sich nicht, mit Meistern in der Kriegskunst handgemein zu werden, da ihm vor allem daran lag, seine Soldaten, zumal bei der geschwächten Bevölkerung des Vaterlands, zu schonen, indem er nicht die Niederschlagung der Feinde, sondern den Verlust der eigenen Leute hoch veranschlagte. Jene, meinte er, würden, auch geschlagen, bei ihrer Überzahl wieder den Kampf bestehen. Er aber hielt auch den geringsten Verlust nicht wegen der Zahl der Gefallenen, sondern wegen der Größe der früheren Verluste für höchst bedenklich. Wenn alles in unverletztem Zustand sei, meinte er, verschmerze man oft die größten Unfälle mit Leichtigkeit, nach Verlusten aber werde auch der kleinste Nachteil verderblich. Als ihm daher sein Sohn zu einer gefährlichen Unternehmung riet und sagte, es könnten nicht über 100 Mann draufgehen, blieb er unbewegt und fragte ihn, ob er selbst unter diesen 100 sein wollte.
Fabius Sohn sprach zu seinem Vater: »Schlagen wir uns mit Hannibal, wir verlieren keine 100 Mann.« Da erwiderte ihm dieser: »Und wolltest Du unter den 100 sein?«
Die Karthager schickten Hannibal aus freien Stücken nicht nur keine Unterstützung, sondern fanden es sogar lächerlich, dass er trotz der glücklichen Erfolge, von denen er schreibe, noch Geld und Soldaten verlangte, und meinten, seine Forderungen stünden mit seinen Siegen im Widerspruch. Denn die Sieger mussten mit dem gegenwärtigen Heer auskommen und Geld nach Hause schicken, nicht beides aus der Heimat haben wollen.
Die Menge ist gewohnt, Anfänger zu begünstigen, besonders wenn sie die bereits im Ruhme Stehenden herabzusetzen suchen. Denn sie ist geneigt, dem kaum sich Erhebenden beizustehen, das hoch Erhabene niederzudrücken. Denn das hohe Verdienst erreicht einer nicht so leicht, unverdiente Erhöhung aber gibt auch anderen Hoffnung, zu gleichem Glück zu gelangen.
Rufus, zu gleicher Gewalt mit dem Diktator erhoben und von den Karthagern geschlagen, wurde anderen Sinnes; denn das Unglück bringt einen, der nicht völlig töricht ist, zur Besinnung. Er legte freiwillig den Oberbefehl nieder und wurde dafür sehr gerühmt. Dass er nicht anfangs gleich vernünftig war, brachte ihm nicht Schande, Ruhm aber, dass er nicht zögerte, sein Unrecht einzugestehen. Wäre er von Anbeginn an seiner Pflicht nachgekommen, so hätten sie es für ein Werk des Glücks gehalten; dass er aber, durch die Erfahrung eines Besseren belehrt, sich nicht schämte, seinen Sinn zu ändern, lobten sie sehr: Hierin zeige sich, wie viel ein Mann von dem anderen, wahre Tugend von Dünkel sich unterscheide. Was Missgunst und Verleumdung bei den Bürgern dem Fabius entrissen hatten, das erhielt er wieder aus freien Stücken und selbst auf die Bitte des Amtsgenossen.
Als er seinen Oberbefehl niederlegen wollte, berief er die Konsuln und übergab ihn denselben, indem er ihnen alles darlegte, was sie ohne Gefährdung vornehmen dürften. Ihm stehe, sagte er, das Wohl des Staates höher als der Ruhm des alleinigen Oberbefehls; von ihnen hoffe er, dass sie, ihren Vorgang wahrnehmend, nicht durch Eigensinn zu Fall kommen, sondern auf gleichem Wege mit ihnen zu Glück und Ruhm gelangen würden. Die Konsuln, dem Rat des Fabius gehorchend, unternahmen nichts Gewagtes und blieben, für besser erachtend, keine Kriegstat zu verrichten als sich Verlusten auszusetzen, die ganze Zeit ihres Konsulats in ihren Standorten.
Über Wahrsagerei und Sterndeutung sagt Dio Folgendes: Ich erlaube mir weder über diese noch über andere Vorhersagen ein Urteil. Denn was braucht es eines Vorzeichens, wenn etwas auf jeden Fall geschieht? Keine menschliche Kunst, keine göttliche kann es abwehren. Jeder mag darüber denken, wie er will.
159. Im Jahr der Stadt 538 (216 v.Chr.)
Konsuln waren Paulus und Terentius, Männer, durch Geschlecht und Charakter gleich verschieden; der eine, Patrizier und hochgebildet, zog das Sichere vorschnellen Entschlüssen vor und ließ sich, zumal durch die Beschuldigung niedergebeugt, die ihm in seinem früheren Konsulat gemacht worden war, auf nichts Gewagtes ein und wollte lieber nicht durch kühne Tat siegen, als sich einem zweiten Unfall aussetzen. Terentius, unter dem Volk erzogen und in gemeiner Vermessenheit geübt, war auch sonst wohl übermütig, jetzt aber versprach er, allem den Ausschlag im Krieg zu geben, schmähte die Patrizier und glaubte wegen der Milde seines Amtsgenossen, allein den Oberbefehl zu führen. Daher kamen beide zu guter Zeit im Lager an; dem Hannibal fehlte es an Lebensmitteln, in Hispanien stand es schlimm, und die Bundesgenossen fielen von ihm ab, sodass sie ihn, hätten sie nur noch ein wenig gewartet, ohne Mühe besiegt hätten. So aber besiegte sie die Unbesonnenheit des Terentius und die Nachgiebigkeit des Paulus, der zwar immer das Rechte wollte, aber meist seinen Amtsgenossen gewähren ließ; denn Milde pflegt gegen Anmaßung immer benachteiligt zu werden.
Im Kampf hatten selbst die Mutigsten wegen des ungewissen Ausgangs weniger Hoffnung als Furcht; je mehr sie auch zu siegen glaubten, desto mehr fürchteten sie, es möchte nicht gelingen. Den Unwissenden erscheint in ihrer Betörung nichts furchtbar, der überlegte Mut dagegen […].
Um den Bürgern Karthagos die Niederlage der Römer anschaulich zu machen, ließ Hannibal drei Attische Scheffel voll goldener Ringe den Rittern und Senatoren, welche sie nach herkömmlicher Sitte zu tragen pflegten, bei der Plünderung der Leichen der Gefallenen abziehen und in den Hafen senden.
160. Als Scipio42 erfuhr, dass einige Römer damit umgingen, Rom und Italien, weil es nun bald den Karthagern gehören müsste, zu verlassen, stürzte er plötzlich mit gezücktem Schwert in das Haus, worin sie sich berieten, schwor, mit Wort und Tat seine Pflicht zu tun, und zwang jene zu demselben Schwur unter Androhung augenblicklichen Todes, wenn sie sich weigern würden. […]
Sie schrieben jetzt einstimmig an den Konsul, dass sie sich gerettet hätten. Dieser aber schrieb nicht sogleich nach Rom noch sandte er einen Boten ab, sondern begab sich nach Canusium, verfügte daselbst das Nötige, legte in die benachbarten Städte Besatzungen, so viel er konnte, und trieb die Reiterei, welche einen Angriff auf die Stadt machte, zurück. Überhaupt war er weder entmutigt noch bestürzt, sondern riet und tat, als ob ihnen kein Unglück begegnet wäre, mit reifer Überlegung das, was er im Augenblick für das Beste hielt.
161. Die Nuceriner hatten sich unter der Bedingung dem Hannibal ergeben, dass jeder mit einem Kleid aus der Stadt ziehen dürfte. Als er sie aber in seiner Gewalt hatte, ließ er die Senatoren in Badehäuser einschließen und ersticken, den anderen erlaubte er zwar zu gehen, wohin sie wollten, allein auch von ihnen tötete er viele auf dem Weg. Dies kam ihm jedoch nicht zustatten; denn die anderen ergaben sich aus Furcht vor ähnlichem Schicksal nicht mehr, sondern leisteten, solange sie konnten, Widerstand.
162. Marcellus, ein Mann von großer Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit, war gegen seine Untergebenen nicht immer streng und hart noch sah er besonders genau darauf, auf welche Art sie ihre Pflicht taten. Wenn einer sich etwas zuschulden kommen ließ, so verzieh er es der menschlichen Schwachheit und zürnte ihnen nicht, dass sie es ihm nicht gleichtaten.
163. Da viele in Nola die bei Cannae Gefangenen und von Hannibal Freigelassenen als seiner Seite zugetan fürchteten und umbringen wollten, widersetzte er sich und gewann sie dadurch, dass er den gegen sie allgemein gehegten Verdacht nicht zu teilen vorgab, derart, dass sie zu ihm hielten und ihrem Vaterland wie den Römern äußerst nützlich wurden.
164. Eben dieser Marcellus hörte von einem lukanischen Ritter, dass er in ein Mädchen verliebt sei, und erlaubte ihm, seiner Tapferkeit wegen, dieselbe im Lager bei sich zu haben, obgleich er verboten hatte, dass eine Frau die Verschanzungen betrete.
165. Hannibal verfuhr gegen die Acerraner auf gleiche Weise wie gegen die Nuceriner, nur dass er ihre Senatoren in Brunnen, nicht in Bäder warf.
166. Fabius wechselte die in den früheren Schlachten Gefangenen teils Mann gegen Mann aus, teils verglich er sich mit Hannibal, sie mit Geld einzulösen. Als aber der Senat die Kosten nicht übernehmen wollte, weil er überhaupt deren Auslösung nicht billigte, ließ er, wie schon erwähnt, seine eigenen Güter versteigern und kaufte sie mit dem Erlös frei.
167. Die Römer ließen Hannibal durch Abgesandte einen Gefangenenaustausch anbieten. Dieser kam jedoch nicht zustande, obgleich auch jener zu diesem Zweck den Carthalo abgeschickt hatte; denn da sie ihn, als Feind, nicht in die Mauern lassen wollten, verschmähte er eine Unterhandlung mit ihnen und kehrte sogleich voller Wut wieder um.
168. Ptolemaios,43 König von Ägypten, wäre beinahe durch einen Aufstand aus dem Land vertrieben worden; als er aber wieder zu Kräften kam, rächte er sich durch abscheuliche Strafen am Volk, indem er die Körper der Besiegten sieden und braten ließ. Bald darauf aber büßte er für seine Grausamkeit, indem er durch eine schreckliche Krankheit ums Leben kam.
169. Unter Ptolemaios Epiphanes teilte Jesus, Sirachs Sohn, den Juden seine tugendreiche Weisheit mit.
170. Scipio, der Retter seines verwundeten Vaters, jetzt Feldherr, verband mit trefflichen Naturanlagen die ausgezeichnetste Bildung. Er zeigte im Rat und in Reden, wie es erforderlich war, großen Verstand, vor allem aber wusste er ihn im Handeln zu betätigen. Daher war es nicht leere Prahlerei, sondern nachhaltige Geistesstärke, wenn er sich als Mann großer Pläne und Taten gab.
Aus diesen Gründen und wegen seiner gewissenhaften Verehrung der Götter wurde er erwählt. Denn er nahm keine öffentliche, keine Familienangelegenheit vor, ohne vorher auf das Capitol zu gehen und einige Zeit daselbst zu verweilen. Deshalb ging die Sage von ihm, er sei ein Sohn Iupiters, der seiner Mutter in Gestalt eines Drachen beigewohnt habe; auch dies erhöhte die Hoffnungen vieler auf ihn.
Obgleich auf nicht ganz gesetzlichem Wege zum Oberbefehl gelangt, erwarb er sich doch sogleich nach seiner Wahl die Liebe des Heeres, übte die durch Untätigkeit erschlafften Soldaten, welche ohne Anführer waren, und hob den Mut der durch die früheren Unglücksfälle Niedergedrückten. Auch behandelte er den Marcius, weil er sich Ruhm erworben hatte, nicht unfreundlich, wie es viele getan hätten, sondern zeichnete ihn durch Lob und tätige Beweise seiner Achtung aus. Denn er war nicht der Mann, der sich durch Verleumdung und Herabsetzung anderer, sondern durch eigenes Verdienst erheben wollte; und dadurch gewann er auch die Ergebenheit der Soldaten in so hohem Grade.
Scipio bewirkte ebenso durch sein rechtliches Benehmen, wie durch seine Waffen, dass beinahe das gesamte Hispanien zu ihm übertrat.
171. Im Jahr der Stadt 544 (210 v.Chr.).
Nach der Eroberung von Neukarthago wäre beinahe ein höchst bedenklicher Zwiespalt unter den Soldaten ausgebrochen. Scipio hatte dem, der zuerst die Mauer erstiege, einen Kranz verheißen, und zwei Soldaten, ein Römer und ein Bundesgenosse, stritten um denselben. Über ihrem Streit geriet auch die übrige Masse in Aufregung und in solchen Tumult, dass es übel abgelaufen wäre, hätte nicht Scipio beide bekränzt und einen großen Teil der Beute unter die Soldaten verteilt, einen großen Teil aber für den öffentlichen Schatz bestimmt. Die Gefangenen verteilte er auf die Flotte und gab die Geiseln ohne Lösegeld den Ihrigen zurück. Dies hatte die Wirkung, dass ihm viele Völker und Fürsten und unter diesen die beiden Ilergetaner Idibolis und Mandonius zu ihm übertraten.