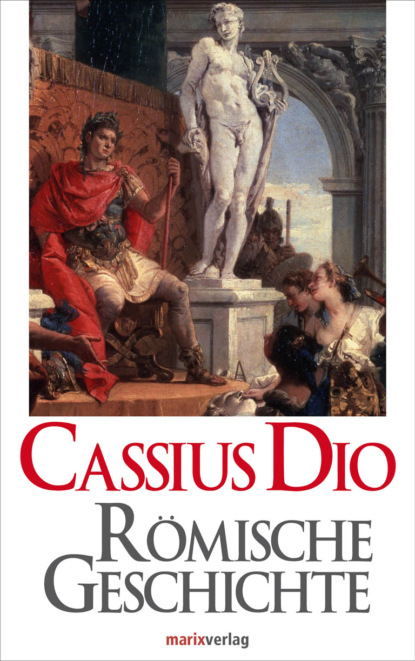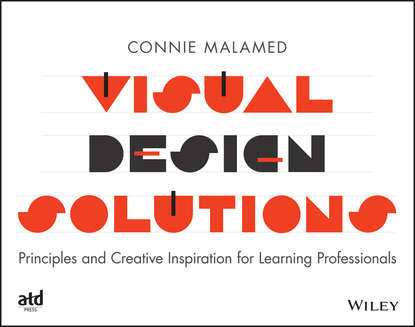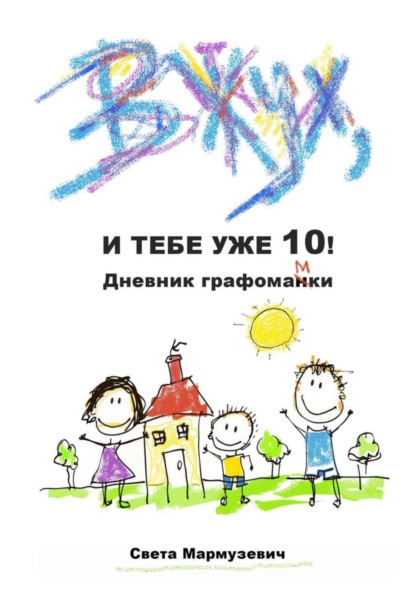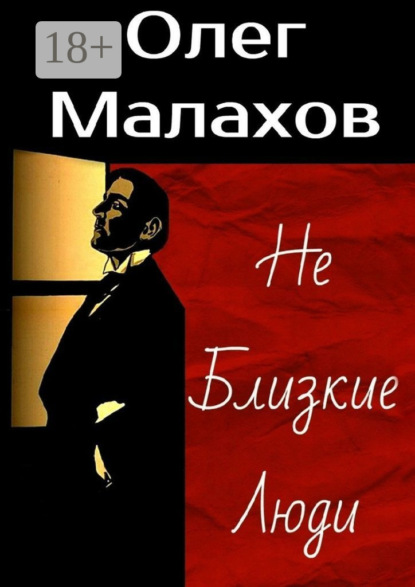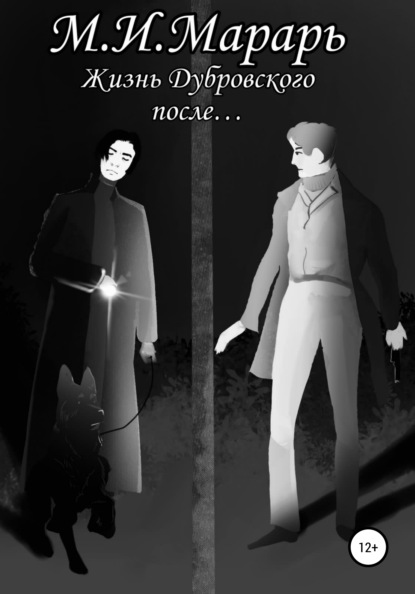- -
- 100%
- +
Die Keltiberer, das zahlreichste und mächtigste der benachbarten Völker, gewann er für sich auf folgende Weise: Unter den Gefangenen bekam er ein Mädchen von ausgezeichneter Schönheit in seine Gewalt und geriet in den Verdacht, dass er sie zu seiner Geliebten machen würde; sobald er aber erfuhr, dass sie mit Allucius, einem Fürsten der Keltiberer, verlobt war, entbot er ihn zu sich und übergab ihm das Mädchen samt dem Lösegeld, das die Verwandten ihm gebracht hatten. Diese Tat gewann ihm die Ergebenheit sowohl jener als auch der Übrigen.
Der König der Hispanier, von Scipio gefangen, trat auf die Seite der Römer über, indem er sich und sein Gebiet denselben übergab, auch Geiseln zu stellen sich erbot. Scipio nahm seine Bundesgenossenschaft an, erklärte aber, dass er keiner Geisel bedürfe; das Unterpfand derselben besitze er in seinen Waffen.
172. Im Jahr der Stadt 545 (209 v.Chr.).
Scipio, streng im Feld, war nachgiebig im geselligen Umgang; furchtbar, wo er Widerstand fand, aber gütig gegen diejenigen, die sich ihm fügten. Außerdem vertraute man ihm wegen des Ruhms seines Vaters und seines Oheims, weil er bei den Taten, die er unternahm, angestammtem Verdienst, nicht zufälligem Glück seinen Ruhm zu verdanken schien. Wegen des schnellen Sieges, und weil Hasdrubal seinen Rückzug in das Binnenland genommen hatte, vor allem aber, weil er – sei es nun, dass er es von einem Gott erfahren hatte oder der Zufall es so wollte – voraussagte, was auch in Erfüllung ging, dass er in dem Lager der Feinde übernachten werde, verehrten ihn alle als einen höher begabten Mann; die Hispanier aber nannten ihn sogar den großen König.
173. Massinissa, auch sonst einer der vorzüglichsten Männer, führte den Krieg mit Kopf und Hand aufs Rühmlichste. An Treue übertraf er nicht nur seine Stammgenossen (denn diese sind meist treulos), sondern auch solche, die sich darauf viel zugutetaten. – Massinissa liebte Sophonisbe, die von ausgezeichneter Schönheit war, aufs Leidenschaftlichste. Mit einem wohlgebildeten Körperbau und der Blüte des Alters verband sie große Kenntnis in Wissenschaften und Musik. Sie war fein, einschmeichelnd und überhaupt so liebenswürdig, dass sie jeden, der sie sah oder hörte, auch den Unempfindlichsten, für sich einnahm.
174. Im Jahr der Stadt 549 (205 v.Chr.).
Licinius Crassus, ein durch Anständigkeit, Schönheit und Reichtum (weshalb man ihn auch den Reichen nannte) ausgezeichneter Mann, blieb, weil er hoher Priester war, ohne zu losen, in Italien zurück.
175. Als der pythische Gott den Römern befahl, die Göttin durch den besten ihrer Bürger aus Pessinos44 in die Stadt holen zu lassen, erteilten sie dem Publius Scipio, Sohn des in Hispanien gefallenen Gnaeus, diesen ehrenden Auftrag, da er besonders im Ruf der Frömmigkeit und der Gerechtigkeitsliebe stand. Dieser brachte sie unter Begleitung der vornehmsten Frauen in die Stadt und auf den Hügel Palatin.
176. Im Jahr der Stadt 550 (204 v.Chr.).
Als die Römer die Vorgänge in der Stadt Locri erfuhren, die sie der schlechten Manneszucht des Scipio zuschrieben, waren sie sehr aufgebracht und beschlossen sogleich in ihrem Zorn, ihn des Oberbefehls zu entsetzen und vor Gericht zu fordern. Ihr Unwille war noch dadurch erhöht, dass er auf griechische Weise lebte, den Mantel zurückwarf und die Sportplätze besuchte; dass man ferner von ihm sagte, er lasse die Soldaten das Eigentum der Bundesgenossen plündern, und dass er den Verdacht erregte, er schiebe die Fahrt gegen Karthago absichtlich auf, um den Oberbefehl desto länger zu behalten. Dass sie ihn aber zurückberufen wollten, geschah vornehmlich auf Betreiben derer, die ihn von Anfang an beneideten. Es unterblieb jedoch, weil das Volk ihm außerordentlich zugetan war und große Hoffnungen auf ihn setzte.
177. Im Jahr der Stadt 551 (203 v.Chr.).
Scipio entließ ein karthagisches Schiff, das er genommen hatte, unverletzt, weil die Leute vorgaben, als Gesandtschaft an ihn abgeordnet worden zu sein. Er wusste zwar wohl, dass die Gefangenen dies nur zu ihrer Rettung erdichteten, wollte aber lieber das Schiff nicht behalten, als, obgleich es in seiner Macht stand, etwas zu tun, was seinen Leumund gefährdet hätte. Als Syphax sie auch damals noch zu versöhnen suchte und vorschlug, dass Scipio Afrika, Hannibal aber Italien verlassen sollte, ging er, nicht weil er ihm traute, sondern um ihn zu bewegen, darauf ein.
178. Die Römer brachten vor Scipio nebst anderer Beute auch den Syphax. Als er ihn gefesselt sah, ertrug er es nicht, sondern sprang, der früheren Gastfreundschaft und des Wechsels menschlicher Dinge eingedenk, wie er den mächtigen König, um dessen Gunst er sich früher beworben hatte, in dieser bedauernswerten Lage vor sich erblickte, vom Sessel auf, löste ihm die Bande, hieß ihn freundlich willkommen und behandelte ihn mit viel Aufmerksamkeit.
179. Die Karthager schickten Gesandte an Scipio und verstanden sich unbedingt zu allen Forderungen, die er machen würde, ohne jedoch dieselben einhalten zu wollen, entrichteten ihm auch sogleich das Geld und gaben alle Gefangenen zurück; wegen der übrigen Punkte fertigten sie noch Gesandte nach Rom ab. Die Römer aber nahmen sie damals nicht an, weil es bei ihnen, wie sie sagten, nicht Sitte sei, so lange noch feindliche Heere in Italien stünden, über den Frieden zu unterhandeln. Als darauf Hannibal und Mago Italien geräumt hatten, ließen sie dieselben vor. Lange stritt man sich, und die Meinungen waren geteilt. Zuletzt aber beschlossen sie, den Frieden unter den von Scipio vorgeschlagenen Bedingungen zu bewilligen.
180. Die Karthager griffen Scipio zu Land und zu Wasser an. Als Scipio, darüber aufgebracht, Beschwerde führte, gaben sie den Gesandten nicht nur eine trotzige Antwort, sondern trachteten ihnen auch bei ihrer Rückfahrt nach dem Leben; und hätte nicht zum Glück ein günstiger Wind sich erhoben, so wären sie gefangen oder getötet worden. Deswegen gestand ihnen Scipio, obgleich indessen die Gesandten mit dem Frieden kamen, denselben nicht mehr zu.
181. Im Jahr der Stadt 553 (201 v.Chr.).
Die Karthager schickten Gesandte an Scipio. Die Friedensbedingungen waren folgende: Sie sollten Geiseln geben, die Gefangenen und die Überläufer der Römer wie der Bundesgenossen, die sie hätten, ausliefern, alle Elefanten und die Dreiruderer, bis auf zehn, herausgeben, und in Zukunft weder Elefanten noch Schiffe halten, dem Massinissa alles, was sie von ihm besaßen, abtreten und ihm zurückerstatten, das Land und die Städte, die seiner Herrschaft zugehörten, räumen, weder eigene Truppen ausheben noch Fremde in Sold nehmen noch gegen irgendjemanden ohne Einwilligung der Römer Krieg anfangen.
182. Unter den vielen anderen, welche für die Zerstörung Karthagos stimmten, war auch der Konsul [Gnaeus] Cornelius [Lentulus]. Denn solange dieses noch stünde, würden sie, behauptete er, niemals sicher sein.
183. Sehr viele traten in Dienst. Wie denn immer die Menschen vieles freiwillig tun, wozu sie sich nicht hätten zwingen lassen. Denn gegen das, was ihnen befohlen wird, sträuben sie sich wie gegen Zwang, das Selbstgewählte aber lieben sie als Herren ihres Willens.
184. Im Jahr der Stadt 557 (197 v.Chr.).
Der besiegte Philipp schickte Gesandte an Flamininus; und dieser schloss, so sehr er auch nach der Eroberung Makedoniens lüstern war und sein Glück zu verfolgen wünschte, dennoch Frieden. Ein Beweggrund war die Sorge, die Hellenen möchten nach dessen Sturz zu ihrem alten Sinn zurückkehren und ihnen nicht mehr zugetan bleiben, und die Aitoler, die sich schon jetzt viel darauf zugutehielten, dass sie das meiste zum Sieg beigetragen hätten, ihnen noch aufsässiger werden, Antiochus endlich, wie verlautete, nach Europa kommen, um dem Philipp beizustehen.
185. Junge Leute, welche in der Stadt angekommene Gesandte der Karthager beschimpften, wurden nach Karthago geschickt und ausgeliefert – aber ohne ein Leid zu erfahren, von diesen wieder entlassen.
186. Im Jahr der Stadt 563 (191 v.Chr.).
Antiochos und seine Heerführer [und die Soldaten] wurden zu Chalkis sittlich verdorben; denn durch die sonstige Untätigkeit und die Liebe zu einer jungen Schönen verfiel er in Weichlichkeit und schwächte auch den kriegerischen Sinn der Übrigen.
187. Im Jahr der Stadt 564 (190 v.Chr.).
Seleukos, des Antiochos Sohn, hatte den Sohn des Africanus auf seiner Überfahrt aus Griechenland abgefangen, hielt ihn aber in großen Ehren. Zwar wollte er ihn selbst auf die vielen Bitten des Vaters nicht gegen Lösegeld von sich entlassen, tat ihm aber nichts zuleide, sondern behandelte ihn im Gegenteil aufs Beste. Endlich gab er ihn, obgleich er den Frieden nicht erhielt, ohne Lösegeld frei.
188. Im Jahr der Stadt 567 (187 v.Chr.).
Die Scipionen hatten viele Neider, weil zwei Brüder, durch Geburt und Verdienste gleich sehr ausgezeichnet, außer den angeführten Taten, die sie verrichtet, auch solche Beinamen erhalten hatten. Dass sie jedoch frei von aller Schuld waren, geht nicht nur aus dem Gesagten hervor, sondern es erwies sich auch bei der Einziehung des Vermögens des Asiaticus sowie durch die freiwillige Entfernung des Africanus nach Liternum, wo er bis an sein Ende unangefochten blieb. Denn zuerst hatte er sich vor Gericht gestellt, indem er durch sein entschiedenes Verdienst zu siegen hoffte.
189. Im Jahr der Stadt 567 (187 v.Chr.).
Nachdem die Römer die üppige Lebensart der Asiaten gekostet und bei reicher Beute und der Freiheit der Sieger sich in den Besitz der Besiegten eingewöhnt hatten, nahmen sie auch bald ihre schwelgerischen Sitten an und traten bald die väterliche Sitte mit Füßen. So drang das Übel von dorther auch in die Hauptstadt ein.
190. Gracchus,45 von plebejischer Abstammung, war auch ein gewandter Volksredner, ging jedoch nicht so weit wie Cato. Obgleich er einen alten Groll auf die Scipionen hatte, ließ er es doch nicht zu, sondern verteidigte den abwesenden angeklagten Africanus und setzte durch, dass ihm kein Schimpf angetan wurde; auch verhinderte er, dass man den Asiaticus ins Gefängnis setzte; deshalb entsagten die Scipionen ihrer Feindschaft und traten mit ihm sogar in Verwandtschaft; denn Africanus gab ihm seine eigene Tochter zur Gemahlin.
191. Im Jahr der Stadt 586 (168 v.Chr.).
Perseus hoffte die Römer ganz aus Griechenland zu vertreiben, durch seine übertriebene und unzeitige Sparsamkeit aber und die daraus erfolgte Lässigkeit der Bundesgenossen schwächte er seine Macht. Als nämlich die Römer im Nachteil waren und er in Vorteil kam, behandelte er die Bundesgenossen verächtlich, als bedürfte er ihrer nicht weiter und als ob sie ihm ihre Hilfe umsonst leisten würden oder er auch ohne sie siegen könnte. Weder dem Eumenes noch dem Gentios zahlte er die versprochenen Gelder, indem er glaubte, sie hätten schon ihre besondere Ursache zur Feindschaft gegen die Römer. Da aber diese und die Thraker (denn auch sie erhielten nicht den vollen Sold) keine Lust mehr bezeigten, geriet er wiederum in solche Verzweiflung, dass er sogar um Frieden bat.
192. Perseus bat die Römer um Frieden und hätte ihn erhalten, wenn nicht die Rhodier, aus Furcht, die Römer möchten ihren Gegner verlieren, ihre Gesandten mitgeschickt hätten. Denn sie führten keine bescheidene Sprache, wie es Bittenden geziemte, sondern äußerten sich, als ob sie nicht sowohl für Perseus um Frieden bäten, als ihn vielmehr gäben, mit viel Übermut und drohten endlich, sie würden den, der den Frieden hindere, mithilfe des anderen bekriegen. Schon früher den Römern verdächtig, wurden sie denselben hierdurch noch mehr verhasst und waren schuld, dass Perseus den Frieden nicht erhielt.
193. Als sich Perseus auf Samothrake im Tempel befand und man von ihm die Auslieferung eines gewissen aus Kreta gebürtigen Euanders verlangte, der ihm sehr viel Treue bewiesen und, unter manchen anderen Diensten gegen die Römer, auch den meuchlerischen Angriff auf Eumenes bei Delphi eingeleitet hatte, gab er ihn nicht heraus aus Furcht, er möchte seine Geheimnisse verraten, brachte ihn aber heimlich um und streute das Gerücht aus, er habe sich selbst umgebracht. Aus Furcht vor seiner Treulosigkeit und Mordlust begannen jetzt alle seine Begleiter, ihn zu verlassen.
194. Perseus, der letzte König Makedoniens, ergab sich, im Krieg gegen die Römer von den Seinigen verlassen, in der Verzweiflung, selbst an Aemilius Paulus. Als er vor diesem auf die Knie fallen wollte, hob er ihn auf mit den Worten: »Mann, willst du mir meinen Sieg vernichten?«, und ließ ihn neben sich auf einem königlichen Stuhl niedersitzen.
195. Perseus ließ sich freiwillig gefangen nehmen, und als man ihn nach Amphipolis brachte, kränkte ihn Paulus weder mit Worten noch mit der Tat, sondern stand vor dem Nahenden auf, bewillkommnete ihn, zog ihn zu Tisch, legte ihm keine Fesseln an und behandelte ihn mit viel Achtung. Perseus hatte ein prächtiges Schiff von ungewöhnlicher Größe mit sechzehn Reihen Ruderbänken erbauen lassen.
196. Paulus war nicht nur groß als Feldherr, sondern auch durchaus unbestechlich. Zum Beweis dient, dass er, obgleich zum zweiten Mal Konsul und im Besitz unsäglicher Beute, fortwährend in solcher Armut lebte, dass nach seinem Tod seine Gattin mit Mühe ihre Mitgift zurückerhielt. So war er, und so waren seine Taten.
Einen einzigen Flecken auf sein Leben wirft, wie man meint, dass er seinen Soldaten die Plünderung erlaubte. Sonst war er nicht ohne liebenswürdige Eigenschaften, im Glück mäßig und ebenso besonnen wie glücklich in Führung des Krieges; was schon daraus ersichtlich ist, dass er sich gegen Perseus nicht hochfahrend und übermütig benahm noch aber auch den Krieg gegen ihn übel und unbesonnen führte.
197. Im Jahr der Stadt 587 (167 v.Chr.).
Die Rhodier, welche sich früher rühmten, als hätten sie Philipp und Antiochos besiegt, und sich besser als die Römer dünkten, gerieten jetzt in solche Furcht, dass sie den an König Antiochos von Syrien abgesandten Publius zu sich einluden und in seiner Gegenwart alle gegen die Römer feindlich Gesinnten durch einen Volksbeschluss verurteilten und alle, derer sie habhaft werden konnten, zur Bestrafung auslieferten.
Dieselben Rhodier traten bei späteren Gesandtschaften, so oft sie einer Sache bedurften, nicht mehr wie früher auf und brachten nur das vor, was sie zur Besänftigung der Römer und zur Abwendung ihrer Rache aus früheren Dienstleistungen anführen konnten. Hatten sie früher den Namen Bundesgenossen nicht annehmen wollen, um, durch keine geschworene Freundschaft gebunden, von ihnen abfallen zu können und sich ihnen dadurch furchtbar und ihren jeweiligen Gegnern umso wichtiger zu machen, so bewarben sie sich jetzt eifrigst um jenen Namen, um sich sowohl die Gunst der Römer zu sichern als auch bei anderen dadurch in Achtung zu sein.
198. Im Jahr der Stadt 589 (165 v.Chr.).
Prusias kam selbst nach Rom und in die Curie, küsste die Schwelle derselben, nannte die Senatoren Götter und fiel in Anbetung vor ihnen nieder; weswegen er hauptsächlich Erbarmen fand, obgleich er Attalos gegen den Willen der Römer bekriegt hatte. Man sagte auch, dass er zu Hause, so oft römische Gesandte kamen, denselben die gleiche Ehrfurcht bezeigte. Er nannte sich einen Freigelassenen des römischen Volkes und erschien oft mit einem Hut.
199. Scipio wurde als ein Jüngling von 24 Jahren Oberfeldherr.46
200. »Denn welche Altersstufe ist dem aus den Knabenjahren Getretenen zu pflichtmäßigen Gesinnungen bestimmt? Welche Zahl der Jahre zu pflichtmäßigen Handlungen gesetzt? Sind es nicht diejenigen, welche natürliches Geschick und gutes Glück haben, die gleich von Anfang an das Rechte denken und tun? Wer in diesem Alter beschränkten Geistes ist, wird auch später, wenn er viele Jahre durchlaufen hat, nicht verständiger werden. Besser mag man mit vorgerücktem Alter werden; aber der Unverständige dürfte nicht leicht verständig, der Tor nicht leicht weise werden.«
Nehmt daher den jungen Männern nicht den Mut, als hättet ihr im Voraus an ihrer Tüchtigkeit, das Rechte zu tun, zu zweifeln; im Gegenteil müsst ihr sie aufmuntern; sie zu unverdrossener Pflichterfüllung anhalten, als würden sie, noch ehe sie zu Greisen ergraut, Ehren und Ämter erlangen; denn dadurch macht ihr auch die Eltern besser, erstens zeigt ihr ihnen viele Nebenbuhler, zum Zweiten beweist ihr, dass ihr wie alles andere so auch den Oberbefehl vornehmlich nicht nach der Zahl der Jahre, sondern nach der innewohnenden Tüchtigkeit allen euren Mitbürgern verteilt.«47
201. Scipio Africanus der Jüngere wusste immer unter mehrerem das Geeignetste auszusuchen und in unvorhergesehenen Fällen, was am meisten nottat, zu treffen und zügig in die Tat umzusetzen. Was zu tun war, bedachte er mit sicherem Takt, bei der Ausführung aber ging er mit sorgfältiger Behutsamkeit zu Werke. Daher kam es, dass er mit ruhiger Überlegung alle Vorteile genau erwog und, auf unerwartete Fälle gefasst, auch in ihnen mit Sicherheit handelte. Trat also der Fall ein, dass lange Überlegung unmöglich war (wie dies in den unerwarteten Kriegswechseln und bei der Unbeständigkeit des Glückes täglich zu geschehen pflegt), so tat er auch hier keinen Fehlgriff. Denn aus Gewohnheit, und weil er nie unbesonnen verfuhr, konnte ihm nichts so unerwartet kommen, dass er die Geistesgegenwart verlor. Vielmehr benahm er sich auch bei unvorhergesehenen Fällen, weil er sich niemals ganz sicher glaubte, so, als hätte er schon längst darauf gerechnet.
Er war in höchstem Grade mutig, wo er Erfolg hoffte; kühn, wo er des Sieges gewiss war: Denn an Leibesstärke nahm er es mit jedem Soldaten auf und verdiente sich nicht wenig Bewunderung, dass er die besten Pläne als Feldherr ersann und, wenn es zur Tat kam, sie mit einem Eifer ausführte, als ob er von anderen dazu befehligt würde. Allein nicht nur hierin stellte er seinen Mann, er hatte sich sowohl bei Mitbürgern und Freunden als auch bei Fremden und selbst den erbittertsten Feinden festes Zutrauen erworben. Und dies war auch der Grund, dass viele Einzelne und viele Städte sich für ihn erklärten. Denn da er nichts unbesonnen, aus Leidenschaft oder Furcht tat oder sprach, sondern mit festem Urteil auf jeden Zufall gefasst war und der Unbeständigkeit menschlicher Dinge nicht zu viel vertraute, unternahm er nichts Verzweifeltes, sondern überdachte alles nach dem gewöhnlichen Gang der Dinge, erwog alles, was geschehen sollte, noch bevor er dazu genötigt war, und schritt dann mit Sicherheit zur Ausführung. So war er einer der wenigen, wenn nicht der einzige Sterbliche, der bei solchen Eigenschaften durch seine Mäßigung und Anspruchslosigkeit weder die Missgunst seiner Standesgenossen noch überhaupt jemandes auf sich zog. Denn bei Niedrigeren sich gleichstellend, über die Ranggenossen sich nicht erhebend, den Höheren weichend, war er selbst über den Neid, der die trefflichsten Männer oft zu Fall bringt, erhaben.
202. Im Jahr der Stadt 605 (149 v.Chr.).
Der Lusitanier Viriatus, von sehr niedriger Abkunft, wie einige glauben, der durch seine Taten weltberühmt wurde (erst Hirte, dann Räuber, zuletzt Feldherr) war durch Natur und Übung gleich schnell, in der Verfolgung wie in der Flucht, und stand auch tapfer im Kampf. Speise und Trank, wo und wie er sie traf, galten ihm gleich. Den größten Teil seines Lebens brachte er unter freiem Himmel zu und begnügte sich mit dem Bett der Natur. Daher ertrug er auch jeden Grad Hitze, jede Kälte, litt nie unter dem Hunger, noch unter sonstigen Beschwerlichkeiten, indem er alle Bedürfnisse mit dem, was er gerade fand, als mit dem Besten aufs Behaglichste befriedigte.
Bei einem solchen Körper, wie ihn Natur und Übung gebildet hatten, zeichnete er sich mehr noch durch Geistesvorrang aus. Schnell war er im Denken und Handeln. Er wusste gleich, was zu tun war, und traf den rechten Zeltpunkt für die Ausführung. Meister in der Verstellung, stellte er sich, als ob er das Bekannteste nicht wüsste, und das Geheimste ihm nicht verborgen wäre. Zugleich Feldherr und sein eigener Diener in allen Stücken, sah man ihn dadurch weder erniedrigt noch verhasst. Seine niedrige Abkunft und seine Würde als Führer machten in ihm eine solche Mischung, dass er unter und über keinem zu stehen schien. Überhaupt führte er den Krieg nicht aus Habsucht, Herrschsucht oder Hass, sondern einzig der Taten wegen. Daher galt er als der leidenschaftlichste und geschickteste Kriegsmann.
203. Im Jahr der Stadt 606 (148 v.Chr.).
Urheber der Uneinigkeiten waren die Achaier, welche den Spartanern (mit denen sie nie recht einig waren) besonders auf Antrieb ihres Strategen Diaios an all ihrem Unglück Schuld gaben. Obgleich die Römer öfter Vermittler schickten, gaben sie doch nicht nach; und als jene Gesandte abfertigten, um womöglich die griechischen Staaten zu trennen und dadurch zu schwächen, unter dem Vorwand, dass die früher unter Philipp gestandenen Städte, darunter auch das damals blühende Korinth, welches in der Versammlung den größten Einfluss hatte, nicht mehr daran teilnehmen dürften, so fehlte nicht viel, dass sie dieselben getötet oder fortgejagt hätten, wenn jene nicht noch rechtzeitig aus der Burg von Korinth, wo sie wohnten, entwischt wären.
Sie schickten jedoch Gesandte nach Rom, um sich wegen des Vorgefallenen zu entschuldigen. Nicht auf jene, sagten sie, sondern auf die bei ihnen befindlichen Spartaner hätten sie es abgesehen gehabt. Die Römer ließen ihre Entschuldigung auf sich beruhen (denn sie hatten noch mit den Karthagern Krieg und konnten sich auch noch nicht auf Makedonien verlassen), schickten aber doch Gesandte ab, die ihnen Verzeihung versprechen sollten, wenn sie sich ruhig verhielten. Sie ließen dieselben jedoch nicht vor die Bundesversammlung, sondern verwiesen sie auf die nächste Sitzung, welche erst nach sechs Monaten gehalten werden sollte.
204. [Appius] Claudius, der Amtsgenosse des Metellus, stolz auf seine Ahnen und neidisch auf den Kollegen, erhielt durch das Los Italien zur Provinz und fand hier keinen Feind. Er wünschte aber auf jeden Fall einen Vorwand zum Triumph zu erhalten und machte die Salasser, ein gallisches Volk, ohne dass sie sich früher etwas hatten zuschulden kommen lassen, zu Feinden der Römer. Er war nämlich abgesandt, zwischen ihnen und ihren Grenznachbarn, mit denen sie wegen des zu ihren Goldbergwerken nötigen Wassers im Streit lagen, zu vermitteln, und verheerte ihr ganzes Land. Die Römer schickten ihm zwei von den zehn Priestern zu.48
Obgleich Claudius sehr wohl wusste, dass er nicht gesiegt hatte, war er doch so unverschämt, ohne im Senat oder vor dem Volk des Triumphs Erwähnung getan zu haben, als ob er ihm auch ohne vorhergegangenen Beschluss und ohne Weiteres gebührte, die Kosten dazu zu verlangen.
205. Im Jahr 612 (143 v.Chr.).
Popilius setzte den Viriatus dergestalt in Schrecken, dass er sogleich, ehe er es zur Schlacht kommen ließ, Frieden anbot; und als man nun die Rädelsführer der von den Römern Abtrünnigen verlangte, ließ er die einen töten (unter diesen auch seinen Schwiegersohn, obgleich er einen besonderen Heeresteil befehligte), die anderen ausliefern. Diesen allen ließ der Konsul die Hände abhauen. Man wäre völlig ins Reine gekommen, wenn man ihm nicht auch die Waffen abverlangt hätte. Denn dazu wollte sich weder Viriatus noch die übrige Menge verstehen.
206. Im Jahr 612 (143 v.Chr.).
Mummius und Africanus (die Zensoren) waren in ihrem Charakter durchaus verschieden. Denn der Letztere verwaltete, ohne Ansehen der Person, sein Amt mit der strengsten Gewissenhaftigkeit und forderte viele aus dem Senat, dem Ritterstand und auch Einzelne aus dem Volk vor seinen Richterstuhl. Mummius dagegen, als Volksfreund mit mehr Schonung verfahrend, belegte nicht nur niemanden mit entehrender Strafe, sondern hob auch, soweit er konnte, die Verfügungen seines Amtsgenossen wieder auf. Er war von Natur so nachsichtig, dass er dem Lucullus zur Einweihung des Tempels der Glücksgöttin, den er von der Beute des Hispanischen Kriegs erbaut hatte, seine Bildsäulen lieh, und da sie ihm dieser, weil sie durch die Weihung Eigentum der Gottheit geworden seien, nicht zurückgeben wollte, ihm nicht nur nicht zürnte, sondern seine Beute unter jenes Namen als Weihegeschenk stehen ließ.
207. Im Jahr 614 (141 v.Chr.).
Pompeius49 war in vielen Unternehmungen unglücklich und zog sich großen Schimpf zu. Er wollte einen Fluss, der durch das Land der Numantiner floss, aus seinem alten Bett ab- und auf ihre Felder leiten und führte es zwar mit vielen Anstrengungen durch, verlor aber viele Leute und brachte mit dieser Ableitung den Römern keinen Vorteil und jenen keinen Schaden.