Stolps Reisen: Damals und heute, von den Anfängen bis zum Massentourismus
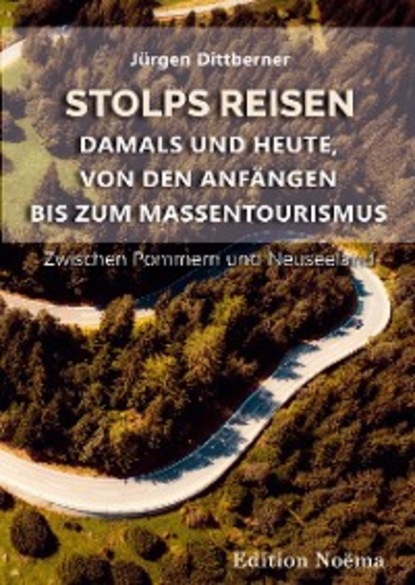
- -
- 100%
- +
Dann waren sie in „Icod de los Vinos“. Die Freunde stellten beruhigt fest, dass alle sich warm angezogen hatten, denn sie waren ja nun auf der Nordseite der Insel. Aber die Stolps waren im Bilde: Einmal bei einem früheren Besuch hatte ein offensichtlicher „Ossi“ gefragt:
„Entschuldigung, ist es hier immer so kalt?“
Zuerst gingen alle in ein geographisches Museum, in dem Karten gezeigt wurden, die Vorfahren vor etwa 500 Jahren von den Kanaren gezeichnet hatten. Dann besuchten sie ein kleines Restaurant, wo sie eine kanarische Gemüsesuppe und etwas Schinken aßen. Dazu gab es Bier, kanarischen Wein (rot und weiß) sowie Kaffee.
Hinterher wanderten alle durch den Ort und kamen schließlich zum angeblich 1000-jährigen Drachenbaum („El Drago“), der das Wahrzeichen der Stadt war. Der Baum wog 140 Tonnen, seine Krone war 20 Meter breit, der Stammumfang betrug sechs Meter, und hoch war die Pflanze siebzehn Meter! Das war schon ein kleines Weltwunder, auch wenn Experten das Alter glatt auf die Hälfte der 1000 Jahre reduzierten. Aber 1000 Jahre klingt für die Touristen eben viel schöner.
Weiter schlenderten Stolps mit ihren Freunden durch den Ort und waren bald wieder am Busbahnhof. Silke wurde auf der Rückreise schlecht von der kurvenreichen Strecke. Die Fahrt selber war dennoch interessant: Immer wieder stiegen Einheimische für kurze Strecken ein. Einer redete laut und unverständlich mit dem Fahrer. Der antwortete höflich und etwas leiser. Dann kam ein alter Mann, der einen gefüllten Beutel unter seinen Sitz stellte. Als es in die Kurve ging, kullerte ein Teil des Beutelinhalts in den Busgang. Der Alte tat, als habe er nichts gemerkt, hielt seinen Beutel aber fortan gut geschlossen. Silke und Andor sahen, dass nun Maiskörner im Gang des Busses lagen. Ging es bergauf, kullerten die alle nach unten, bergab kullerten sie nach vorne; bei einer Linkskurve versammelten sich alle links, bei rechts rechts. Dann stieg der Mann aus, immer noch den ganzen Vorgang ignorierend, aber seine Maiskörner wechselten weiterhin wie eine kleine Völkerschar ‘mal nach vorne, ‘mal nach hinten, ‘mal nach rechts, ‘mal nach links. Das war lustig. Und sicher kein für die Touristen inszeniertes Schauspiel.
Beim Aussteigen entdeckten sie ein Thermometer: neun Grad! Stürmisch war es obendrein. Auch am Hotel stürmte es, Sandwolken kamen auf. Von den Freunden erfuhren die Stolps per Handy, dass es im Norden der Insel ebenfalls ungemütlich war. Auch im modernen Tourismus kam es eben manchmal zu ungeplanten Ereignissen: Nachts, tags darauf – immer weiter stürmte es. Die Balkonmöbel purzelten umher, und Silke bekam Angst, dass die Palmen draußen abbrechen könnten. Das taten sie aber nicht. Bei diesem wilden Wetter konnte man auch keine Ausflüge machen. Andor beobachtete die hohen und wilden Wellen des Atlantiks, die gegen die schwarzen Felsen preschten. Das immerhin war schon imposant: Werden Touristen eines Tages irgendwo auf der Erde hinfahren, um Sturm zu bestaunen?
Als der Sturm nachließ, wanderten die Stolps nach Norden. Dann zog es die Stolps nach Süden. Sie entdecken wieder ehemalige Bananenplantagen – „Bauerwartungsland“ gewissermaßen. Die Wolken lieferten sich mit der Sonne über dem Atlantik ein dramatisches Schauspiel. Schließlich wurde es dunkel und kühl. Sie fuhren mit einem Bus nach „Los Gingantes“, wo wieder riesige Hotelanlagen, aber auch unzählige Bungalows, standen. Sie alle waren so ummauert, dass man eventuelle Gärten gar nicht sehen konnte. Auch mehrstöckige, leere Gebäude älteren Stils standen an der Straße. Sie wirkten nicht gerade reizvoll.
Wieder hatte die Natur die Augen geöffnet über die „Tourismus-Zivilisation“, und es war, als würde sie fragen: „Na, findest Du das schön?“
Schließlich machten die Urlauber einen Ausflug in den alten Süden der Insel. Sie hatten einen Stadtplan von der „Costa Adeje“ und der „Playa de las Américas“. Da war eine Promenade immer an der Küste entlang eingezeichnet. Sie fuhren mit dem Bus hin. Das dauerte, denn der Bus wechselte mehrmals über die Autobahn und hielt an vielen Stationen landeinwärts.
Endlich waren sie da, und Horror tat sich auf. Menschenmassen ohne Ende promenierten. Restaurant reihte sich an Restaurant. Alle waren voll. Silke und Andor dachten, es wäre schön, mit dem Schiff nach „Los Gigantes“ zu fahren. Aber das ging nicht: Man konnte nur zum Fischen oder Tauchen hinausfahren, keine Einzelfahrt machen. Also latschten sie die Promenade entlang, sahen völlig leere Badestellen, an denen Massen von Urlaubern vorbeiströmen und kamen nicht richtig voran.
Der alte Stadtplan war doch arg klein. Schließlich fanden sie eine Bushaltestelle. Der Bus war voll. Aber viele Leute fuhren kurze Strecken. So kamen sie bald zu Sitzplätzen. Die Fahrt dauerte dennoch eine Weile. Es war wie daheim in der Großstadt. Und dahin wollten sie jetzt wieder zurück.
Auch am Flughafen war es voll. Die Maschine nach Hause hatte Verspätung, angeblich wegen Gegenwind beim Herflug: Die Natur also!
Drei Jahre später landeten die beiden wieder auf „Teneriffa“.
Und das kam so:
Eigentlich hatten sie eine Reise nach „La Palma“ gebucht zu einem kleinen Hotel inmitten einer Bananenplantage. Sie sollten direkt fliegen, und der Veranstalter war „TUI“. Aber da ging die Fluggesellschaft pleite, und „TUI“ verfiel in Sprachlosigkeit. Nach einigem Hin und Her buchten die Stolps um. Der Veranstalter war ein anderer, und statt nach „La Palma“ flogen sie nach „Teneriffa“. Immerhin gehörte ja das auch zu den Kanarischen Inseln. Doch das Ziel war nun das Hotel „Bahia Del Duque“, und das lag an der Costa Adeje.
Leider kamen sie bei Dunkelheit an, aber in einem spanischen Restaurant des Hotels erwarteten sie einige Köstlichkeiten. Auch eine Flasche Wein war dabei. Und die Reisenden waren versöhnt.
Als sie vor langer Zeit das erste Mal auf Teneriffa waren, war das hier ausgedörrtes Wüstenland. Nunmehr reihte sich Hotel an Hotel an dieser Küste. Die Costa Adeje war nun eine Promenade mit vielen Restaurants („Pint of Beer eineinhalb Euro“) geworden. Die meisten der zahlreichen Touristen waren Engländer. Auf der einen Seite der Promenade war das Meer, auf der anderen die Hotels. Diese konnte man nur mittels Plastikkarte betreten, und hinter den Hotels stiegen gleich die Berge an.
Die Stolps hatten auch eine Plastikkarte (für ihre Herberge), und ihr Hotel hatte einen wunderschönen Garten mit zahlreichen Pools – wer dachte da schon an die durch solche Anlagen entstehenden Umweltschäden?
Das für die Touristen Gute war: Über dem Streifen zwischen Meer und Gebirge in dieser Gegend war stets blauer Himmel, und man hatte Temperaturen von etwa einundzwanzig Grad. Die „bösen“ Wolken hingen derweil in den Bergen. Es regnete aber weder dort noch hier. Jeden Tag war das so. Doch wo kam das Wasser für Pools und Gärten her?
Jemand versuchte, Andor das Portemonnaie zu entwenden, doch er wehre den „Angriff“ ab. Solche „Freuden“ eines Urlaubs hatte man mittlerweile hinzunehmen.
Mit dem Bus fuhren sie einen Tag ins frühere Fischerdorf „Los Christianos“. Daraus war ein größerer Ort geworden, und nach einem langen Gang auf einer Kaimauer sahen Silke und Andor drei Fähren, die gerade dabei waren, Menschen und Autos für Überfahrten zu anderen Inseln einzuschiffen.
Ein andermal gingen die beiden auf einem großen Stück unbebauten Landes spazieren. Hier wuchsen Kakteen und dürre Sträucher – sie erkannten den alten Süden Teneriffas wieder. Von hier aus sahen sie auch die Spitze des „Teide“; dieser Riese lugte noch immer hinter den Küsten-Bergzügen hervor.

Der Teide
4. Sandalen auf Lanzarote
Mit Italien und Griechenland im Erinnerungsschatz, mit „Teneriffa“-Erfahrung waren die Stolps fast schon Mainstream-Touristen, aber es fehlten noch eine oder zwei Kanarische Inseln.
Schon sehr früh hatten die Stolps (noch mit Kindern) die erste Urlaubsreise nach „Lanzarote“ gemacht. Eine „Reiseleiterin“ Jahre später hieß Karoline Pawlonka und sagte, damals bei der ersten Reise der Stolps hierher sei sie noch nicht einmal geplant gewesen. Sie versuchte auch gar nicht, Silke und Andor, die wiedergekommen waren, Sehenswürdigkeiten der Insel nahe zu bringen, denn sie waren schon zum vierten Mal hier und kannten so ziemlich „alles“.
Diesmal wohnten sie im Fünf-Sterne-Hotel „Hesperia Lanzarote“. Hotels von früher gab es nicht mehr. Früher durfte ein Freund nicht in eine Bar, weil er abweichend von seiner ansonsten „korrekten“ Kleidung an den Füßen Sandalen trug! Die Sandalen waren immerhin neu. - Über diese Geeschichte war längst der Sahara-Wind geweht, der im Sommer manchmal vom nahen Afrika herüberkam.
Einmal hatten Stolps auf dieser Insel im Atlantischen Ozean Weihnachten und Silvester verbracht. Wenn auch das spanische Mutterland etwa 1000 Kilometer weg war, so war doch Lanzarote wie die anderen Kanarischen Inseln durch und durch spanisch, und das heißt beispielsweise: Weihnachten ist ein fröhliches Fest, und es dauert auch nur einen Tag: Am 25. Dezember sind die Kirchen fröhlich geschmückt, und dazu ertönt passende Musik. An diesem Tag und nicht am 24. feiern Spanier „Navidad de Senor“, die Geburt Christi. In „Teguise“ hatten sie das miterlebt.
Am 26. Dezember wurde wieder gearbeitet. Das in einem katholischen Land! – Silvester war auch anders als daheim: In Freizeitkleidung gingen Stolps nach „Puerto del Carmen“, tranken im Hafen Bier und erfreuten sich an der lauen Nacht mit einem faszinierenden Sternenhimmel. -Später waren sie erneut auf „Lanzarote“. Sie hatten diesmal in „Playa Blanca“ gewohnt, in einem etwas noblen Hotel, dem „Natura Palace“.
„Lanzarote“ ist eine der Kanarischen Inseln, deren jeweilige Attraktionen Silke und Andor mittlerweile kannten. Mit ihren rot-braunen Feuerbergen, den schwarzen Feldern und ihren Weinmulden, mit den weißen Häusern und grünen Palmen hat „Lanzarote“ ihr eigenes Flair, das einen besonders zu Zeiten des mitteleuropäischen Winters stets verzauberte: „Lanzarote“, die braune Insel, war gewiss die Eigenwilligste unter den Kanaren. Als es noch die DDR gab, lobte ein mit zeitweisem „Westpass“ ausgestatteter Rentner aus dem „Arbeiter- und Bauernstaat“: „Eine dolle Insel!“ Ausflüge in die Freiheit, das waren für ihn Reisen nach „Lanzarote“. Wahrscheinlich ist er mittlerweile „im Westen“ auch noch woanders hingekommen.
Die Geschichte „Lanzarotes“ bleibt wie die der gesamten Kanaren im Halbdunkel. Schon in der Antike soll das Archipel bekannt gewesen sein. Vor den Spaniern waren die Guanchen hier, angeblich blond, grünäugig und von nordafrikanischen Berbern abstammend. Dann hatten Spanier sich etwa ab 1400 die Inseln einverleibt. Der Sage nach soll ein Normanne namens Jean de Bethancourt mit einer spanischen Lizenz auf „Lanzarote“ angekommen sein und sich so über die widerstandslose Eroberung gefreut haben, dass er laut „Lanza Rota“ gejubelt habe, was so viel hieß wie „Lanze kaputt“. Aber ganz so friedlich sind die Eroberer mit den Guanchen wohl doch nicht umgegangen, so dass es wohl eher zutrifft, dass der Seefahrer Lancelotto Malocello Namensgeber der Insel ist. Aus der jüngeren Geschichte wird berichtet: „1730 kam es auf Lanzarote zu schweren Vulkanausbrüchen. Am 1. September bildeten sich auf einer Strecke von 18 Kilometern 32 neue Vulkane. Die Ausbrüche, die von dem Pfarrer von Yaiza, Don Andrés Lorenzo Curbelo, bis 1731 detailliert dokumentiert wurden, dauerten insgesamt 2053 Tage und endeten im Jahr 1736.“1
Seither hat die Insel ihr modernes Gesicht. Man kann die erloschenen Vulkane sehen, die Lavafelder, schwarze Asche bedeckt weite Teile. Es regnet kaum; Bauern haben Methoden gefunden, den Tau für die Bewässerung ihrer Pflanzen zu nutzen. Interessant ist, dass dabei die Weinstöcke und Feigen auch in dem immer warmen Klima Winterpausen einlegen. Es sind halt Mittelmeerpflanzen, – die bleiben bei ihren ursprünglichen Gewohnheiten. Früher hatten die Winzer übrigens fast nur „Malvasia“ angebaut, später wuchsen alle Rebsorten, welche die Touristen mögen, zwischen den Feuerbergen.
Die Urlauber oder ihre Agenten bestimmen mehr und mehr den Charakter dieser Insel.
Auf „Lanzarote“ scheint fast jeden Tag die Sonne, und so wurden viele Hotels am Meer gebaut. Wen das Braun und Schwarz der Landschaft nicht stört, kommt gerne hierher, denn so verbaut wie „Teneriffa“ oder „Gran Canaria“ ist „Lanzarote“ nicht. „Lanzarote“ selbst scheint es mit seinen Touristen dabei nicht so schlecht zu gehen, denn die Straßen sind super ausgebaut, und es wurden viele Kreisverkehre eingerichtet, die das Fahren erleichtern sollen. Alle Orte wurden fein herausgeputzt.
„Landessprachen“ sind Englisch, Deutsch und Spanisch: Alles geht. „Lanzarote“ ist etwa 800 Quadratkilometer groß, besteht aus sieben Gemeinden und hat ungefähr 130.000 Einwohner. Es gehört zur spanischen Provinz „Las Palmas“.
César Manrique gilt seit langem als der berühmteste Sohn der Insel. Er war ein Architekt und Künstler, der es geschafft hatte, dass „Lanzarote“ nicht durch Bettenburgen und Hochhäuser verbaut wurde. Eines seiner Werke ist der „Mirador“, ein Aussichtspunkt, von dem aus man hinter dicken Glasfenstern oder von einer Plattform aus aufs Meer schauen kann. Ein Restaurant, ein Touristenlädchen und glücklicherweise eine Toilette gehören auch dazu.

Manrique hat auch den Kaktusgarten („Jardin de Cactus“) geschaffen, der z.T. riesengroße Kakteen aus aller Herren Länder zeigt. Man staunt, welch unterschiedliche Geschöpfe die Natur allein in diesem Sektor hervorgebracht hat. Der Garten ist wie ein Amphitheater angelegt und zeigt mehr als 7.200 Pflanzen von über 1.100 Kaktusarten. Die meisten kommen offenbar aus Mexiko.
Silke und Andor sahen auch „Playa Blanca“. Hier ist zu viel gebaut worden. Man sah viele Touristen, einen aufgeschütteten Badestrand, und schlechte Restaurants. Neue Häuser standen reihenweise leer, und die Frage stellte sich, wer hier sein Geld vernichten wollte: Selbst auf „Lanzarote“ wurde an dieser Stelle klar, dass Spanien sich beim Bauen übernommen hatte.
Ein Naturwunder, das hoffentlich niemand zerstören wird, ist immer noch „El Golfo“. Das ist ein vom Meer verschlungener Krater mit einer grünen Lagune. Vor dem Blau und Weiß des Meeres, dem Schwarz und Braun der Insel nimmt sich das ganz besonders aus.
Silke und Andor machten auch einen Tagesausflug zur Nachbarinsel „Fuerteventura“. Von „Playa Blanca“ auf „Lanzarote“ in Richtung Süden übers Meer ist diese zweitgrößte der Kanarischen Inseln nur zehn Kilometer entfernt. Von Hafen zu Hafen sind es vierzehn Kilometer. Eine Fähre namens „Volcán de Dindaya“ fuhr jeden Tag mehrmals von „Playa Blanca“ nach „Playa del Corraleyo“ und zurück.
Dann war man auf „Fuerteventura“. Doch Vorsicht: Wer mit einer Reisegesellschaft gebucht hatte, musste in Kauf nehmen, dass ein Bus X Hotels in „Playa Blanca“ abklapperte, bevor es auf die Fähre ging. Des Laufens waren offensichtlich die meisten Touristen ohnehin nicht fähig.
Fuerteventura hatte nicht wie „Lanzarote“ nur weiße Häuser, auch war die Erde nicht schwarz-braun. Modefarbe für Häuser schien sandbraun zu sein. Fuerteventura ist 1660 Quadratkilometer groß und hat etwa 100.000 Einwohner. Einst sollen hier mehr Ziegen als Menschen gelebt haben. Ziegenkäse und Tomaten waren bis der Tourismus kam die Haupterwerbsquellen. Im Unterschied zu „Lanzarote“ hat „Fuerteventura“ eigenes Grundwasser, und in den Senken gibt es grüne Oasen.
Die Insel ist alt: Fünf Millionen Jahre soll sie auf dem Buckel haben.
Bei den nebeneinander stehenden Vulkanen sind die Zwischenräume durch Verwitterung im Laufe der Zeit vom „V“ zum „U“ geworden. Aber der Grund der „U“s soll sehr fruchtbar sein.
Der Hauptort der Insel heißt „Puerto del Rosario“.
Angeblich stammt der Name der Insel daher, dass ihr französischer Eroberer (wieder mit einer Lizenz des spanischen Königs in der Hand) gestöhnt haben soll: „forte aventure“, was „starkes Abenteuer“ heißen soll und auf die zu besiegenden Guanchen gemünzt war.
Stolps besuchten das „Casa des Coroneles“, ein Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem die von Spanien eingesetzten Herrscher der Insel gewohnt haben sollen. Erstrebenswert muss es nicht gewesen sein, in diese Einöde zu kommen. Jedenfalls wurden spanische Sozialisten, als sie dem Staat nicht passten, im Zwanzigsten Jahrhundert hierher verbannt.
In „La Oliva“ gab es für die Passagiere der angelandeten Fähre Reisebusses aus „Lanzarote“ sowie ein Mittagessen (eine touristische Massenabfütterung ohne einheimische Tomaten oder Ziegenfleisch).
In der Mitte der Insel besuchten die Lanzaroter „Betancuria“, die alte Hauptstadt der Kanaren. Das war eine Oase. Hier war es grün und Blumen blühten. Man sah kleine Felder. Einsam war es an diesem Ort ganz bestimmt. „Betancuria“ – das ist eine das ganze Dorf umschließende Landschaft – hatte 715 Einwohner!
Eine aufregende Gebirgsstraße entlang ging es nach „Pájara“, wo eine fulminante Bougainvillea-Hecke blühte. Hin und wieder war auch „Fuerteventura“ wirklich schön.
Auf dem Rückweg hielten die Besucher im „Parque Natural de Coralejo“. Dort konnte man Dünen genießen und richtiges Strandleben haben. Der „Sand“ bestand aus Muschelkalk und dem Abrieb der Vulkane. Fünfzehn Minuten verweilten die Besucher, dann ging es zurück zur Fähre. Die fuhr bei Sonnenuntergang am Inselchen „Lobo“ vorbei wieder nach „Playa Blanca“, und der Bus kurvte wieder durch das Touristenstädtchen. Als endlich die dortigen Reisenden ausgeladen waren, ging es im Dunkeln die Landstraße entlang über „Yaiza“ zum Hotel.
Am vorletzten Tag dieser Reise wanderten die beiden noch einmal nach „Puerto del Carmen“ und zurück: Das waren wohl mehr als vierzehn Kilometer bei großer Hitze. Mittags bestellten sie „Tapas“. Mit den „Tapas“ war es angeblich so: Früher legte man auf das Weinglas oder andere Getränke einen Deckel („Tapa“) mit einem Stück Käse oder einer Olive darauf. Das sollte die Fliegen fernhalten. Daraus hätten sich die „Tapas“ als Nationalspeise entwickelt. – Stolps Tapas waren folgende: Kartoffelsalat, überbackener Fisch, kalte Miesmuscheln, Fischbällchen, Garnelen und Schweinefleisch in Currysauce. Das mitbestellte Bier hatte am meisten gemundet.
Es lebe der Tourismus!
(zuerst 1977, zuletzt 2011)
5. Mit „Buffke“ nach Gran Canaria
„Gran Canaria“ fehlte bei der touristischen „Muss-Liste“ Kanariens. Die Insel gibt dem Archipel schließlich den Namen und ist sicher Motor des Tourismus in ganz Spanien.
Silke und Andor Solp flogen also nach „Gran Canaria“ und blieben dort im Hotel „Dunas Suites & Villen“ in „Maspalomas“. Sie waren nicht das erste Mal auf dieser Insel.
Mit dem Flug fing alles an: Der Flieger startete verspätet und landete „wegen Gegenwind“ ebenfalls später. Vor dem Start verzog sich der „dritte Mann“ auf Stolps Sitzreihe woanders hin. Doch die Freude dauerte nur kurz: Ein zierliches Fräulein (oder so) fragte, ob der Platz neben Andor frei sei. Er antworte freudig: „Ja.“
Da verschwand die „Lady“, und kurz danach erschien ein wohlbeleibtes Ehepaar Marke „Buffke“ und pretzelte sich hin: „Gang-Gang“, denn auf der anderen Seite war auch noch Platz. Nun wurde es eng, und die dicke, frisch ondulierte Ehefrau auf dem Nebensitz machte sie an: „Wohl noch nie jeflogen, wa?“
Andor war fünf Stunden eingepfercht. Wäre das „Fräulein doch bloß geblieben…
Auf dem Flughafen von „Gran Canaria“ herrschte Chaos. Nicht nur Silke und Andor kamen an, sondern auch Maschinen aus London und anderen Orten. Das Gepäck von allen landete auf einem riesigen Förderband. Als die Stolps endlich aus einer Menge von Menschen und Gepäck mit Koffern zum Ausgang strebten, sahen sie sich einer ellenlangen Galerie von „Abholern“ gegenüber. Endlich fanden sie eine Bedienstete, die für ihre Reisegesellschaft zuständig war und die sagte, der letzte Bus ganz hinten in der letzten Reihe würde sie in „Euer“ Hotel bringen.
Es dauerte, bis alle Gäste eingetroffen waren. Dann fuhren die Ankömmlinge lange durch „Playa del Inglés“ und schließlich durch „Maspalomas“. Mit Bettenburgen, schäbigen Einkaufszentren und unattraktiven Kneipen machte „Playa del Inglés“ einen abschreckenden Eindruck. Aber Massen von Urlaubern zogen frohgemut durch die Straßen, und die Stolps hofften heimlich, dass die Sitznachbarn vom Flugzeug hier Ferien machen müssten.
Das zu Hause gebuchte Hotel in „Maspalomas“ entpuppte sich als Familienhotel. Es wimmelte von kleinen Kindern. Abends im Speisesaal war es entsprechend laut, und die Servierer mit ihren Helfern trugen das ihre zum Lärm bei, indem sie Geschirr und Besteck mit „Karacho“ transportierten. Zum Glück war an der Rezeption eine nette Dame, und die besorgte ihnen eine ruhige Suite, Bademäntel und einen Safe. Am dritten Tag mieteten die beiden einen Heizlüfter, denn in der Suite wurde es abends lausig kalt. Auch in welcher Ecke man halbwegs ruhig essen konnte, wurde immerhin verraten: Alles wurde nach und nach besser.
Der Veranstalter lud zu einer „Kennenlerntour“ ein. Dazu fuhr ein Bus am Hotel vor. Silke und Andor stiegen ein und klapperten etliche Hotels in „Maspalomas“ und „Playa del Inglés“ ab. Dann fuhren sie ein Stückchen in die Berge zu einem angeblichen „Bauernhof“, der sich als Touristenschänke erwies. Alles sah so aus, als würden hier Reisende abends mit Sangria reichlich abgefüllt. Das „Anwesen“ lag über den Urlaubsorten, so dass man die gesamte Urlauberanlage einschließlich der Dünen von oben sehen konnte. Dann wurde jedem Gast ein Gläschen Honigrum gereicht – angeblich eine kanarische Spezialität. Auf den vielen Reisen zu den Inseln hatten die Stolps davon zuvor noch nie gehört.
Aber: „Salute!“ Es folgte eine Powerpoint-Präsentation, die etwas verunglückt war, weil sie dauernd stockte. Der Sinn war dennoch klar: „Kaufen, kaufen, kaufen!“ In diesem Fall ging es um Ausflüge, die verhökert werden sollten. Die Anmache war sogar erfolgreich, denn die Leute buchten und buchten, derweil die anderen auf einem Schotterplatz warten mussten und „Maspalomas“ und „Playa del Inglés“ von oben betrachten durften.
Gran Canaria hatte etwa 800.000 Einwohner. Die Hälfte davon lebte in „Las Palmas“, der Hauptstadt auch von „Lanzarote“ und „Fuerteventura“, die zusammen mit „Gran Canaria“ die spanische Provinz Gran Canaria bildeten. 1492 war Christoph Kolumbus von hier nach Indien gestartet, kam aber in Amerika an.
Einst hatte die Insel vom Zuckerrohranbau gelebt. Der wurde in die Karibik verlagert, wo man mit schwarzen Sklaven billige Arbeitskräfte hatte. Dann machte man mit Wein gute Geschäfte, bis die Reblaus kam. Die Portugiesen versorgten den Weltmarkt fortan mit ihrem Wein. Später baute man auf „Gran Canaria“ Bananen und Tomaten an. Aber der richtige Wohlstand kam erst mit dem Tourismus, der ab 1959 florierte. Hier auf „Gran Canaria“ waren Engländer wieder einmal Vorreiter.

Canarische Landschaft
Das Hotel der Stolps „Dunas Suites & Villen“ lag nicht an den berühmten Dünen und schon gar nicht am Meer. Dorthin musste man an einem ausgetrockneten Flussbett entlang laufen, dann kam man zum „Faro“ von „Gran Canaria“. Das sei der südlichste Punkt der Europäischen Gemeinschaft, hieß es. Rund um den „Faro“ gab es Restaurants und Geschäfte. Die Pizza kostete zwölf Euro: Alles für die Gäste!
Hier begannen die Dünen, hier war das Meer, und hier gab es was zu sehen. Urlauber zu Hauf wanderten entweder von Ost nach West oder umgekehrt. Es gab viele Dicke dabei und wenig Dünne, jede Menge Alte und weniger Junge. Von den Jungen wandelten viele wie lebende Poster durch die Gegend; sie waren manchmal geschmackvoll, meistens jedoch hässlich tätowiert.
Zwei Burschen hatten das Abendmahl Christi aus feuchtem Sand modelliert, ein Messi saß hinter einer Aufschrift: „Auch Landstreicher haben Hunger und Durst.“: Auf Deutsch!

