Stolps Reisen: Damals und heute, von den Anfängen bis zum Massentourismus
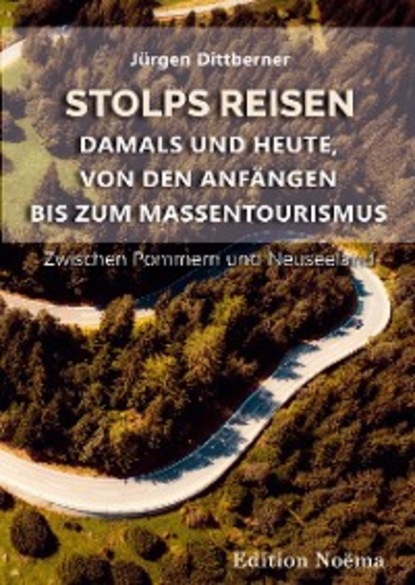
- -
- 100%
- +
Glücklicherweise konnte er im Hotel Karten drucken lassen. Während er auf die Karten wartete, beobachtete er, dass beim Auschecken von Paaren die Frauen die Rechnungen bezahlten und dass Japaner sich ständig voreinander verbeugten. Die Tiefe des „Dieners“ hing vom sozialen Rang des Gegenübers ab.
Unübersichtlich wie die Stadt waren die Entscheidungsstrukturen der „Nihon-Universität“. Der Präsident der Universität, Herr Kinoshita, so wurde gesagt, sei „krank“. Und da eine Neuwahl bevorstünde, müsse Herr Kinoshita ohnehin vorsichtig sein beim Gespräch über Investitionen. Aber Prof. Kajiwara war der Vertreter des Präsidenten und gleichzeitig sein „Leibarzt“. Der würde die Deutschen empfangen.
Am Morgen nach der Ankunft ging es zum Verwaltungsgebäude der Nihon-Universität. Durch Knäuel von Menschen hindurch eilte die Delegation zur U-Bahnstation. Der „Düsseldorfer“ ging stets voraus, man durfte ihn nicht aus den Augen verlieren. Alle Beschriftungen waren japanisch, so dass es kaum möglich war, sich zu orientieren.
Das Gebäude der Nihon-Universität war groß und beeindruckend. Unten leistete man sich ein kleines Gärtchen mit Fischteichen. Wie viele Millionen Yen mochten die paar Quadratmeter der Metropole wert sein, über welche die Fische da schwammen?
Die Delegation wurde in einen quadratischen Konferenzraum geführt, in dem um die leere Mitte Sessel gruppiert waren. Die Zeit blieb stehen. Nichts geschah. – Nach einer Weile ging die Türe auf und herein trat Prof. Kajiwara. Er war ein alter Mann, begrüßte alle sehr förmlich und nahm in einem Sessel gegenüber seinen Besuchern Platz.
Nichts Weiteres geschah.
Wer sollte jetzt anfangen?
Da begann der Vizepräsident und „Leibarzt“ leise und ohne jeden Blickkontakt: Es beeindrucke ihn sehr, dass die Herren eine so weite Reise gemacht hätten. Die „Nihon-Universität“ sei eine große Universität, da gäbe es viele Ansichten. Aber der Präsident interessiere sich für das Projekt in Deutschland. Leider sei er sehr krank.
Und damit endete die Ansprache von Prof. Kajiwara.
Es war Zeit für eine Entgegnung: Der Ministerpräsident ließe die besten Grüße bestellen und wünsche dem Präsidenten der Universität baldige Genesung. Sein Bundesland sei ideal für eine Investition. Die neue deutsche Hauptstadt, sei da gleich in der Nähe, und der gesamte Osten Europas läge vor der Tür. Auch besuche die Königin von England gerade diese Gegend...
Dem Vizepräsidenten war keine Reaktion anzumerken. Noch einmal nahm er das Wort: Leider sei der Präsident krank, aber demnächst würden einige Mitarbeiter der Universität nach Deutschland kommen. Er müsse nun gehen. Es habe ihn sehr gefreut, die Herren kennen zu lernen. Im Hinausgehen sagte er noch etwas zu einem unwirsch wirkenden Mann im hellen Anzug. Der verbeugte sich.
Eigentlich war der deutsche Politiker schon entschlossen, den als Gastgeschenk mitgebrachten Porzellan-Teller („von unserem König“) zu behalten. Da wurde der untersetzte Herr auf einmal freundlich und jovial. Was die Herren sehen wollten, fragte er. Die Wahl fiel auf die technischen Fakultäten. Deren Besuch wurde für den nächsten Tag verabredet. Nun stellte sich heraus, wer der Herr im hellen Anzug war. Es handelte sich um Prof. Sakuta, dem Leiter der universitären Fachkommission zum Investitionsprojekt in Europa.
Der Porzellanteller blieb am Ende doch in „Tokio“.
Es folgten weitere Gespräche mit Universitätsvertretern, mit dem deutschen Botschafter in „Tokio“, der deutschen Industrie- und Handelskammer sowie mit japanischen Geschäftsleuten. Allmählich schälte sich heraus, dass es an der Universität zwei Fraktionen gab: Die eine der nach Europa drängenden Expansionisten und die andere der für das Verbleiben auf Honshu kämpfenden Isolationisten. Wer sich warum und wie durchsetzen würde, vermochte niemand zu prophezeien. So meinten die Besucher, es könne nicht schaden, beim Besuch des „Meiji-Schreins“ Münzen zu spenden und dazu nach Landessitte in die Hände zu klatschen.
In der „Freizeit“ lernten die Deutschen, dass ein Essenservice in Japan aus je fünf Teilen bestand, das bei einem Geschenk die Verpackung wichtiger war als der Inhalt und dass ein Apfel fast so edel und kostbar sein konnte wie Gold.
Während des Besuches betonte der „Düsseldorfer“ immer wieder, wichtig für das Projekt sei Prof. Hamada. Den müssten die Herren unbedingt sprechen, und er würde ein Treffen mit ihm arrangieren. Doch alles müsse sehr vertraulich sein. Empört lehnte er es ab, einen Vertreter der deutschen Botschaft an dem Treffen teilhaben zu lassen: Irgendwie schien dieser Besuch auch ein geschäftliches Interesse zu tangieren.
Prof. Hamada hatte keinen Termin frei. Er sei zu Vorträgen in „Yokohama“, war zu hören. Ein anderes Mal hieß es, er hätte schon längst zu Hause sein müssen und seine Frau machte sich Sorgen. Dann wieder war er zwar in seiner „Praxis“ aufgetaucht (War er Mediziner?), dort jedoch so mit Terminen überhäuft gewesen, dass er gar keine Zeit für die Besucher aus Deutschland habe.
Plötzlich jedoch, am letzten Tag der Delegationsreise, verkündete ein strahlender „Düsseldorfer“, Herr Hamada habe Zeit. Er und weitere Professoren würden die Gäste gerne in ein traditionelles Restaurant zum Abendessen einladen.
„Das wird teuer für die!“, kommentierte ein ortskundiger Mitarbeiter der deutschen Botschaft, die trotz der Abwehr informiert war. Der Treffpunkt entpuppte sich als ein Restaurant mit niedrigen Räumen, Wänden wie aus Pappe, niedrigen Tischen und Kimono-bekleideten Damen. Eine Köstlichkeit nach der anderen wurde gereicht: „Shabu-shabu“, „Sukiyaki“, „Sushi“, „Sashimi“ und anderes. Dazu gab es immer wieder den warmen Reiswein – „sake“ – und Bier.
Die Damen hockten neben den Gästen und verfolgten jeden Bissen und jeden Schluck der Europäer. Die Gastgeber versicherten, das seien keine Geishas. Eine Musikergruppe spielte japanische Weisen. Jetzt tauten die japanischen Professoren auf: „Das ist von Hokkaido, wo ich herkomme, meine Heimat.“ – „Dieses Lied singt man in ‚Nagasaki‘, da müssen Sie ‘mal hin!“
Dann war Schluss mit dem Essen, aber nicht mit dem Trinken. In den Pappwänden öffneten sich Türen, und Monitore wurden herausgezogen. Die Damen, die keine Geishas waren, hatten Mikrofone in den Händen, und für die Japaner kam der Höhepunkt des Abends: „Karaoke“. Reihum musste jeder zu Videoclips den eingeblendeten Text bekannter Schlager singen. Die Deutschen taten sich schwer, doch die Japaner hoben ab. Am Schluss waren sie selig und kamen in Verbrüderungsstimmung. „Plost.“, kicherten sie.
Ende Januar des folgenden Jahres kam eine Delegation der „Nihon-Universität“ nach Deutschland. Hier wurden sie von allen verfügbaren Fachleuten empfangen. Im Hubschrauber überflogen sie das angebotene Gelände. Alles wurde fotografiert, sogar die Toiletten.
Dann nahmen sie alle ihre Geheimnisse (über den kranken Präsidenten, der wiedergewählt werden wollte, über die zwei Fraktionen in der Universität und über die wirkliche Bedeutung des Prof. Hamada) via „Krefeld“ mit nach Fernost.
Sie wurden in Deutschland niemals wieder gesehen.
(1992)
1 S. Jürgen Dittberner, Schwierigkeiten mit dem Gedenken. Auseinandersetzungen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, Opladen/Wiesbaden 1999, S. 168 ff
2 S. Jürgen Dittberner, Der Venezianische Löwenbrunnen in Berlin. Berlin und Potsdam –getrennt und vereint, Stuttgart 2018, S.154 ff
3 S. Jürgen Dittberner, Schwierigkeiten mit dem Gedenken., a.a.O., S. 171 ff
4 Ignatz Bubis, Die Holocaust-Museen in den USA: Ein Modell für Deutschland?; in: Jürgen Dittberner/ Antje von Meer (Hg.), Gedenkstätten im vereinten Deutschland. 50 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager, Berlin 1994
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

