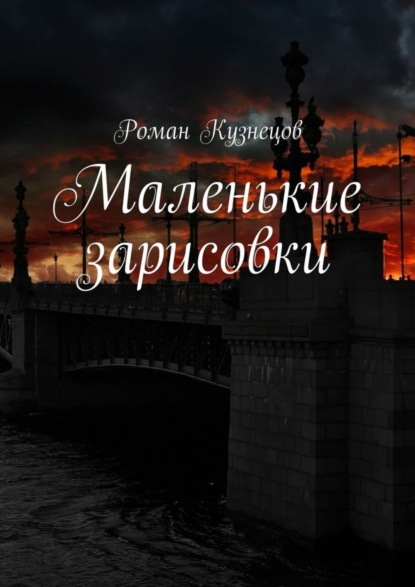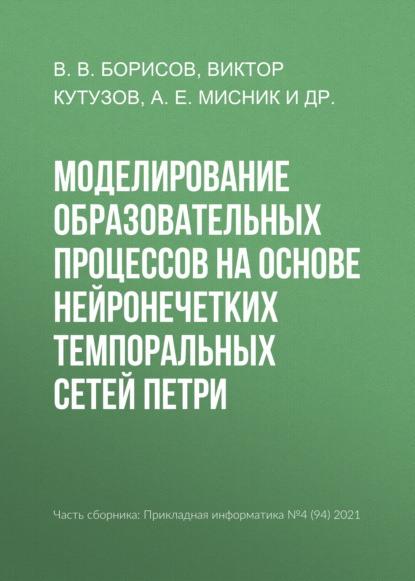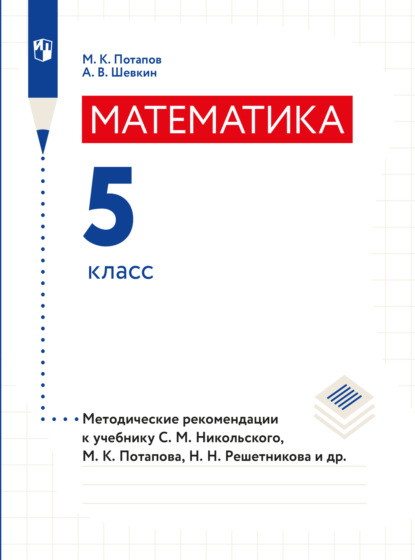- -
- 100%
- +
Warum ist ausgerechnet kurz nach 1945, also nach Beendigung der Nazi-Zeit, erstmals systematisch und weltweit in allen entwickelten Gesellschaften neben die herkömmliche moderne Ausgrenzung eine immer wirksamer werdene Bewegung der Emanzipation und Integration psychisch Kranker und anderer Behinderter getreten? Man wird es wohl nicht beweisen können, aber vieles spricht dafür, daß wenn schon kein Wissen, so doch ein Ahnen durch die Welt gegangen ist, daß die Vernichtungspolitik der Nazis vielleicht nur die Konsequenz aus der Institutionalisierungs- und Ausgrenzungspolitik der letzten 150 Jahre gewesen ist, daß sich damit der Weg als falsch oder zumindest als überholt erwiesen und daß man daher alle Anstrengungen zu unternehmen habe, auf dem Wege der De-Institutionalisierung die Wiederherstellung des unmittelbaren Miteinanders von Stärkeren und Schwächeren mit zeitgemäßen Mitteln zu versuchen. Auch das spricht dafür, daß ebenfalls seit der Nachkriegszeit neben die beiden anderen Kolonisierungsrichtungen im Hinblick auf die nicht industrialisierten Länder der Welt und im Hinblick auf die Natur erstmals systematisch De-Kolonisierungsbewegungen treten, wenn auch mit wechselndem Erfolg. Seit den 80er Jahren scheint nun die Bewegung der De-Institutionalisierung in eine kritische Phase gekommen zu sein. Diese ist nicht nur gekennzeichnet durch strukturelle Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, sondern auch dadurch, daß nun wieder das Reden vom »lebensunwerten Leben« öffentlich erlaubt ist, daß gefordert wird, pflegebedürftige Menschen sollen sich von ihrem Arzt den Tod geben lassen, daß eugeniknahe pränatale Diagnostik verlangt wird, daß mit dem Hirntod die Todesdefinition ein Stück weit ins Leben vorgeschoben wird, daß behinderte Neugeborene nicht unbedingt leben müssen, daß Eingriffe an Behinderten vorgenommen werden sollen, daß genetische Eingriffe die Identität des Menschen fraglich machen sollen, daß Träger psychiatrischer Krankenhäuser sich an ihren letzten Anstaltsinsassen wie an Geiseln festklammern, um ihre Existenz zu sichern, usw. Das ganze wird garniert von einem merkwürdigen Ethik-Boom, von dem aber nur die utilitaristischen Bioethik-Konzepte öffentliche Aufmerksamkeit finden, also gerade die philosophische Tradition, die auch schon durch Philosophen wie J. Bentham um 1800 zur Akzeptanzbeschaffung für das Projekt der Moderne diente. Im Gesundheits- und Sozialwesen wird jetzt nicht mehr nur von Rationalisierung, sondern von Rationierung gesprochen, weil »nicht mehr alles bezahlt werden« könne. Die profitträchtigen Grenzen des technisch Machbaren immer weiter hinauszuschieben und sich hier gegen die Konkurrenz zu behaupten, koste so viel Geld, daß für die Grundbedürfnisse aller Menschen im Kernbereich der Gesellschaft nicht mehr genug Geld da sei. Die abstrakt-bürokratische Form der Solidarität zwischen Stärkeren und Schwächeren über den Finanzausgleich zwischen Wirtschafts- und Sozialsystem der 150jährigen Zeit der Moderne beginnt zu bröckeln, während noch nicht gesichert ist, wie weit sie durch eine neue, postmoderne gemeindepsychiatrische kommunale Solidarität ersetzt werden kann, während die Teilhabe der psychisch Kranken am Arbeitsmarkt als Beweis für eine gelungene Emanzipation und Integration bestenfalls unterwegs ist.
Diese kritische Phase, diese Krise ist ernst zu nehmen, jedoch nur bei mangelndem historischen Bewußtsein ein Grund zur Resignation. Die Grundkenntnisse von »Bürger und Irre«, die sich bis heute eher zunehmend bestätigt haben und aus sich heraus weiterentwickelt werden können, wie ich dies in diesem Vorwort hoffe gezeigt zu haben, dürften hinreichend tragfähig sein, um auch für unsere Gegenwart zu handlungsleitenden Perspektiven zu führen. Wenn die umfassende aufklärerische Vernunft mit Beginn der Moderne sich in ein konkurrierendes Verhältnis zwischen instrumentelier Individualvernunft (oder Ethik) und bezie-hungsstiftender Sozialvernunft (oder Ethik) aufgespalten hat, die erstere während des 150jährigen Projektes der Moderne federführend war, während die letztere nur um den hohen Preis der Institutionalisierung der schwächeren Bevölkerungsteile überwintern konnte, dann hat die Sozialvernunft seit der Bewegung der De-Instutionalisierung der Nachkriegszeit erheblich aufgeholt. Wir befinden uns also heute in einer wesentlich besseren Lage als noch vor 50 oder 100 Jahren, nämlich in der Lage, in der beide Ausformulierungen der Vernunft (oder der Ethik) sich in einem wesentlich gleichberechtigteren Gleichgewicht oder Spannungsverhältnis befinden. Beide nämlich sind von gleicher Notwendigkeit für eine gedeihliche Weiterentwicklung der Gesamtgesellschaft, wobei wir aus der Geschichte der Moderne gelernt haben dürften, daß es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, daß keine Seite die andere dominieren darf, daß das Spannungsverhältnis erhalten bleibt. Selbst das Fernziel als Beweis für die Vollständigkeit einer gelungenen De-Institutionalisierung, nämlich die Wiedervereinigung von Wirtschafts- und Sozialsystem als wesentlichen Spaltprodukten des Urknalls der Moderne, ist zunehmend wahrnehmbar und erlebnisfähig: Die Werkstätten für Behinderte sowie die Selbsthilfe- und Zuverdienstfirmen sind Zonen der Wiedervereinigung von produktivem und sozialem Tun – sowohl im einzelnen Menschen als auch in der Gesellschaft. Wer’s nicht glaubt, suche einen solchen Ort auf und lasse die Atmosphäre auf sich wirken.
Klaus Dörner
Januar 1995
Vorwort zur zweiten Auflage
1962 fing ich in Berlin an mit den Vorarbeiten zu »Bürger und Irre«. 1967 begann ich mit der Niederschrift des Buches am Vormittag des Tages, an dem Benno Ohnesorg während der Anti-Schah-Demonstration erschossen wurde. In der Folge war ich während des Schreibens aktiv an der antiautoritären Studentenbewegung beteiligt. Die Ereignisse dieser Zeit haben mich beim Schreiben beeinflußt. Als das Buch 1969 erschien, war es nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich ein Produkt dieser Bewegung.
Inzwischen gibt es das Buch in einer italienischen, spanischen und englischen Übersetzung. Es scheint wahrhaft von interdisziplinärem Interesse zu sein; denn es hat mich in Diskussionen verwickelt, nicht nur mit Medizinern und Soziologen, sondern auch mit Psychologen, Pädagogen, Romanisten, Anglisten, Germanisten, Ökonomen, Politikern und Historikern. Schließlich war diese Arbeit über die Entstehung der Psychiatrie hilfreich bei der Entstehung der Psychiatrie-Bewegung in der Bundesrepublik und in Italien.
Gleichwohl ging ich mit einigem Bangen an die Überarbeitung, als mir der Verlag die Absicht mitteilte, eine Neuauflage herauszugeben. Die Studentenbewegung liegt 13 Jahre zurück. Fast ebenso alt ist inzwischen die Psychiatrie-Bewegung. Neue psychiatrie-historische Arbeiten sind inzwischen erschienen. Und ich selbst habe inzwischen ohne Unterbrechung in der Psychiatrie praktisch gearbeitet, habe mich dadurch auch selbst geändert und bin ein Teil des psychiatrischen Versorgungssystems und der Wissenschaft Psychiatrie geworden, die ich damals, nicht gerade zimperlich, vom hohen Roß der Theorie herab beschrieben und beurteilt habe.
Nach Abschluß der Überarbeitung nehme ich es mir heraus, einigermaßen selbstzufrieden zu sein. Zwar mußte die Einleitung über weite Strecken neu geschrieben werden, um die nicht nur theoretische, sondern auch praktische Absicht der Arbeit verständlicher zu formulieren. Mein gestelztes Akademikerdeutsch, das ich mir im Studium mühsam angequält hatte, habe ich an vielen Stellen mit ebensoviel Mühe wieder aufs Alltagsdeutsch heruntergeschraubt. Gedanken neuerer Untersuchungen waren einzuarbeiten. Zahlreiche Streichungen und Ergänzungen waren fällig, da ich mit vielen Einzelheiten nicht mehr einverstanden sein konnte. Das betrifft inhaltlich vor allem drei Fragen, die mir heute aus meiner Praxis heraus wichtiger sind als damals: Erstens die Frage, ob und in welcher Weise Psychiatrie mehr eine medizinische oder eine philosophische Wissenschaft ist, ein Problem, das bei jeder Teamarbeit mit Angehörigen anderer Berufe unabweisbar ist. Zweitens die Frage nach der anthropologischen Orientierung der Psychiatrie, da ich ohne eine solche viele meiner psychiatrischen Alltagshandlungen weder begründen noch rechtfertigen kann. Und drittens die Frage, in welcher Weise ich die Psychiatrie der Zeit des Dritten Reiches als einen Teil meiner Berufsgeschichte insgesamt annehmen kann, eine Frage, die damit verknüpft ist, daß in der Psychiatriegeschichte unterschiedliche Traditionen sich verweben, die den Anderen, den psychisch Kranken, als Feind, als Freund oder als Gegner sehen.
Systematisch unzufrieden war ich mit meiner arroganten Bewertung der daseinsanalytischen und anthropologischen Psychiatrie der Nachkriegszeit. Hier hatte ich damals offenbar zu wenig Abstand, um die Notwendigkeit ihrer Beerbung wahrnehmen zu können. Ich habe im Anhang darüber berichtet und im Text entsprechende Korrekturen angebracht. Im Anhang habe ich auch den Fortgang der Psychiatriegeschichtsschreibung dargestellt. Besonders zufrieden macht mich, daß es mir offenbar damals schon gelungen ist, Aufklärung und Romantik aus einem gegensätzlichen in ein inhaltlich dialektisches Verhältnis zu setzen; denn unzweifelhaft stehen wir in beiden Traditionen, und beide sind gleich wichtig für uns. Diese – wie ich meine – angemessenere Sicht der Romantik war damals noch ungewohnt, beherrscht jedoch heute zu Recht die Diskussion.
Aus diesem und anderen Beispielen habe ich für mich den Schluß gezogen, daß »Bürger und Irre« von seiner Aktualität nichts verloren hat. Die Tatsache, daß es inzwischen zahlreiche Einzeluntersuchungen gibt, die auf meinem Weg weitergehen, bestärkt mich darin.
Solange psychisch Kranke bestenfalls nur den halben Pflegesatz im Vergleich zu körperlich Kranken zugesprochen bekommen, dauert die ungleiche Auseinandersetzung zwischen »Bürgern« und »armen Irren« an.
I. Einführung
1. Absicht der Untersuchung: Selbstaufklärung der Psychiatrie
Seit Einstein und Heisenberg quälen sich die Naturwissenschaftler mit der Frage nach der Legitimität, nach der Berechtigung ihrer Tätigkeit angesichts der grenzenlosen Möglichkeiten, aber auch Gefahren der modernen Naturwissenschaft. Und es ist gut möglich, daß unser aller Leben mehr von der Ehrlichkeit und Stetigkeit dieses »Sich-Quälens« abhängt als von dem sonstigen Tun der Naturwissenschaftler. In diesem Zusammenhang definieren sie die »klassische« Naturwissenschaft als Einzelfall der modernen Naturwissenschaft, stellen Fragen nach der Rolle des Subjekts im naturwissenschaftlichen Kalkül, nach der ethischen Begründung der Machbarkeit des Machbaren, nach ihrer eigenen Geschichte, dem historischen Warum und Wozu ihres Handelns und nach den gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Bedingtheiten und Auswirkungen ihrer Arbeit. Kurz, nachdem die Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts die Erkämpfung der Eigenständigkeit ihrer Wissenschaft durch Sprengung der Fesseln der Philosophie gefeiert hatten, bemühen sie sich im 20. Jahrhundert um die Wiederherstellung der handlungsorientierenden Bindungen des philosophischen Denkens. Sie quälen sich mit ihrer eigenen Selbstaufklärung.
Die Psychiater bzw. psychiatrisch Tätigen aller Berufe haben allen Anlaß, diesem Beispiel der exakten Naturwissenschaften zu folgen. Gegenüber der »klassischen Psychiatrie« können auch sie von schier grenzenlosen Möglichkeiten – z. B. der Psychotherapie, der Chemotherapie oder der soziotherapeutsch-gemeindepsychiatrischen Lokalisierung von Menschen – sprechen, aber auch von grenzenlosen Gefahren, wenn man nur an die Opfer der Gehirnoperationen seit den 30er Jahren oder der Euthanasieaktionen während der 40er Jahre denkt. Was die Atombombe von Hiroshima für die Physik ist, sind die Gaskammern von H adamar für die Psychiatrie.
Dennoch tun sich die Psychiater schwerer als die Physiker, obwohl es in beiden Fällen um dieselbe Frage geht, die nach der Grenze zwischen erlaubten und unerlaubten Beziehungen zwischen Menschen. Erst in der jüngsten Zeit nimmt die Bereitschaft der psychiatrisch Tätigen zu, sich angesichts der eigenen Geschichte der Aufgabe der Selbstaufklärung zu stellen. Diese Untersuchung möchte die Bereitschaft hierzu fördern, die Bereitschaft, das alltägliche Handeln mit dem Nachdenken über die Wahrheit dieses Handelns zu begleiten.
Die Untersuchung beschäftigt sich nur mit einer der oben angedeuteten lebensnotwendigen Fragen: der Frage nach der Entstehung der Psychiatrie als Institution und Wissenschaft. Angesichts der Tatsache, daß die europäischen Nationen auf einem bestimmten Stand ihrer gesellschaftlichen Entwicklung ein spezielles psychiatrisches Versorgungssystem und eine ebensolche Wissenschaft ausgebildet haben, ist die Frage berechtigt: Warum ist überhaupt Psychiatrie und nicht vielmehr keine Psychiatrie? Es ist dies eine Frage nach dem Grund der Psychiatrie, nach ihren Ursachen, Bedingungen und damit auch nach ihren Aufgaben und ihrem Zweck. Der Titel Bürger und Irre besagt, daß das Verhältnis zwischen den Irren und der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt, deren auf die Irren professionell bezogene Stellvertreter die Psychiater sind, erörtert wird. Dabei muß jedoch gleich eingeschränkt werden, daß das Verhältnis zwischen Bürgern und Irren mehr in der Sicht der Bürger bzw. Psychiater und weniger in der Sicht der Irren dargestellt wird, da mir zum Zeitpunkt der Niederschrift der Studie für eine gleichgewichtige Beschreibung des Wechselverhältnisses zwischen Bürgern und Irren die erforderlichen Quellen und methodischen Voraussetzungen noch fehlten. Erst 1980 hat der Historiker Blasius den ersten schüchternen Versuch unternommen, die Geschichte der Psychiatrie aus der Perspektive der Irren, also der Betroffenen darzustellen. Hier wartet noch viel Arbeit. Sind im Selbstverständnis der Psychiater die Irren »Gegenstand« der Psychiatrie, so macht diese Untersuchung immerhin Irre und Psychiater-Bürger zugleich zu ihrem »Gegenstand« und sucht die sozio-ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen zu ermitteln, unter denen im Zusammenhang mit der politischen und industriell-kapitalistischen Revolution der bürgerlichen Gesellschaft auch jenes Verhältnis von Bürgern und Irren entstand, das die Institution und Wissenschaft Psychiatrie begründete. In diesem Rahmen lenkt die Untersuchung die Aufmerksamkeit vor allem auf drei Probleme, die ihr ein über den Fall der Psychiatrie hinausgehendes, allgemeines Interesse verleihen könnten. Erstens wird die Dialektik aller modernen Wissenschaft verfolgt, die Dialektik zwischen ihrem Anspruch auf Emanzipation des Menschen als Einlösung des Versprechens der Aufklärung einerseits und ihrer oft entgegengesetzten Wirkung der Rationalisierung, Integration und Kontrollierbarkeit des je bestehenden Gesellschaftssystems andererseits. Zweitens zwingt die Tatsache, daß die Bürger die Psychiatrie gerade zur Domestizierung der armen Irren eingesetzt haben, dazu, in diesem Vorgang auch ein Moment des Klassenkampfes und eine der ersten Lösungen der aufkommenden »sozialen Frage« zu sehen, so daß die Untersuchung nicht nur zur Selbstreflexion der Psychiatrie beiträgt, sondern zugleich über eine bisher vergessene Wurzel und Vorform der Soziologie berichtet. Drittens endlich steht zur Diskussion das Wechselverhältnis von Vernunft und Unvernunft – u. a. als Gesundheit und Krankheit –, in der äußeren Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft ebenso wie in der inneren Ökonomie ihrer Mitglieder.
2. Zum Vorverständnis der Beziehung zwischen Psychiatrie und Soziologie
Thema und Absicht der Untersuchung verlangen es, zugleich sozialhistorisch und soziologisch vorzugehen, wobei Soziologie als historische und vergleichende Disziplin sowie als Wissenschaftssoziologie anzuwenden ist. Da Psychiater und Soziologen – namentlich im deutschsprachigen Bereich – weitgehend verschiedene Sprachen sprechen, mögen einige vorklärende Ausführungen für das gegenseitige Verständnis nützlich sein. Der Leser, dem dies überflüssig erscheint, kann dieses Kapitel ohne großen Verlust überschlagen und bei I, 3 weiterlesen.
Jede der beiden Wissenschaften Psychiatrie und Soziologie hat sich daran gewöhnt, sich auf die begriffliche Autorität der jeweils anderen zu stützen. Wie die Psychiatrie soziologische – besser: epidemiologische, sozialstatistische und sozialfürsorgerische – »Gesichtspunkte« berücksichtigt, so bedienen sich fast alle soziologischen Schulen, namentlich seit Freud, psychiatrischer Begriffe, die vielerorts nachgerade die Analyse in ökonomischen Kategorien ersetzen. Hieraus resultierte für die Soziologie ein bedenklicher Irrtum: sie identifizierte unbesehen Psychoanalyse mit Psychiatrie überhaupt. Verdeckt blieb dabei, daß die Psychoanalyse ein wie immer bedeutendes, aber eher spätes Produkt des zur Zeit Freuds hundert- bis hundertfünfzigjährigen wissenschaftlichen psychiatrischen Denkens ist. Verdeckt blieb die bereits lange in Gang befindliche Ablösung der Psychiatrie von der Philosophie und von der ursprünglich ganzheitlichen Medizin, ähnlich die ebenso problematische Emanzipation der Soziologie von Philosophie und Ökonomie. Diese unhistorische, verengte Sicht leistete einem soziologischen Verständnis der Gesamtrealität der Psychiater Vorschub, das die beiden Symbole, Anstalt und Couch, entweder beziehungslos nebeneinanderstellt oder naiv den Sieg der Couch über die Anstalt feiert.
Warum nun griff die Soziologie zwar die Psychoanalyse, nicht aber die früheren psychiatrischen Ansätze auf? Da ist einmal der Anspruch der Psychoanalyse, eine lückenlose Erklärung menschlichen Leidens (von der Ätiologie bis zur Therapie) möglich zu machen. Sodann sind die Freudschen Begriffe und Sprachbilder deshalb so faszinierend, weil ihr psychologischer Gehalt kaum von anatomischen, physiologischen und neurologischen Vorstellungen1 einerseits, sowie von soziologischen Vorstellungen andererseits zu trennen ist. Dem entspricht methodologisch, daß Freud die Grenze zwischen Natur- und Geisteswissenschaft, zwischen der Konstruktion zu prüfender Hypothesen und dem hermeneutischen Vorgriff unscharf hält.2 Da alle psychiatrischen Probleme entsprechend der Natur des Menschen nur in dieser doppelten, natur- und geisteswissenschaftlichen Sichtweise zu denken sind, ist dies ein angemessenes Vorgehen, jedoch nur, solange die Spannung zwischen beiden Sichtweisen aufrecht erhalten und nicht um einer scheinbaren Vereinfachung willen zur einen oder anderen Seite hin aufgelöst wird. Diese Gefahr bestand schon bei Freud selbst, da er sich durchaus als naturwissenschaftlich verfahrender Mediziner verstand, und mehr noch bei seinem Zeitgenossen Kraepelin, dem Schöpfer der klassischen psychiatrischen Krankheitssystematik. Es gehört zu den schrecklichsten Versuchungen der Psychiatrie, Meinungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen im Umgang mit leidenden Menschen nicht nur zu typisieren, sondern ihnen eine pseudonaturwissenschaftliche Weihe zu geben, die es scheinbar erlaubt, diese Meinungen für die »objektive Realität« zu nehmen. Merkwürdigerweise scheint diese Verführung für Mediziner und insbesondere Psychiater weit größer zu sein als für exakte Naturwissenschaftler. Der Gefahr sind auch nicht so sehr Freud bzw. Kraepelin selbst erlegen als vielmehr ihre Nachfolger. Zwei Beispiele für die Gefahren der Auflösung dieser Spannung: Es sind Annahmen der klassischen Kraepelinschen Psychiatrie (z. B. von der Heilbarkeit bzw. Unheilbarkeit psychischer Krankheiten) gewesen, die vor und während der Zeit des Dritten Reiches für sozialdarwinistische Zielsetzungen die naturwissenschaftliche Legitimation lieferten, so daß die Psychiater, die die Sterilisierungs- und Euthanasie-Aktionen organisierten und durchführten, sich im Recht und im Schutze wissenschaftlicher Wahrheit glaubten.3 Das andere Beispiel: In den USA wurde der naturhaft-biologische Aspekt der Freudschen Psychoanalyse mehr oder weniger hinwegkastriert. So konnte sie nur noch in dieser entschärften Form der »kulturalistischen Schule« (Sullivan, Horney, Thompson, Fromm) auf die Soziologie und namentlich auf deren strukturell-funktionale Theorie wirken. Und in der »Mental Health«-Bewegung verkehrt sich der kritische Impuls Freuds nachgerade in Begeisterung für selbstverantwortliche Anpassung.4
Diese Entwicklung entsprach der einer Soziologie, die ihrerseits zwischen Durkheim, Max Weber und Mannheim einen Prozeß der Repsychologisierung durchlief, sich zur Theorie der zwischenmenschlichen Beziehungen formalisierte und insbesondere in den USA den »subjektiv gemeinten Sinn« mit dem agierenden gesellschaftlichen »System« zu harmonisieren verstand.
So scheint es, daß die Annäherung von Soziologie und nach-Freudscher Psychiatrie um den Preis einer Sichtverengung, der teilweisen Ausblendung von Wirklichkeitsbereichen erfolgte, besonders solcher Bereiche, die der rationalen und sinngebenden Naturbemächtigung den größten Widerstand entgegensetzen. In der Psychiatrie gilt das vor allem für die Psychose-Patienten, die Kerngruppe der früheren »Irren«, für hirnorganisch kranke Leute, für »unheilbar« hirnorganisch abgebaute Alkoholiker, für »Persönlichkeitsstörungen« (früher Psychopathen, jetzt Soziopathen), Menschen mit Sexualstörungen und psychisch kranke alte Leute. All diese Gruppen, bei denen auch der körperliche Anteil der menschlichen Natur eine wesentliche Rolle spielt, bilden zusammengenommen die Hauptklientel der psychiatrischen Alltagspraxis. So befinden wir uns in der paradoxen Lage, daß die modernen psychologisierenden oder soziologisierenden psychiatrischen Theorien einzig der Minderheit der weniger psychisch kranken Patienten gelten, während für die kränkere Mehrheit nur die allenthalben als überholt erachtete »klassische« psychiatrische Krankheitslehre mit ihrem Pseudo-Objektivitätsanspruch sowie die als »angewandte Psychiatrie« bezeichnete körpermedizinische Technik und Administration der Anstaltspraxis zur Verfügung stehen. Hinzu kommt die Bestimmung der Therapiefähigkeit der Menschen nach sozialem Status, Einkommen und Intelligenz.5
Die körperliche Seite der menschlichen Natur ist und bleibt ein anstößigprovozierendes Kernproblem der Psychiatrie. Es wird vermieden und verdrängt entweder durch die mehr oder weniger gewalttätigen Versuche der bloß technischen Naturbeherrschung oder – moderner – durch die Leugnung seiner Existenz. Nachdem etwa 80 Jahre lang die psychiatrische Theoriebildung von den psychiatrischen Universitätskliniken ausging, ist es wahrscheinlich, daß eine umfassende, den Körper nicht ausblendende und in einer philosophischen Anthropologie fundierte psychiatrische Theorie am ehesten von den Anstalten, den heutigen psychiatrischen Krankenhäusern – schon wegen der praktischen Problemkonfrontation dort – zu erwarten ist. Dagegen verrät die beliebte Erklärung, die psycho- und soziologi-sierende Tendenz der gegenwärtigen psychiatrischen Theoriebildung sei nur eine Gegenreaktion auf die biologistische Einseitigkeit der medizinischen und psychiatrischen Sichtweise des 19. Jahrhunderts, die ihre schreckliche Zuspitzung im Dritten Reich erfahren habe, ein falsches Verständnis sowohl der Geschichte als auch der Naturwissenschaft und bleibt als bloße Gegenposition von der bekämpften Position abhängig. Vergessen wird dabei, daß dies nur ein Beispiel des universalen Prozesses der Vergesellschaftung der Wissenschaft überhaupt ist, ablesbar z. B. an der Neigung, »geistige Gesundheit« (»mental health«) zum umfassenden Zweck zu erheben.6 Die Aufspaltung von Theorie und Praxis sowie die Vergesellschaftung der Wissenschaft zeigen, wie sehr die Psychiatrie in der Dialektik steht, zugleich der Freiheit und Sicherheit, der Emanzipation leidender Menschen und der reibungslosen Integration, also der Bändigung sprengender, auflösender und destruktiver Kräfte zu dienen, d. h. in der »Dialektik der Aufklärung«. Diese Dialektik von Emanzipationsversprechen und Stabilisierungsverlangen beherrscht freilich auch die Entstehungsgeschichte und die seitherige Entwicklung der Soziologie. Soziologie und Psychiatrie nahmen gemeinsam ihren Ausgang von dem Bild, das der vernünftige Bürger sich von der Unvernunft, ob diese nun als Armut, als Irresein oder als beides zugleich sich äußerte, machte. Beide Wissenschaften begannen als Bewältigungsversuche der durch die bürgerlichen und industriellen Revolutionen bedingten sozialen Krise, sind insofern Krisenwissenschaften. Diese Gemeinsamkeit legen wir unserer Untersuchung zugrunde, da es nichts nützen würde, wenn wir uns bei der soziologischen Analyse der Psychiatrie lediglich auf deren gesellschaftliche Bedingtheiten stützten. Vielmehr benötigen wir statt eines solchen reduktionistischen Konzepts einen historisch und philosophisch reflektierten soziologischen Ansatz. Wir glauben ihn in Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung gefunden zu haben. Aufklärung wird dort kritisch verstanden als »Unterwerfung alles Natürlichen unter das selbstherrliche Subjekt«7, die Materie, der »Illusion waltender oder innewohnender Kräfte, verborgener Eigenschaften« beraubt, als Chaos und daher der bemächtigenden Synthese bedürftig erkannt.8 Werden Herrschaft und Selbstbeherrschung, zwanghafte Selbsterhaltung, »Beherrschung der Natur drinnen und draußen zum absoluten Lebenszweck«, dann erscheint alles, was dem ordnenden und verfügenden Zugriff sich entzieht, was außerhalb bleibt, als »absolute Gefahr« für die Gesellschaft, als Quelle der Angst und wird deshalb mit dem Stigma der Irrationalität, der Unvernunft versehen und ausgegrenzt9: »die unerfaßte, drohende Natur«; »die rein natürliche Existenz«; Instinkte, Phantasie und theoretische Einbildungskraft; »Promiskuität und Askese, Überfluß und Hunger [...] als Mächte der Auflösung«; das Unverbindbare, der Sprung, die Vielheit, das Inkommensurable, weggeschnitten von »der universalen Vermittlung, dem Beziehen jeglichen Seienden auf jegliches«; »das Unbekannte«, das »in der vorwegnehmenden Identifikation zum Altbekannten gestempelt wird«; »noch die letzte unterbrechende Instanz zwischen individueller Handlung und gesellschaftlicher Norm«, die der Positivismus beseitigt; »der Selbstvergessene des Gedankens wie der der Lust«; die allgemeine »Angst, das Selbst zu verlieren«, die besteht, solange Selbsterhaltung, Identitätsfindung das allein herrschende gesellschaftliche Prinzip sind.10 Allen diesen Ausdrucksformen des bürgerlich Unvernünftigen werden wir als Äußerungen der Unvernunft des Irreseins wiederbegegnen. Jedenfalls markieren sie den Gegenstandsbereich der Psychiatrie, jene als inkommensurable und daher als unvernünftig bezeichneten ›Abfallprodukte‹ und Korrelate des fortschreitenden Aufklärungs-, Rationalisierungs- und Normierungsprozesses. Genau dies kennzeichnet die Dialektik der Psychiatrie. Hat sie das Irrationale der Rationalisierung zuliebe zu verdecken oder es aufzudecken, es einzuordnen oder es aufzuklären? Denn verdankt sie sich selbst auch dem sich totalisierenden Prozeß der Aufklärung sowie dessen Gegenbewegung, der Romantik, so steht sie doch zugleich unter dem unaufhebbaren Anspruch der Aufklärung: »Einlösung der vergangenen Hoffnung«11; Freilegung des Unbekannten selbst, auch gegen die rationale Angst, die dies erzeugt; »die Herrschaft bis ins Denken hinein als unversöhnte Natur zu erkennen« und so die »Verwechslung der Freiheit mit dem Betrieb der Selbsterhaltung« zu lockern12, indem die »Frakturen von Sinn«13 durchgehalten und einbegriffen und nicht als unvernünftig ausgeblendet werden.