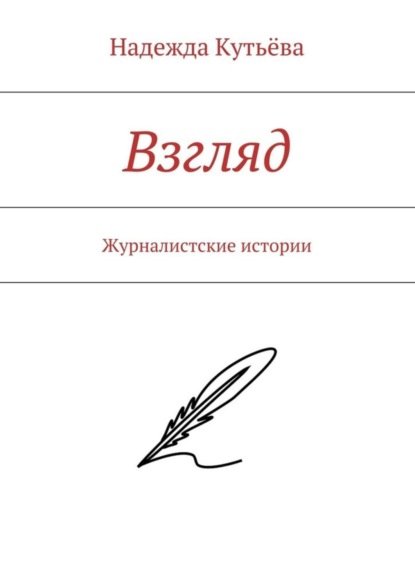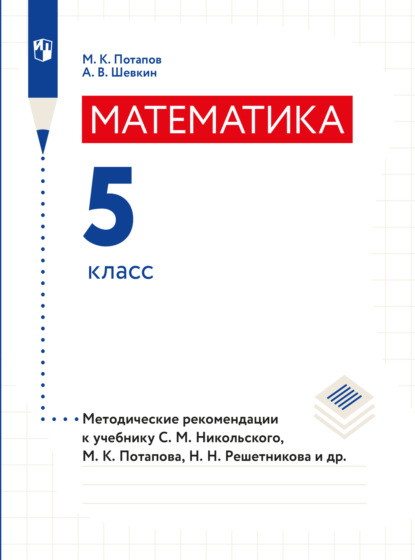- -
- 100%
- +
Innerhalb dieses beiden Wissenschaften gemeinsamen Rahmens ist unsere Untersuchung notwendig, wenn immer es stimmt, daß »das gesellschaftliche Selbstverständnis der Wissenschaft [...] im Begriff der Wissenschaft selbst als Forderung enthalten«14 ist, und sie hat ihr Wahrheitskriterium am dialektischen Begriff von Aufklärung.
Inwieweit haben nun die neueren historisch-theoretischen Darstellungen der Psychiatrie sich mit den hier beschriebenen Aufgaben beschäftigt? Diese Frage steht im Mittelpunkt des ersten Abschnitts des Anhangs.15 Die Ausbeute ist gering, obschon seit 1969, dem Erscheinen der 1. Auflage dieses Buches, erfreulicherweise größer geworden. Es folgt daraus, daß unsere Untersuchung vorwiegend deskriptiv-historisch vorgehen, psychiatrisches Denken und Handeln und deren Zusammenhang erst ausbreiten und bekanntmachen muß. Außerdem ergibt sich daraus, welche Aspekte der Psychiatrie ausgeblendet, einseitig dargestellt oder ideologisch nicht mit ihrem eigenen Anspruch konfrontiert worden sind, woran umgekehrt deutlich wird, in welcher erweiterten (oder auch beschränkenden) Weise der Gegenstand unserer Untersuchung zu sehen und zu reflektieren ist.
Daß die Kritik des naturwissenschaftlichen Selbstverständnisses der Psychiatrie nur da berechtigt ist, wo es ideologisch zur Absicherung theoretischer Meinungen und politischer Ziele mißbraucht wird, ist bereits gesagt worden. Die anthropologische Fundierung der Psychiatrie, namentlich der frühen Nachkriegszeit, ist leider mehr oder weniger folgenlos geblieben, zugunsten einer insgesamt technokratisch verkürzten Wahrnehmung psychischen Leidens. Diesen anthropologischen Denkansatz aufzugreifen und zu beerben steht noch bevor. Erst dann wäre die Abgrenzung zwischen dem, was naturwissenschaftlich zu erklären, und dem, was geisteswissenschaftlich zu verstehen ist, möglich. Dasselbe gilt für die Frage, wann Leiden zu verändern und wann es zu akzeptieren ist. Anders formuliert: Wann handelt der Psychiater als Mediziner und wann als Arzt? Wann handelt er therapeutisch, wann pädagogisch? Noch anders: Wird psychiatrisches Handeln nicht erst jenseits von »Therapie«, in der Konfrontation mit »Unheilbaren« interessant?15 Totalitär und menschengefährdend kann beides sein: erklären, wo es nichts zu erklären gibt, und verstehen, wo es nichts zu verstehen gibt.16 Weil das so ist, sind auch die bisherigen Ansätze der Psychiatriegeschichtsschreibung unzureichend, sowohl das ideengeschichtliche Verfahren in der Absicht, »die Tätigkeit des Menschen in der Gesellschaft über die Grenzen des Momentes und des Ortes zu erheben«17, als auch das kulturgeschichtliche (Kirchhoff, Birnbaum). Daher hat nach der Zeit des Nationalsozialismus die Nachkriegs-Sozialgeschichte die Kulturgeschichte als abstraktes Korrelat der Machtgeschichte kritisiert.18 Daher ist auch der Weg der deutschen Wissenssoziologie, wie er von Dilthey gebahnt, von Mannheim beschritten wurde und heute von Gadamer19 fortgesetzt wird, in Frage gestellt worden. Unsere Bedenken entsprechen der in den letzten Jahren geübten Kritik an der Wissenssoziologie, so von Lenk20, Plessner21, Wolff22, Lieber23, Hofmann24 und Habermas25.
Wurde im 18. Jahrhundert die Verhinderung von Erkenntnis der Niedertracht der Herrschenden (Priestertrug-Theorie) bzw. dem subjektiven Vorurteil zugeschrieben, so galt sie im 19. Jahrhundert als objektiv notwendige Ideologie, gemessen an den jeweiligen Schranken des naturwissenschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Fortschritts. Im 20. Jahrhundert führt das zur Selbstunterwerfung der Erkenntnis und des Urteils unter die Sinnkontinuität des geschichtlich gewordenen Vorurteils, zur selbsttätigen Anpassung an die Gegebenheiten.26 »Indem die Philosophie ihren Ausgangspunkt, das ›In-der-Welt-Sein‹ des Menschen, selbst wieder auf seine Existenzialien oder bleibenden Bestimmungen hin abfragt, verliert sie Geschichte und Gesellschaft als je konkreten Prozeß entweder ganz aus dem Blick, oder aber sie gerinnen ihr begrifflich zu so etwas wie ›Geschichtlichkeit‹ und Soziabilität‹.«27 Eine ähnliche Kritik an der Entrückung von Gegenständen in eine phänomenale Begrifflichkeit bzw. in eine je eigene »Welt« trägt Plessner vor: »Die Leiblichkeit als ein Strukturmoment der konkreten Existenz, mit der sie sich auseinandersetzen muß und die sie in den verschiedenen Modi der Zuständlichkeit und Widerständlichkeit durchzieht, wird nicht als Körper zum Problem. Das überläßt man der Biologie und den organischen Naturwissenschaften.«28
Zum Begriff der Wissenschaft gehört aber beides, nicht nur die fortschreitende Stabilisierung ihrer selbst und durch sie ihrer Gesellschaft (in technischer Beherrschung, Systembildung wie in Sinngebung); zu ihr gehört auch die fortschreitende Aufklärung ihrer selbst und ihrer Gesellschaft. Ein solches objektiv sinnverstehendes Denken bleibt nicht bei dem durch das Bewußtsein der handelnden Individuen vermittelten subjektiven Verständnis stehen. Es »scheidet die Dogmatik der gelebten Situation nicht einfach durch Formalisierung aus, freilich überholt es den subjektiv vermeinten Sinn gleichsam im Gang durch die geltenden Traditionen hindurch und bricht ihn auf«.29 Solche Soziologie ist nur als auch historische möglich. »Im grundsätzlichen Unterschied zur Wissenssoziologie erhält sie ihre Kategorien aus einer Kritik, die zur Ideologie nur herabsetzen kann, was sie in deren eigener Intention erst einmal ernstgenommen hat.« Objektiv und nicht subjektiv sinnverstehend ist sie, insofern sie es »mit Frakturen von Sinn, in Hegels Sprache: mit dem Mißverhältnis des Existierenden und seines Begriffs zu tun hat«.30
Die Psychiatrie hat es in ganz besonderer Weise mit »Frakturen von Sinn« im menschlichen Denken und Handeln zu tun. Daher und im historischen Zusammenhang mit der »sozialen Frage« stellt Psychiatrie gewissermaßen eine Soziologie noch vor der Etablierung der Soziologie als Wissenschaft dar. Unsere wissenschaftssoziologische Frage kann also nicht mehr bloß formal lauten, wie bestimmte Extreme menschlichen Denkens und Handelns als besondere gesehen und damit zum Gegenstand einer Wissenschaft werden konnten, sondern sie muß heißen: Wie konnten diese Extreme zu einem bestimmten Zeitpunkt als konkrete gesellschaftliche Not und Gefahr – bedrückend und bedrohlich-faszinierend – sichtbar und wichtig werden? Wie war die Gesellschaft beschaffen, ihre Öffentlichkeit, ihr ökonomisches Entwicklungsstadium, ihre moralischen Normen, ihre religiösen Vorstellungen, der Anspruch ihrer politischen, juristischen und administrativen Autoritäten, damit hier ein (Ordnung und Aufklärung) forderndes Problem hervortreten konnte? Welche gesellschaftlichen Bedürfnisse waren derart zwingend, daß man mit einem Mal bereit war, viel Geld auszugeben, um ein mehr oder weniger umfassendes Versorgungssystem, die Institution Psychiatrie, zu schaffen? Und wie argumentierten das wissenschaftliche und das philosophische Denken zur selben Zeit, um diesem sichtbar gewordenen Bedürfnis und Anspruch zu genügen, um teils aus der Praxis dieser neuen Institution, teils ›freischwebend‹ dem Kanon der wissenschaftlichen Disziplinen ein neues Element einzufügen? Alle weiteren Fragen folgen aus diesen.
3. Methoden der Untersuchung
Nachdem der Gegenstand der Untersuchung bestimmt ist, der Rahmen, in dem er gesehen, und der kritische Anspruch, an dem er durch die Geschichte verfolgt werden soll, bleibt zu klären, woher und wie Material für die Analyse gewonnen werden kann. Gerade weil wir uns mit der Entstehung der Psychiatrie beschäftigen, folgen wir – soweit möglich – Thomas S. Kuhns The Structure of Scientific Revolutions (1965), worin der Glaube an eine einlinige, kumulative Entwicklung der Wissenschaften einer Kritik unterzogen wird. Für Kuhn entsteht eine Wissenschaft, wenn in der (philosophischen) Diskussion eines Gegenstandsbereichs, verbunden mit einer exemplarischen konkreten Leistung, ein Modell, ein »paradigm«, zur Herrschaft kommt, das 1. für die meisten akuten Probleme offen ist, 2. für eine größere Gruppe (»community«) den weiteren Streit über Fundamentalfragen beendet, aus dem 3. einzelne Theorien, Methoden, Aspekte und Gesetze erst abgeleitet werden, und das 4. wissenschaftliche Institutionen (Berufsstand, Arbeitsort, Zeitschrift, Verein, Lehrbuch, Lehrmöglichkeiten) erst etabliert. Wissenschaftliche Entwicklung vollzieht sich durch Revolutionen, die den politischen durchaus vergleichbar sind, d. h. durch Austausch der Anschauungen (»view of the world«), so daß nicht nur die Theorien, sondern auch die Tatsachen neu betrachtet und konzipiert werden. Die Voraussetzung dafür ist eine Krise, die das alte Paradigma destruierende Einsicht, daß es wesentlichen neuen Problemen und Bedürfnissen gegenüber versagt. Die Folge davon ist eine Diskussion in der Öffentlichkeit zwischen dem alten und dem neuen, alternativen Paradigma-Kandidaten. Das siegreiche Paradigma verspricht, den neuen Bedürfnissen »adäquater« zu sein, wobei politische Autoritäten, individuelle Überzeugungskraft, philosophische Überlegungen, ja ästhetische Adäquanzgefühle durchaus mit eine Rolle spielen können.31
Dieser Deutungsansatz ist allerdings auf die Psychiatrie nur partiell anwendbar, da er an den reinen Naturwissenschaften entwickelt wurde. Kuhn weiß selbst, daß die Situation etwa der Medizin, der Technik, des Rechts komplizierter ist, da diese Wissenschaften ihre Forschungsprobleme nicht nach eigenem Belieben wählen, sondern sie nach ihnen äußerlichen, gesellschaftlich dringlichen Bedürfnissen zudiktiert bekommen.32 Wir benutzen deshalb sein formalistisches Schema lediglich als technisches Hilfsmittel des zwischengesellschaftlichen Vergleichs von Entwicklungsstufen. Gerade die Psychiatrie ist mit zahlreichen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedürfnissen verflochten, von deren Druck sie von Beginn an abhängig war33; und der Grad dieser Verflochtenheit ist eher gestiegen, so daß ihr heute allgemein die Aufgabe zugewiesen wird, als »human engineering« soziale Angst verschwinden zu machen.34 Kritisch gilt jedenfalls auch für die Psychiatrie, »daß der vom Subjekt veranstaltete Forschungsprozeß dem objektiven Zusammenhang, der erkannt werden soll, durch die Akte des Erkennens hindurch selber angehört«35, daß »das erkennende Subjekt aus den Zusammenhängen gesellschaftlicher Praxis« zu begreifen ist.36
Angesichts solcher Komplexität ist es ausgeschlossen, sich einem ressortspezifischen Methodenkanon anzuvertrauen. Vielmehr ist einem Verfahren zu folgen, das Habermas anläßlich der Analyse eines ähnlich komplexen Gegenstandes, der bürgerlichen Öffentlichkeit, beschrieben hat: Die Methode der Analyse des »epochaltypisch« gefaßten Gegenstandes ist, gegenüber der formalen Soziologie, historisch, d. h. nicht idealtypisch verallgemeinernd und nicht auf formal gleiche Konstellationen beliebiger historischer Lagen übertragbar; zugleich ist sie, gegenüber der Historie, soziologisch, da Einzelnes nur exemplarisch, als Fall einer gesellschaftlichen Entwicklung interpretiert werden kann. »Von der Übung strenger Historie unterscheidet sich dieses soziologische Vorgehen durch eine, wie es scheint, größere Ermessensfreiheit gegenüber dem historischen Material; es gehorcht indessen seinerseits den ebenso strengen Kriterien einer Strukturanalyse gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge.«37 Diesem soziologischen Verfahren kommt die heutige Sozialgeschichte entgegen, wie sie von Conze und H. Mommsen38 betrieben wird und die als ihre Methoden die der Begriffsgeschichte, Biographie und Statistik angibt.
Es kam für uns nun darauf an, dem historischen Verstehen eine tragfähige Unterlage zu geben, d. h. möglichst viele Details des verfügbaren Materials in eine kausale oder vergleichende Erklärung einzubeziehen bzw. wenigstens ansatzweise zu quantifizieren. Prioritäten wissenschaftlicher Leistungen etwa, einst Streitpunkte bürgerlichen Nationalstolzes, erhalten hier wieder eine relative Bedeutung im Zusammenhang des Vergleichs des Entwicklungsstandes einer Gesellschaft und ihrer Psychiatrie. Es war der Entwicklung der psychiatrischen Institutionen nachzugehen : der Anstalten, der Lehrbücher, Vereine, Zeitschriften, der Kommunikation der Wissenschaftler untereinander und der Etablierung der Psychiatrie in den Fakultäten und Universitäten, sowie der Expansion der Zuständigkeit der Psychiatrie, d. h. der Erweiterung ihres Patientenkreises und ihrer Kompetenzen, damit ihrer sozialen Funktion und Verflechtung. Zu berücksichtigen waren die Fortschritte der allgemeinen Medizin und die Reduktion ihres Interesses auf den »organischen Aspekt« (was technische und theoretische Konsequenzen für die Psychiatrie hatte), sowie die Etablierung der bürgerlichen literarischen und politischen Öffentlichkeit, die Entwicklung der ökonomischen Produktivkräfte und Bedürfnisse in der jeweiligen Gesellschaft. Benachbarte Wissenschaften – wie die Psychologie und die Pädagogik – mußten verglichen werden. Die Beziehungen der Psychiatrie zur Philosophie und der Prozeß der Ablösung von ihr waren nachzuzeichnen. Von Bedeutung war auch die National- und Sozialpolitik der Regierungen und Bürokratien, aber auch das Aufkommen sozialer Bewegungen, also die Dialektik von Emanzipation und Integration in der Zeit der entstehenden und sich entfaltenden bürgerlichen Gesellschaft (z. B. der Arbeiter, der Juden). Großes Gewicht wurde auf Sammlung, Analyse und – wo möglich – quantifizierende Auswertung von Psychiater-Biographien gelegt, wobei nicht nur »die großen Männer« erfaßt werden sollten; aus Gründen der Quellen-Zugänglichkeit ist das nur für Deutschland gelungen. All dies ist eingebettet in einen internationalen Vergleich, der sich freilich auf die drei für unseren Gegenstand entscheidenden Länder – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – beschränken mußte. Dementsprechend ist unsere Darstellung gegliedert. Sie berichtet chronologisch über die Entstehung der Psychiatrie in den drei Gesellschaften in der genannten Reihenfolge. Daß die deutsche Psychiatrie zuletzt entstand, legt es nahe, sie auch unter dem Aspekt der »verspäteten Nation«39 zu bedenken.
Die mehrfach einschränkenden Bemerkungen sollen davor bewahren, unsere Studie mit einer Psychiatriegeschichte schlechthin zu verwechseln. Doch dürfte es von einem über die Psychiatrie hinausweisenden allgemeinen Interesse sein, daß hier zum Zeitpunkt der Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft über das Verhältnis der Bürger zur sowohl individuellen als auch gesellschaftlich inneren und äußeren Unvernunft berichtet wird, dargestellt am Verhältnis der bürgerlichen Psychiater zu den armen Irren und unter Berücksichtigung der vielfältigen Ambivalenzen zwischen Identifizierung und Distanzierung, zwischen Emanzipation und Integration. Der Wandel der Formen und Methoden der sozialen Kontrolle ist dabei ebenso zu prüfen wie der Anspruch der Aufklärung, ohne den bis heute keine Institution, kein Gesetz, keine Theorie und keine verändernde Praxis zustande kommen. Wer sie allesamt als ideologisch entlarvt und verwirft – so Foucault40 –, propagiert ein Zeitalter der Nach-Aufklärung, bleibt jedoch gerade durch diese abstrakte Negation auf die Aufklärung bezogen und auf eine bloß reaktive Position der Gegenaufklärung beschränkt.
4. Historisches Vorfeld: die Ausgrenzung der Unvernunft
Die Entstehung der Psychiatrie als moderner Wissenschaft ist auf dem Hintergrund einer Bewegung zu sehen, die im Laufe des 17. Jahrhunderts die soziale Landschaft Europas grundlegend veränderte. Der Aufstieg des Zeitalters der Vernunft, des Merkantilismus und des aufgeklärten Absolutismus vollzog sich in eins mit einer neuen rigorosen Raumordnung, die alle Formen der Unvernunft, die im Mittelalter zu der einen, göttlichen, in der Renaissance zur sich säkularisierenden Welt gehört hatten, demarkierte und jenseits der zivilen Verkehrs-, Sitten- und Arbeitswelt, kurz: der Vernunftwelt, hinter Schloß und Riegel verschwinden ließ. Bettler und Vagabunden, Besitz-, Arbeits- und Berufslose, Verbrecher, politisch Auffällige und Häretiker, Dirnen, Wüstlinge, mit Lustseuchen Behaftete und Alkoholiker, Verrückte, Idioten und Sonderlinge, aber auch mißliebige Ehefrauen, entjungferte Töchter und ihr Vermögen verschwendende Söhne wurden auf diese Weise »unschädlich« und gleichsam unsichtbar gemacht. Europa überzog sich erstmals mit einem System von so etwas wie Konzentrationslagern für Menschen, die als unvernünftig galten.
1657 begann das riesige, aus mehreren älteren Institutionen zu diesem Zweck zusammengesetzte Hôpital général in Paris mit dieser Konzentrationstätigkeit. Als erste französische Stadt errichtete Lyon 1612 ein solches Haus. Ein Edikt von 1676 schrieb für jede Stadt die Errichtung eines Hôpital général vor; bis zur Revolution hatten 32 Provinzstädte dem entsprochen. In Deutschland begann die Errichtung von Zucht-, Korrektions- oder Arbeitshäusern 1620 in Hamburg. Allgemein wurde diese Bewegung aber erst nach dem Dreißigjährigen Krieg: 1656 (Brieg und Osnabrück), 1667 (Basel) und 1668 (Breslau); auch hier setzte sie sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts kontinuierlich fort.
Dieselbe Entwicklung setzt in England früher ein und zeigt schon hier auch abweichende Züge. Vorschriften zur Errichtung von »houses of correction« werden schon 1575 erlassen. Aber trotz Strafandrohung, Ermunterung von Privatunternehmern und obwohl schon damals die Politik der »enclosures« bestand, wodurch die Großgrundbesitzer den Ackerbau rationalisierten und der Strom der »befreiten« und besitzlosen Kleinbauern in die Städte einsetzte41, kam dieses Modell nie zu allgemeiner Verbreitung. Schottland widersetzte sich fast ganz; im übrigen erfolgte eher eine Verschmelzung mit den bestehenden Gefängnissen. Größeren Erfolg hatte die Etablierung von »workhouses«, wovon zwischen 1697 (Bristol) und dem Ende des 18. Jahrhunderts 126 entstanden, vornehmlich in Regionen der beginnenden Industrialisierung.
Fragt man nach den Motiven dieser gesamteuropäischen Bewegung, muß man sich zunächst vergegenwärtigen, daß das Heer der arbeitsfähigen Nicht-Arbeitenden und Armen in den Städten 10–20 Prozent, in geistlichen Residenzen und zur Zeit von Wirtschaftskrisen 30 Prozent und mehr der Bevölkerung betrug. Dieser zuvor »normale« Umstand mußte allen Autoritäten als Provokation und Gefahr gerade in dem Maße erscheinen, in dem sie Vernunft zur Herrschaft über Natur und Unvernunft zu bringen suchten: dem Absolutismus im Verlangen nach bürgerlicher Ordnung; dem Kapitalismus im Prinzip regelmäßiger, kalkulierbarer Arbeit; den Wissenschaften im Streben nach systematischer Naturbeherrschung; den Kirchen namentlich im Puritanismus; endlich den Familienvätern, indem sie Vernunftherrschaft als Sensibilität für honnêteté und gegen Familienschande zu übersetzen lernten. Man kann diese Epoche der administrativen Ausgrenzung der Unvernunft (1650–1800) umschreiben als diejenige, in der die Kirche die Formen der Unvernunft, namentlich Arme und Irre, nicht mehr, die bürgerlich-kapitalistische Wirtschaftsgesellschaft sie noch nicht umgreifen konnte. Zugleich schuf diese Epoche die Voraussetzung für die spätere sozio-ökonomische Ordnung: sie stand im Dienst der Erziehung zu einer Haltung, für die Arbeit zur moralischen Pflicht, später zur gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit wird. Die Korrektions-, Zucht- und Arbeitshäuser waren als elastisches Instrument konzipiert: »cheap manpower in the periods of full employment and high salaries; and in periods of unemployment, reabsorption of the idle and social protection against agitation and uprisings.«42 Wichtiger als die im 18. Jahrhundert ohnehin fraglich werdende Produktionsleistung dieser Einrichtungen ist ihre sozialpädagogische Funktion für die bürgerliche Gesellschaft: sie machen dem Bürger negativ den Raum sinnfällig, in dem er sich ohne Skandal und damit »frei« bewegen kann, sie weisen ihm den Weg der Verinnerlichung einer Haltung, die ihn zum selbsttätig moralischen und arbeitenden Bürger macht. In dem Maße, wie er sich diese zu eigen macht, verlieren jene Einrichtungen ihre Funktion und werden in der Tat ab- bzw. umgebaut werden.
Zu den Ausgeschlossenen gehören die Irren.43 Im Durchschnitt dürften sie 10 Prozent der Belegschaft der Anstalten ausgemacht haben, bei großen lokalen Differenzen, zumal es weitgehend der Willkür überlassen blieb, ob ein Müßiggänger und Auffälliger als Irrer und Narr oder mit einem anderen Etikett klassifiziert wurde. Zugleich bildeten sich besondere Formen heraus, unter denen die Unvernunft der Irren auf die gesellschaftliche Vernunft bezogen blieb. Im Gegensatz zur Masse der Ausgeschlossenen, die nicht selbst, sondern nur im Medium der imponierenden Anstaltsmauern den Bürgern sichtbar waren, erhielten die Irren eine Sonderstellung – und zwar gerade ihre gemeingefährlichste Spezies, nämlich die Tobenden, Rasenden und Bedrohlichen (d. h. die Manien). Diese wurden im buchstäblichen Sinne als »Monstren« in Käfigen gegen Entgelt dem bürgerlichen Publikum vorgeführt, das nirgends konkreter als hier Objekt der administrierenden Vernunft ist, Objekt ihrer erziehenden und ordnenden Absicht – den Zwang im Hintergrund. Eine Fülle zeitgenössischer Berichte und Reiseführer zeigt, wie die Irrendemonstrationen in Paris und London ebenso wie in verschiedenen deutschen Städten mit den Vorführungen wilder Tiere um die Gunst dieses Publikums konkurrierten. Diese Spektakel hatten mehr gemeinsam als die Gitterstäbe der Menagerien und die Geschicklichkeit der ihre Opfer reizenden Wärter. Was hier veranstaltet wurde, war die wilde und unbezähmbare Natur, das »Tierische«, die absolute und zerstörende Freiheit, die soziale Gefahr, die hinter den von der Vernunft gesetzten Gittern um so dramatischer in Szene gesetzt werden konnte, als durch eben denselben Akt dem Publikum die Vernunft als Notwendigkeit der Herrschaft über die Natur, als Beschränkung der Freiheit und als Sicherung der staatlichen Ordnung vor Augen geführt wurde. War der Wahnsinn in früheren Zeiten ein Zeichen des Sündenfalls, verwies er – in der Beziehung auf Heilige und Dämonen – auf ein christliches Jenseits, so zeugte er jetzt von einem politischen Jenseits, vom chaotischen Naturzustand der Welt und des Menschen, von der brüchigen Basis seiner Leidenschaften, d. h. von dem Zustand, den Hobbes (1642) wahrnahm und aus dem er keinen Ausweg sah als die Unterwerfung der Menschen unter ein Staatswesen, unter ihre zweite, die soziale Natur: »Nur im staatlichen Leben gibt es einen allgemeinen Maßstab für Tugenden und Laster; und eben darum kann dieser nicht anders sein als die Gesetze eines jeden Staates; selbst die natürlichen Gesetze werden, wenn die Verfassung festgesetzt ist, ein Teil der Staatsgesetze.«44
Das Arrangement, das die Irren als wilde und gefährliche Tiere präsentierte45, war ein Appell an das Publikum, den moralischen Maßstab des absoluten Staates sich als eigene Vernunft zu eigen zu machen. Daß der absoluten tierischen Freiheit der Irren nur mit absolutem Zwang zu begegnen war, daß sie als Objekte eines erziehend-dressierenden Vorgehens galten, das ihr Irren mit vernünftiger Wahrheit, ihre Gewaltsamkeit mit physischer Strafe zu brechen hatte, und daß ihre soziale Gefährlichkeit in realer Ohnmacht vorgeführt wurde, gab den Zielen und den Sanktionen dieses moralisch-politischen Aufrufs exemplarischen und anschaulichen Nachdruck. Die Entstehung der Psychiatrie als Institution und Wissenschaft hängt ab von der spezifischen Umwandlung der die Unvernunft lediglich ausgrenzenden Institutionen des aufgeklärten Absolutismus. Um die gesellschaftlichen Bedingungen, die Richtung und die Auswirkungen dieser Umwandlung geht es im folgenden.
Anmerkungen
1 Spehlmann, Freuds neurologische Schriften.
2 Habermas, Logik der Sozialwissenschaften, bes. S. 185 ff.
3 Dörner, »Nationalsozialismus und Lebensvernichtung« sowie Der Krieg gegen die psychisch Kranken.
4 Dörner, Hochschulpsychiatrie.
5 Hollingshead and Redlich, Social Class and Mental Illness.
6 Reimann, Die Mental Health Bewegung, bes. S. 93–99.
7 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 10.
8 A. a. O., S. 15 f.
9 A. a. O., S. 44 f.
10 A. a. O., Zitat-Zusammenstellung aus den Seiten 17–49.
11 A. a. O., S. 9.
12 A. a. O., S. 55.
13 Habermas, Theorie und Praxis, S. 229.
14 Lieber, Philosophie, Soziologie und Gesellschaft, S. 3 f.