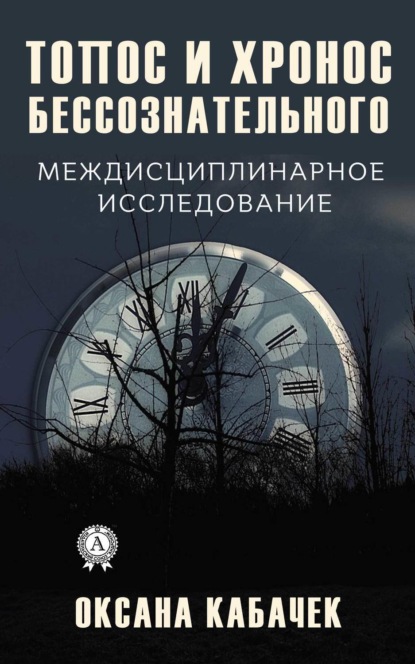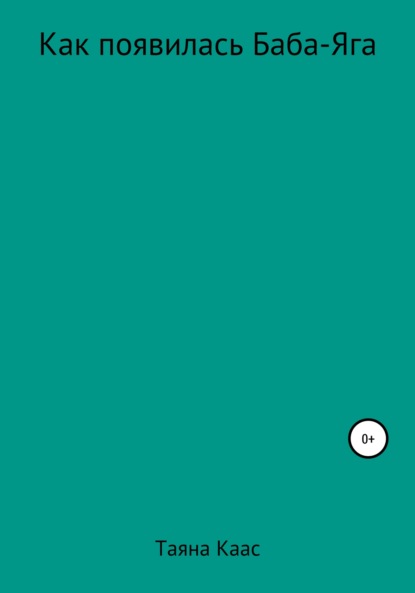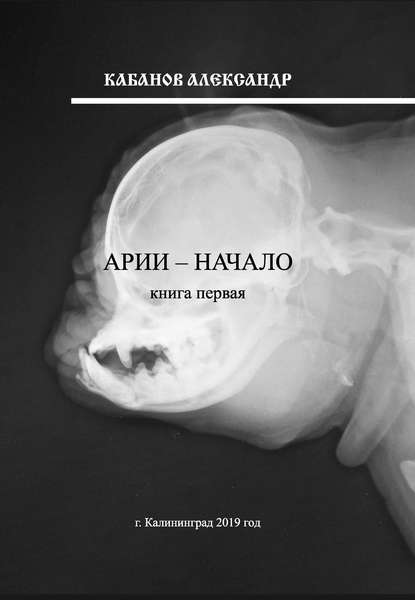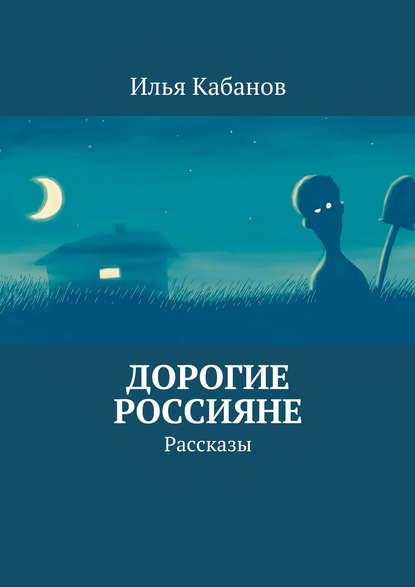- -
- 100%
- +
Th. Sydenham, ebenfalls aus der Royal Society und befreundet mit Lokke und Boyle, bringt 1682 mit seiner Beschreibung der Hysterie eine weiterführende Vermittlung von Willis und Glisson16 zustande, die zugleich unter der Hand zu einer Art moralischer Beschreibung der bürgerlichen Öffentlichkeit Englands der Wende zum 18. Jahrhundert gerät. Er identifiziert weitgehend – was das klinische Bild angeht – die bei Frauen vorherrschende Hysterie mit der Hypochondrie, ihrem Äquivalent bei Männern, und mit der Melancholie. Er vervollständigt also hier die bei Willis bemerkte Tendenz. Vom eigentlichen Irresein ist bei ihm um so weniger die Rede. Frei von Hysterie sind fast nur Frauen »such as work and fare hardly«. Umgekehrt sind von den Männern vor allem von dieser Störung befallen solche, »who lead a sedentary life and study hard«17, also Männer mit einer Tätigkeit in kaufmännischen oder sonstigen Büros und in akademischen oder literarischen Berufen. Damit ist mit dem Begriff der Hysterie ziemlich genau der Bereich der ökonomischen und der literarisch-humanen, d. h. für einen Akademiker sichtbaren bürgerlichen Öffentlichkeit gemeint. Der typische Bürger leidet auch an Hysterie bzw. Hypochondrie. Das übrige bleibt mehr oder weniger im Dunkel – eine gesellschaftliche Sichtverkürzung, die (nicht nur) Psychiater immer wieder zu Fehlschlüssen führen wird.
Erklärt wird die Hysterie zunächst durch Unordnung, Ataxie der Spiritus animales. Es bedeutet aber eine Verinnerlichung des Prinzips Willis’ – jetzt auch methodisch –, wenn Sydenham dann differenziert: »As the body is composed of parts which are manifest to the senses, so doubtless the mind consists in a regular frame or make up of the spirits, which is only the object of reason. And this being so intimately united with the temperament of the body, is more or less disordered, according as the constituent parts thereof, given us by nature, are more or less firm.«18 Man darf wohl der Interpretation Foucaults folgen, daß hier die neutralisierende naturwissenschaftliche Beobachtung Willis’ durch eine innere Sicht ersetzt ist, die durch Beziehung der Spirits auf die Dichte der Konstitution die innerlichkörperliche Dimension mit der moralischen zusammenbringt, die Schwäche der Konstitution mit der Schwäche des Herzens.19 Denn Sydenham begründet gerade aus diesem Zusammenhang die größere Disposition der schwächeren Frauen für die Hysterie und damit kulturkritisch den inkonstanten, weiblichen Charakter der neuen bürgerlichen Gesellschaft: »Hence women are more frequently affected with this disease than men, because they have receiv’d from nature a finer and more delicate constitution of body, being designed for an easier life and the pleasure of men, who were made robust, that they might be able to cultivate the earth, hunt and kill wild beasts for food, and undergo the like violent exercises.«20
Als Therapie kennt Sydenham zunächst reinigende Entleerungen des Körpers, sodann zur Stärkung der Spirits Eisenmittel und zu ihrer naturgemäßen Regulierung vor allem tägliches Reiten.21 Dies letztere Therapeutikum kann als Beginn der Tendenz angesehen werden, die gesamte Verhaltensordnung des Patienten in den Heilungsplan einzubeziehen; denn da die Symptome der Hysterie als Bewegungsunordnung sowohl der Nervenspirits als auch der sozialen Verhaltensweisen aufgefaßt werden, hat auch die Therapie eine Neuausrichtung dieser sozio-somatischen Bewegung anzuzielen.
Ein Beispiel wird Sydenham zugeschrieben, das, selbst wenn es Legende sein sollte, besonders instruktiv ist. Als der Arzt bei einem besonders hartnäckig leidenden »Nobleman« mit seiner Kunst am Ende war, gab er ihm eine Empfehlung für einen nicht existenten hochberühmten Kollegen, der im hohen Schottland wohne. Als der Patient nach langer und vergeblicher Reise und voller Vorwürfe zu Sydenham nach London zurückkehrte, war er geheilt. Erklärung: Die Verwirklichung der beschwerlichen Reise (Reise als Selbstzweck, »Reisen ohne anzukommen«) und der anschließende Affekt gegen den täuschenden Arzt hatten dem Patienten vermittelt »a motive of sufficient interest to divert the current of his ideas from the cherished theme« und ihm dadurch eine gesunde Bewegungsordnung zurückgegeben.22
Das Modell der Medizin für nervöse bzw. psychische Krankheiten ist somit das, was in der bürgerlichen Öffentlichkeit sichtbar wird: die Hysterie.23
Die Theorien, die anläßlich dieser repräsentativen Störung von Willis und Sydenham entwickelt werden, bestimmen bis zur Jahrhundertmitte das ärztliche Denken und Handeln. Wie die armen Irren weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit und damit außerhalb dessen, was die Bürger als Gesellschaft verstehen, aber auch außerhalb des Interesses des Staates stehen, so beherrscht die Hysterie den Markt des Interesses an sich selbst. Sie wird zu einem Instrument, durch das der Bürger sein menschliches Selbst und sein gesellschaftlich-nationales Selbst zur Deckung bringen kann. Eine Bedingung dafür ist, daß den Ärzten im Enthusiasmus der öffentlichen Diskussion über alles ihre traditionelle Autorität abhanden gekommen ist, zumal sie sich selbst nur als Diskutanten unter anderen verstehen. Von den vier bedeutendsten Krankenhäusern Londons rechnen sich zwei zu den Whigs und zwei zu den Tories. So entsteht das Bild des Arztes, der sich zwar viel mit Politik, Ökonomie und Literatur beschäftigt, aber von der Medizin nicht viel mehr versteht, als daß er ein gutes Geschäft daraus zu machen weiß. Die Sprechstunde fand zu einem guten Teil im »coffee-house« statt; und auch der Teil der medizinischen Tätigkeit, der später die Psychiatrie ausmacht, war Sprechstunde – für hysterische Patienten, also »Sprechstundenpsychiatrie«.24
Aus dieser wechselseitigen gesellschaftlich-ärztlichen Verflechtung wird nicht nur verständlich, daß alle Welt – Ärzte und Nicht-Ärzte – über Hysterie schrieb, sondern auch, daß die Mehrzahl dieser Bücher und Zeitschriftenaufsätze von der Beschreibung der eigenen Krankengeschichte des Autors ausgingen und daß sie – an die Gesamtheit der gebildeten Öffentlichkeit gerichtet – nicht an die ärztliche Autorität verwiesen, sondern durch Mitteilung eines umfassenden Heilungsplans zur Selbsthilfe aufforderten. Das Bemühen, aus einer als gefährlich empfundenen »instability« zu einer stabilen Ordnung, zur Identität, zu einem Selbst zu finden, das selbsttätig funktioniert und nicht durch eine äußere Autorität oktroyiert wird, war der Kern aller öffentlichen Diskussion – auf der politischen Ebene, so bei Locke25, wie auf der individuellen.
Mandeville kann in seiner Lebensweise und in seinen medizinischen Schriften vielleicht als idealtypisch für den Arzt dieser Zeit gelten. Er betrieb seine Praxis nur lässig, bezog von einigen holländischen Kaufleuten eine Pension. Seine Interessen waren literarisch, politisch, ökonomisch eher als medizinisch. Vornehmlich in literarischen Zirkeln verkehrend, kannte er Addison ebenso wie Benjamin Franklin. 1711 schrieb er einen Treatise of the Hypochondriack and Hysterick Passions, verbunden mit der Darstellung der »real art of physick itself«, d. h. »writ by way of information to patients« und nach einer »method entirily new«: als Dialog zwischen Arzt und Patient. Auch hier wird die eigene Krankheit – als Angst, an Syphilis zu leiden – eingeschoben. Therapeutisch ist ihm keine eigene Theorie, sondern die erleichternde und über die Irrtümer des Patienten und der ärztlichen Kollegen satirisch aufklärende Diskussion selbst wichtig. Eingedenk seiner Vorliebe für die Funktion der »selfishness of man« läßt er den Patienten seine Aggressionen gegen ihn abreagieren – und läßt sich dafür nach Zeit bezahlen. Zugleich schreibt Mandeville – hier am Beispiel der hysterischen Tochter eines Patienten – einen »course of Exercise« vor, der den ganzen Tageslauf genau skandiert und ausfüllt; u. a. werden verlangt: frühes Aufstehen, mehrere Stunden Reiten, heftiges Hautbürsten durch eine Bedienstete und ein mehrstündiger Spaziergang. So etabliert sich das Hygieneideal der höheren Bürgerstochter.
Auch wird es in der ersten Jahrhunderthälfte Mode, über die Hysterie das individuelle und das gesellschaftliche Selbstbewußtsein unmittelbar zu identifizieren, gleichsam aus einem Mangel für die Individuen die Besonderheit und Größe der bürgerlichen Gesellschaft und Nation zu erklären, während Sydenham hier noch eher eine unerfreuliche Instabilität sah. Der »medical journalist« Blackmore verfaßte 1725 einen Treatise of the Spleen and Vapours: or, Hypocondriacal and Hysterical Affections. Auch er hält die Störungen der Männer und Frauen für Formen derselben Krankheit. Die Konstitution der Milz, der »spieen«, bestimmt, wie lasziv oder träge eine Person in sexueller und jeder anderen Aktivität ist. Zudem wird ihm der »English Spleen« zu einer Art Individuationsprinzip, das die Verschiedenheit des individuellen Genius und die Besonderheit der Nation bewirkt. Gegenüber den anderen Völkern »the temper of the Natives of Britain is most various, which proceeds from the Spleen, an Ingredient of their Constitution, which is almost peculiar, at least in the Degree of it, to this Island. Hence arises the Diversity of Genius and Disposition, of which this soul is so fertile. Our Neighbours have greater Poverty of Humour and Scarcity of Originals than we. [...] An Englishman need not go abroad to learn the Humours of these different Neighbours; let him but travel from Temple-Bar to Ludgate, and he will meet [...] in four and twenty hours, the Dispositions and Humours of all the Nations of Europe.«26
The English Malady: or, a Treatise of Nervous Diseases of all Kinds... with the Author’s own Case at large von G. Cheyne erschien 1733. Hier ist die nationale Krankheitsbezeichnung als stolzes Bekenntnis zu den unter diesem Begriff vorgetragenen Angriffen des Auslands gewählt. Denn für Cheyne sind die Gründe der Häufigkeit dieser Krankheit in England gegenüber allen anderen Nationen u. a. »the Richness and Heaviness of our Food, the Wealth and Abundance of the Inhabitants (from their universal Trade) the Inactivity and sedentary Occupations of the better Sort (among whom this Evil mostly rages) and the Humour of living in great, populous and consequently unhealthy Towns«. Außerdem werden von der Krankheit gerade nicht »Fools, weak or stupid Persons, heavy and dull Souls« befallen, sondern solche »of the liveliest and quickest natural Parts [...] whose Genius is most keen and penetrating, and particularly where there is the most delicate Sensation and Taste, both of Pleasure and Pain«. Und dies ergibt sich »from the animal Oeconomy and the present Laws of Nature«.27 Auch für Cheyne kann diese Krankheit nur eine körperliche sein. Es liegt eine Schwäche oder Tonusstörung der Nerven vor, doch ist auch hier wieder der zugrunde liegende »Character and Temper of the Patient« entscheidend, so daß die »English Malady« als »Nervous Distemper« zu bezeichnen ist. Daher sind die Symptome dieser Krankheit auch nicht einheitlich, sondern entsprechen den Eigenheiten der jeweils befallenen Körperteile; jedes Organ hat ein ihm eigenes »sentiment«.
Mit dieser Entwicklung der Hysterielehre ist nun ein Teil der ausgegrenzten Unvernunft – namentlich der der Leidenschaften – als wesentlicher Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft akzeptiert, und zwar nicht mehr nur als von der Rationalität zu beherrschendes gefährliches Übel, sondern als durch innere Sicht erkennbare körperlich-sozial-moralische und eigenständig wirkende Kraft. Vom rationalen Aspekt der englischen Aufklärung ist dieser romantische seit der Revolution kaum zu trennen (Sydenham, Shaftesbury).27a Die »hysterical passions« sind ein körperlicher Indikator für Genius und Originalität des Individuums wie für handelskapitalistischen Reichtum – bald auch für Freiheit – der Gesellschaft, aber zugleich für den Grad an Labilität und körperlich-moralischem Leiden, der als Preis dafür zu zahlen ist. Die Spekulationen und der Zusammenbruch der Südsee-Kompanie von 1720, der »South Sea Bubble«, wurde zum paradigmatischen Ereignis. Es brachte die rational schwer erklärbare ärztliche Erfahrung, daß mehr Patienten zur Behandlung kamen, »whose heads were turned by the immense riches which fortune had suddenly thrown in their way, than of those, who had been completely ruined by that abominable bubble. Such is the force of insatiable avarice in destroying the rational faculties.«28 Ähnliches besagt das Staunen Montesquieus darüber, daß die Engländer – im Vergleich zu den Römern – ohne einleuchtenden Grund Selbstmord begehen, selbst auf dem Gipfel des Glücks. Es ist die soziosomatische Gesetzmäßigkeit der Hysterie, die verlangt, ihr mit therapeutischen Mitteln zu begegnen, die denselben Gesetzen entsprechen; denn die Zeiten sind vorbei, in denen hier eine zu sühnende religiöse Schuld vermutet wird. Hysterie und Spleen sind aber ebensowenig vom Körper bzw. von der Gesellschaft abtrennbare »imaginary Whims or Fancies«: es ist hier schlechterdings unmöglich, durch Reden einen Irrtum rational aufzuklären, »to counsel a Man [...], tho’ never so eloquently apply’d«.29 Die Hysterie zeigt dem Individuum wie der Gesellschaft an, daß es nun möglich, aber auch notwendig ist, reflexiv sich selbst zu behandeln, die Stabilität der Bewegungen selbst zu regulieren. Die Stabilität kann nur relativ sein, da sie nicht durch äußere Autorität verliehen wurde, sie darf es nur sein, da von dem Maß garantierter Labilität individuelle Originalität auf der einen Seite, das Bewegungsspiel der Öffentlichkeit, Handel und Reichtum auf der anderen abhängen. Nur so kann es zu befriedigender Stärke und Lebendigkeit der »animal spirits« wie des »public spirit« kommen in der sich modernisierenden Gesellschaft.
c) Ausgriffe auf die Unvernunft
Ist so die Unvernunft der Hysterie in die bürgerliche Öffentlichkeit nicht nur integriert, vielmehr sogar fast mit ihr identifiziert, so bleibt doch auch die Ausgrenzung der Unvernunft – der Armut und des Irreseins – keine absolute mehr. Dem Publikum der Subjekte erscheint auch diese Grenze nicht mehr als objektive und haltgebende. Dieser Prozeß beginnt sehr allmählich. Die »poor lunaticks« werden zunächst kaum für die Medizin sichtbar, eher an ihrer theoretischen und praktischen Peripherie. Aber auch hier ist es eine Bewegung der gleichzeitigen Differenzierung und Identifizierung. Locke sieht sich hierzu gelegentlich seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand (1690) veranlaßt, zu der er sich bezeichnenderweise dadurch freies Feld schafft, daß er die Frage nach den körperlichen Bedingungen (»animal spirits« o. ä.) für das Zustandekommen der Empfindungen und Ideen ausklammert. Erst durch diesen Verzicht kommt er zu einer repräsentativen Definition des eigentlichen Wahnsinns und zu dessen Unterscheidung vom Blödsinn. Danach gilt für Irre, Madmen: »having joined together some Ideas very wrongly, they mistake them for Truths« ; und es liegt »the difference between Idiots and mad Men, that mad Men put wrong Ideas together, and so make wrong Propositions, but argue and reason right from them: But Idiots make very few or no Propositions, but argue and reason scarce at all.«30 Frei von einem somatischen Erklärungsschema kommt Locke aber auch zu der identifizierenden Annahme, daß sein Begriff der »madness«, die falsche Ideenverknüpfung, auf alle Menschen gelegentlich anzuwenden sei. Sie sind dann in dieser Hinsicht von Bedlam-Insassen nicht zu unterscheiden. Solche falschen Assoziationen kommen vor allem durch Fixierung von Gewohnheiten zustande, wodurch Anti-und Sympathien entstehen. Nur für diesen Vorgang läßt Locke eine Erklärung durch die »spiritus animales« gelten. Insofern wird Unvernunft, »something unreasonable«, in die menschliche Vernunft hineingenommen. Bei andauernder falscher Verfestigung, »when this Combination is settled«, wird die Vernunft ohnmächtig, da die Ideen nun eine eigene Natur entfalten; hier kann nur noch die Zeit heilen.31
Defoe (1697) unterscheidet Irre und Idioten danach, ob sie die Vernunft verloren haben oder ohne sie geboren sind. Hier ist die Absicht indessen praktisch. Seinem reinen Vernunftglauben sind die Idioten (»Fools«, »Naturals«), also der abstrakte Gegensatz der Vernunft, gleichsam näher als die Irren. So fordert er in einer Zeit, in der noch keineswegs für die Irren gesorgt war, ein »Fool-House«. Die Verwirklichung dieses Plans benötigte exakt 150 Jahre. Schöne utopische Aufklärung ist auch seine Vorstellung über die Träger der laufenden Kosten: es sollen die sein, denen die Natur oder Gott nicht weniger, sondern mehr Vernunft als den übrigen Menschen gegeben hat. Gerade diese sollen ihres Vorteils (und ihres damals hohen Ansehens und Einkommens) wegen für die Vernunftlosen sorgen wie für jüngere Brüder, denen kein Erbe zuteil wurde, »tho’ they are useless to the Commonwealth«. Durch Parlaments-Act soll das notwendige Geld »be very easily rais’d, by a Tax upon Learning, to be paid by the Authors of Books«.32 Freilich gehört Defoe auch zu den ersten, die gegen die »private Mad-Houses« protestieren, gegen die unkontrollierte Art, wie hier Menschen als Zahlende und als Arbeitskräfte ausgebeutet und geschlagen werden konnten, und gegen die Benutzung dieser Häuser durch Bürger »among the better Sort« mit dem Zweck, hier ihre mißliebigen Ehefrauen auf Zeit oder für immer verschwinden zu lassen. Daher fordert Defoe 1707 und 1728 von der »Civil Authority« daß »all private Mad-Houses should be suppress’d at once. [...] For the cure of those who are really Lunatick, licens’d Mad-Houses should be constituted in convenient Parts of the Town, which Houses should be subject to proper Visitation and Inspection, nor should any Person be sent to a Mad-House without due Reason, Inquiry and Authority«.33 Gleichsam die Gegen-Utopie liefert J. Swift. Gegen damals allzu abstrakte Projekte wie die Idiotenanstalt Defoes mag in Gullivers Reisen Laputa geschrieben sein, das Reich der Raumverteiler, Projektemacher und der die Menschen überfordernden Rationalisten, die dabei die Wirklichkeit verkommen lassen.34 Dagegen ist Swift gegenüber Defoes bloßem Plan der Unterhaltszahlung für die Idioten durch die Literaten wirklich praktisch: er läßt sich nicht nur 1714 zu einem der »Governors of Bethlem« wählen, sondern stiftet auch sein Vermögen zur Errichtung einer ersten Irrenanstalt in Irland, mit deren Bau in der Tat 1746, ein Jahr nach seinem Tod, begonnen wurde. Er schrieb hierfür – in Anspielung auf die Ansichten Blackmores und Cheynes – seinen eigenen Epitaph:
»He gave the little Wealth he had,
To build a House for Fools and Mad;
And shew’d by one satyric Touch,
No Nation wanted it so much.«35
Swifts Gegen-Utopie geht aber weiter. Er verkehrt die Ansichten seiner Zeit über psychische Leiden in ihr Gegenteil. In Gullivers Reisen leidet ein Yahoo am Spleen. Er wird nur durch harte körperliche Arbeit geheilt, nicht durch angenehme Bewegungen (Reisen, Baden, Reiten usw.), wie dies zu Swifts Zeit üblich war: »Diese Erzählung stimmte mich nachdenklich, da ich nun einmal von einer eigensinnigen Parteilichkeit für die Gattung ›Mensch‹ besessen bin. Ich sah auf einmal klar die wirklichen Hintergründe des Spleens, der einzig die Unbeschäftigten, im Luxus Lebenden befällt. Diese möchte ich ums Leben gern ärztlich behandeln, wenn man sie nur zwingen könnte, meine diesbezügliche Verordnung zu befolgen.«36 Umgekehrt vollzieht Swift mit den damals wirklich harter körperlicher Arbeit ausgesetzten Irren eine utopische Identifizierung. In A Tale of a Tub (1697) findet sich ein Abschnitt über »the use and improvement of madness in a commonwealth«. Hier werden Könige, Eroberer, Minister, Philosophen und religiöse Fanatiker auf ihre Genialität hin untersucht und mit dem damaligen Begriff von Wahnsinn in Beziehung gebracht. Es ist dann »solcher Wahnsinn Vater all der mächtigen Revolutionen, die im Staat, in der Philosophie und in der Religion stattgefunden haben«. Dies wendet Swift ironisch auf sich selbst an: »Auch ich selbst, der Verfasser dieser gewaltigen Wahrheiten, bin eine Person, deren Einbildungen hartnäckig und sehr darauf angelegt sind, mit ihrer Vernunft davonzulaufen, die – wie ich in langer Erfahrung beobachtet habe – ein sehr leichter Reiter und einfach abzuwerfen ist, aus welchem Grunde meine Freunde mich nie allein lassen, ohne ein feierliches Versprechen, meinen Spekulationen in dieser oder ähnlicher Weise nur für das allgemeine Wohl der Menschheit freien Lauf zu lassen.«37 Dies wird geschrieben, während Defoe mit gleichem Recht peinlichste Sorgfalt und zuverlässigste öffentliche Kontrolle fordert für genaue Differenzierungen – zwischen Irren und Idioten wie zwischen Irren und Normalen. Und als 1733 eine neue Differenzierung eingeführt wird – das Bedlam richtet eine besondere Abteilung für Unheilbare ein38 – überbrückt Swift auch diese problematische Trennung durch eine Identifizierung. In »A serious and useful scheme to make a hospital for incurables« hält er sich neben den verschiedensten anderen Menschengruppen auch für aufnahmeberechtigt in einer solchen Einrichtung – als »incurable scribbler«.39 – Die Selbstaufklärung der Psychiatrie kann auf Defoe so wenig wie auf Swift verzichten.
2. Industrielle Revolution, Romantik, psychiatrisches Paradigma
a) Sozioökonomische Konstellation
Dieser Abschnitt betrifft den Zeitraum zwischen 1750 und 1785. In diese Zeit fallen die Geburt des Industriekapitalismus, der erste Gipfel der Romantik, ein erster Ansatz der Soziologie in der schottischen Moralphilosophie und die Entstehung der Psychiatrie – für England und damit für das ganze Europa. Wir können uns nicht unterstehen, dieser Gleichzeitigkeit in ihrer Breite gerecht zu werden, sehen aber auch nicht, daß dies von irgendeiner Disziplin aus bisher gültig geschehen ist. Vielmehr haben wir nur dafür den Nachweis zu liefern, daß in dieser Epoche etwas zustande gekommen ist, das man erstmals Psychiatrie zu nennen berechtigt ist, und daß dies nur in Zusammenhang mit den übrigen aufgeführten epochalen Bewegungen zu begreifen ist.
Schon vor der Jahrhundertmitte hatten sich in England einige für eine Industrialisierung entscheidende Vorbedingungen entwickelt. Einerseits hatte die Expansion des Handels – durch koloniale Eroberungen und Merkantilpolitik der Krone bzw. der Regierungen – zur Ansammlung bedeutender Kapitalien geführt. Andererseits hatten die frühzeitig einsetzende Ausdehnungstendenz des Landadels und die wissenschaftliche Rationalisierung der Landwirtschaft (Fruchtwechsel, Stallfütterung) sowohl die Größe und damit die Marktleistungsfähigkeit der agrarischen Betriebe erhöht, als auch große Teile der bisherigen Kleinbauern zur Abwanderung in die Städte gezwungen.40 Hinzu kam, daß um 1750 die Gewerbefreiheit weitgehend hergestellt war, was u. a. die Wirkung hatte, daß zunächst zahlreiche Gewerbetreibende zur Arbeitslosigkeit »befreit« wurden. Der unmittelbare Anstoß der folgenden Bewegung muß wohl auch in den Kriegen gegen Frankreich und seine Verbündeten zwischen 1744 und 1763, die nahezu in der gesamten kolonial erschlossenen Welt geführt wurden, gesehen werden. Der Frieden von Paris (1763) offenbarte Englands politische und koloniale Führungsrolle in der Welt.
Die damit verbundene Ausdehnung des äußeren wie des inneren Marktes für den Handel verlangte aber ein gleiches für die Produktion. Hierdurch wurde ein Widerspruch offenkundig. »Die alten Produktionsmethoden und Werkzeuge begannen jetzt zu einem Hindernis für den sich ausdehnenden Markt und die entsprechende Erweiterung der Produktion zu werden.«41 Diese Situation erst stellt die Konstellation für die industrielle Revolution dar. Hier haben drei Prozesse ineinanderzugreifen: 1. Die nun unzureichenden Werkzeuge der Manufakturbetriebe müssen durch Maschinen mit potenzierter Produktivität ersetzt werden. England wird in den 60er Jahren das Land der technischen Erfindungen; es sei nur an die Dampf-, Spinn- und Webmaschinen erinnert und an den technischen Fortschritt für den Bau des ersten ökonomisch bedeutenden Kanals. 2. Bau und Inbetriebnahme der neuen Maschinen und Transportmittel sind nur durch Anlage größerer – meist aus dem Handel stammender – Kapitalien, als »konstantem fixem Kapital«, möglich. Gerade dieses unterscheidet den Industriebetrieb von der Manufaktur, und erst ab der Zeit der ersten Massenanlage solchen konstanten fixen Kapitals kann man – bei gleichzeitig herrschender freier Konkurrenz – von der eigentlichen kapitalistisch-industriellen Revolution sprechen. Die Vorbereitungs- und Mobilisierungsperiode hierfür erstreckte sich in England auf die Periode zwischen den 50er und den beginnenden 80er Jahren. 3. Diese Umstellung auf eine neue, leistungsfähigere Produktionsform zerstörte zwar auf der einen Seite die Existenzgrundlage für viele unter den alten Bedingungen Beschäftigte, war mit Not und Verunsicherung verbunden. Auf der anderen Seite war sie aber angewiesen auf die Rekrutierung einer weit größeren Zahl von Arbeitern, als sie die bisherige Wirtschaftsform beschäftigen konnte. Sie führte zur Massenanlage nicht nur von konstantem Kapital, sondern auch von variablem Kapital, d. h. sie bedurfte der massenhaften Mobilisierung möglichst billiger und kalkulierbarer menschlicher Arbeitskraft und ihre Einbeziehung in die kapitalistisch organisierte Wirtschaft.42