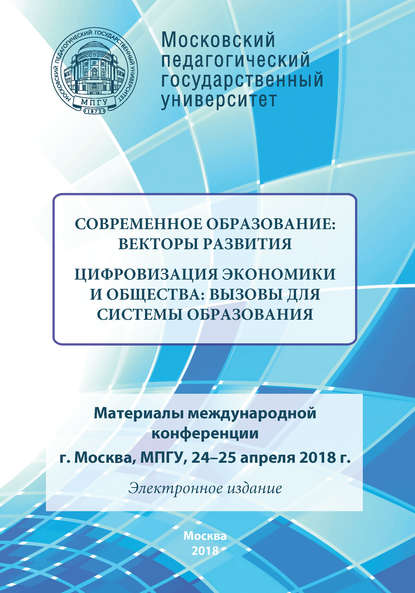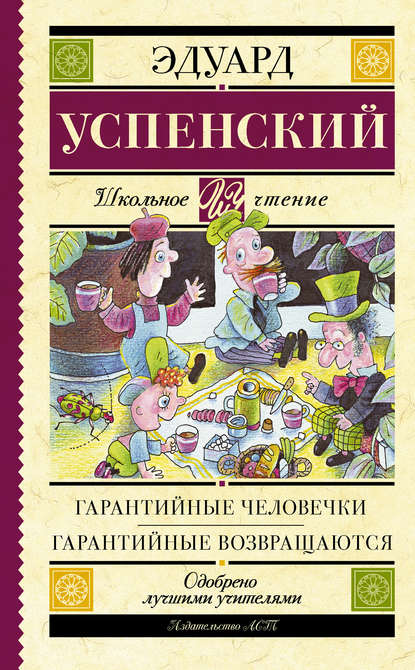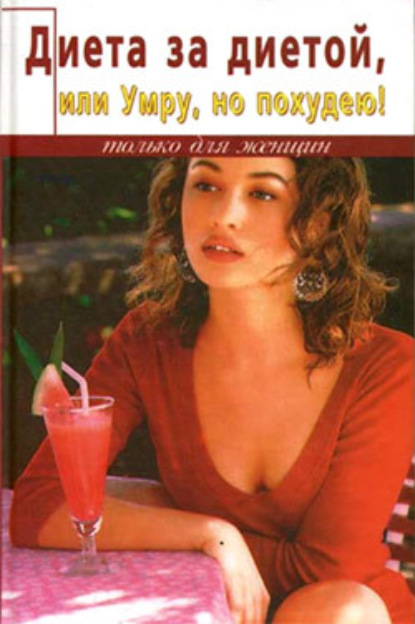- -
- 100%
- +
Diese Prozesse – namentlich der letztere – waren von tiefgreifenden Veränderungen in der Struktur der Gesellschaft und der bürgerlichen Öffentlichkeit begleitet. Gegenüber dem Führungsanspruch der aristokratischgroßbürgerlichen Klassen, der »guten Gesellschaft«, entwickelte sich das – wenn auch widersprüchliche – Selbstbewußtsein einer breiten mittel- und kleinbürgerlichen Schicht. Das zeigte sich in ökonomischer Hinsicht. Bei Verarmung eines Teils der Mittelschicht stieg ein anderer Teil – durch Expansion des Warenverkehrs und Industrialisierung, d. h. nicht nur als Kaufmann, sondern auch als Unternehmer, Ingenieur oder Kolonialbeamter – zu neuem Besitz und Ansehen auf, das wenig gemein hatte mit dem des Kaufmanns alten Stils oder des Landadels. Gleichzeitig bringt die »Revolution des Gefühls«, die romantische Stilisierung des Privaten und Innerlichen, der Mittelschicht das Selbstbewußtsein des endgültigen Sieges über aristokratischen Rationalismus und Skeptizismus, und das in dem Augenblick, da ihr die soziale »Nachtseite« sichtbar zu werden beginnt. Dies ist im Zusammenhang mit der Hysterie noch aufzugreifen.
Zugleich findet durch diese Vorgänge eine Dissoziation der bürgerlichen Öffentlichkeit statt. Wo diese sich nicht mehr defensiv gegen den äußeren Zwang absolutistischer Autoritäten zu konstituieren hat, sondern nach ihrem Sieg sich als »Gesellschaft« gleichsam mit sich selbst auseinandersetzt, erweist sich die Fiktivität der Lockeschen Identität des gesellschaftlichen Individuums als Eigentümer und Mensch. Politische und literarische Öffentlichkeit treten auseinander. Es kommt zum Begriff des Eigentums als Aneignungsrecht des für den eigenen Bedarf arbeitenden Kleineigentümers das Recht auf Eigentumswahrung hinzu, das Recht auf systematische Verwertung von Großeigentum an Wirtschaftsgütern.43 Es erfolgt der Schritt zur »Politischen Ökonomie« in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die die von Locke immer noch naturrechtlich formulierten Gesetze der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Staates »zu Naturgesetzen der Gesellschaft selbst erklärt«.44 Adam Smith tritt seine Professur in Glasgow 1751 an. Dieser Bewegung immanent ist der Widerspruch zwischen ökonomischem und politischem Liberalismus. Zugleich entwickelt sich aus der literarischen Öffentlichkeit die Bewegung auf das Unmittelbare des »rein Menschlichen«. Sie entfaltet sich literarisch in der Romantik, politisch im Anspruch auf die Menschenrechte, und die Naturwissenschaften gewinnen getrennt und doch parallel zu ihrer wachsenden Objektivierung und Neutralisierung eine humanitäre, philanthropische Dimension; dies bezeichnet funktionell den Ort, an dem innerhalb der Medizin die Psychiatrie entsteht. Allen drei Entfaltungsrichtungen wohnt die Gefahr inne, den Menschen als abstrakt Subjektives – unter Kurzschließung seiner gesellschaftlichen und ökonomischen Existenz – auf einen abstrakt objektiv verstandenen Staat zu beziehen. Hier stellt die Moralphilosophie einen Vermittlungsversuch dar, indem sie kritisch die Nützlichkeit des bürgerlichen Wirtschaftens und der staatlichen Autorität in Einklang zu bringen trachtet – im Dienst einer »natural history of civil society«, nach der die Menschengattung von Natur aus dazu disponiert ist, ihre Lebensumstände zu verbessern.45
Konstitutiv für all diese Vorgänge ist indessen ein bisher nur peripher erwähnter Umstand, der wohl am meisten dazu beitrug, daß diese in radikaler Weise die Gesellschaftsstruktur veränderten, und der sie erst als einheitliche Bewegung verständlich macht. Die vom Standpunkt des Absolutismus und der bisherigen sozialen Erscheinungsformen des Naturrechts vernünftige Ausgrenzung der Unvernunft brach zusammen. In doppelter Expansion drang die Unvernunft – im Kern: die Armen und die Irren – in die bürgerliche Gesellschaft ein, und dehnte umgekehrt die Gesellschaft ihren zugleich befreienden und integrierenden Anspruch auf die Unvernunft aus, ohne daß dieser ambivalenten Dynamik widerspruchsfreie Formen zu Gebote standen. Das soziale Sichtbarwerden der Unvernunft vollzog sich in den einzelnen Dimensionen verschieden, überall jedoch mit buchstäblich »gemischten Gefühlen«. In der Wirtschaft stand der Abstiegsangst ruinierter Bauern und Kleinbürger der ständig wachsende Bedarf der Industrie an menschlicher Arbeitskraft gegenüber, und zwar – unter den Bedingungen der beginnenden Kapitalisierung – ein Bedarf an Menschen, gerade insofern sie arm, d. h. bedürftig und frei, d. h. ausgegrenzt aus tradierten sozialen Bindungen, also absolut verfügbar waren. Dem politischen Denken erschien diese Grenzaufhebung unter dem doppelten Aspekt der Ausdehnung des Rechts auf Freiheit auf alle Menschen und des Anspruchs ebenso umfassender Integration und der Verhinderung politischen Aufruhrs. Die Romantik erlebte sie – bedrohlich und faszinierend – als die Macht des Irrationalen. Nicht anders wurde sie von den Kirchen erfahren: zugleich als Bedrohung ihrer Zuständigkeit für die bürgerliche Moral und als Aufruf zu erweiterter caritativer und seelsorgerischer Tätigkeit. Besonders die Medizin wurde hierdurch einer Verflechtung dieser verschiedenen und gegensätzlichen ökonomischen Bedürfnisse, politischen Ansprüche, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Objektivierungen und humanitären Versprechen ausgesetzt, von der sie wohl durch ideologische Verdeckung, aber nie mehr faktisch loskam. Sie erlangte gesellschaftliche Autorität als Wissenschaft, auch unabhängig von dem von ihr jeweils erreichten Stand des Wissens und der Technik. Das gilt von der Medizin im allgemeinen, z. B. im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Seuchenbekämpfung, die Verlängerung der Lebenserwartung, die allgemeine Hygiene (Ernährung, Kleidung, Wohnung) und die Intensivierung der Arbeitsleistung. Aber ebenso bedeutsam war die Arbeitsteilung, die die Medizin vornahm, indem sie die Konstituierung einer eigenständigen Psychiatrie betrieb. Hierdurch erst wurde es möglich, zu einer Differenzierung und Entmythologisierung der klassischen Unvernunft zu kommen, d. h. dem »harten Kern« der Unvernunft, dem Irresein als Krankheit eine rationale Institution zuzuweisen, um der großen Mehrheit der Unvernünftigen – den Armen – viel von der in ihr gefürchteten Gefährlichkeit zu nehmen und sie umso reibungsloser in die neue Vernünftigkeit, die der Ökonomie, eingliedern zu können. Denn umgekehrt war es so, daß nicht so sehr die philosophische Deduktion der Unvernunft, nicht ihre bürgerliche Form, die Hysterie, zur Psychiatrie führten, auch nicht die Existenz der privaten Mad-Houses und die Sorge, die Defoe sich um dorthin exilierte bürgerliche Ehefrauen machte, sondern das gesellschaftliche Sichtbarwerden der Unvernunft, d. h. der Irren als »arme Irre«.
Das gesellschaftliche Interesse an den »armen Irren« hatte sich indessen schon in einigen Hinsichten angekündigt, freilich noch kaum im medizinischen Bereich. Zu diesen vorbereitenden Vorgängen gehört es, daß 1736 durch Act of Parliament alle Gesetze »against Conjurations, Inchantments, and Witchcrafts« aufgehoben wurden, die die Grundlage waren zur Verfolgung von Irren als Besessene, Hexen oder Zauberer.46 In Erweiterung des Gesetzes von 1714 wurde 1744 von Gemeinden nicht mehr nur verlangt, ihre »pauper lunatics« zur Sicherung der Öffentlichkeit an einen festen Ort zu bringen, sondern es sollte auch Sorge für ihre Heilung getragen werden: »curing such Person during such Restraint«.47 In der wissenschaftlichen Öffentlichkeit der Ärzte setzte die Diskussion über die »armen Irren« in nennenswertem Umfang später als in der politischen Öffentlichkeit ein.48
Neben den Gesetzgebern wurden die Kirchen frühzeitig aufmerksam. Namentlich soweit sie politisch machtlos waren, entwickelten sie eine zum Teil enthusiastische gesellschaftliche Aktivität. Das gilt vor allem für die methodistische Bewegung und ihren Führer John Wesley. Hier ist der Staat zwar die Verwirklichung der Legalität, aber nicht der Moralität, die vielmehr erst durch die Tätigkeit der Bürger oder durch die Kirchen in den Staat hineingetragen werden muß. Es gelang John Wesley zusammen mit seinen Mitarbeitern und Nachfolgern, die neuen Massen, welche die Industrielle Revolution hervorbrachte, dem Christentum nahezubringen. Mit Recht ist gesagt worden, daß Wesley mit seinen enthusiastischen und volkstümlichen Bekehrungsmethoden der Notleidenden »eine große politische und soziale Revolution in England verhindert hat«.49 Wesley begann 1738 mit seinen, den Bürger in ihrer doppelten Unmittelbarkeit erschreckenden Predigten für die »freien« Armen und in der »freien« Natur.50 Leiden und Schmerz waren die höchst realen Themen, wenn auch die Arbeiter entpolitisierend. Es waren das dieselben Gefühle, die das Bürgertum alsbald sublimiert in der Romantik zu leiden und zu genießen sich anschickte. Wesleys Interesse betraf aber nicht nur das geistliche, sondern auch das körperliche Heil. Schon 1747 verfaßte er in populärer Form Anweisungen für die Selbstbehandlung. In nichts entsprachen jedoch seine Anschauungen von der Spiritualisierung des Körperlichen zugleich mehr den medizinischen Vorstellungen seiner Zeit als im Phänomen der Elektrizität. Unmittelbar nach den ersten therapeutischen Experimenten Franklins mit einer »electric treatment machine« übernahm Wesley diese Methode – mehr als 10 Jahre, bevor sie Eingang in ein Krankenhaus fand. Nach und nach erwarb er mehrere Apparate, um die Behandlung der Armen kostenlos durchzuführen. 1760 brachte er seine Erfahrungen zu Papier unter dem bezeichnenden Titel The desideratum: or, electricity made plain and useful. By a lover of mankind, and of common sense. Es war für ihn vor allem das billigste »and rarely failing Remedy, in nervous Cases of every Kind«.51 Indem er zeigt, daß Hysterie bzw. Spleen nicht mehr das Vorrecht der guten Gesellschaft waren und sich ihre körperliche Qualität zunehmend in eine psychischmoralische umwandelte, wird deutlich, wie weitgehend es sich hier um gesellschaftliche Bedürfnisse handelt, denen sich die medizinische Wissenschaft zum Teil sekundär anpaßt. In seinem Tagebuch reflektiert Wesley 1759: »Why, then, do not all physicians consider how far bodily disorders are caused or influenced by the mind?«52
b) William Battie
Geistliche der verschiedenen Kirchen, die nach der Revolution so streitbar die Moralisierung der erweiterten Gesellschaft wahrnahmen, die die neue romantische Literatur von der Kanzel aus propagierten und sich zugleich gegenseitig bekämpften, waren – so scheint es – nicht selten auch die Väter der nun auftretenden ersten Psychiater. Dies gilt auch für William Battie (1704–1776), der bis in die jüngste Zeit in der Psychiatriegeschichte vergessen war. Es scheint uns, daß Battie der Psychiatrie das erste »Paradigma« gegeben hat, und zwar denkbar vollständig nach den Richtungen der Institution, der Praxis und der Theorie. Aus dem, was bis dahin mit dem zwiespältigen Begriff »Mad Business« bezeichnet worden war, wurde eine wissenschaftliche Disziplin der Medizin, aus den »armen Irren« wurden Patienten. Dies ist freilich antizipierend zu verstehen: Battie und sein Krankenhaus repräsentieren lediglich – jedoch für lange Zeit exemplarisch – den Beginn des langen Weges der Irren, als eines Teils der ausgegrenzten Vernunft, in die gesellschaftliche Integration. Daß der Stand der gesellschaftlichen Entwicklung ein solches Bedürfnis sichtbar machte, wurde beschrieben. Die Person Batties konnte dem entsprechen. Nach dem Tod seines Vaters studierte er weitgehend ohne eigene Mittel Medizin, hielt schon früh anatomische Vorlesungen, gab Ausgaben von Aristoteles und Isokrates heraus und war in seiner bei Cambridge eröffneten Praxis so erfolgreich, daß er 1738 nach London übersiedeln konnte. Er wurde Fellow of the Royal College of Physicians, hielt physiologische und klinisch-medizinische Vorlesungen, publizierte Bücher in diesen Spezialitäten, erhielt verschiedene ehrenvolle Aufträge und wurde endlich 1764 Präsident des College – der erste und offenbar bisher einzige Psychiater, dem diese Ehre zuteil wurde. Wenn es wichtig ist für die Konstituierung einer neuen Wissenschaft, daß der prospektive Gründer bereits in einem anderen Fach avanciert ist und daß ein Interesse einflußreicher Personen vorhanden sein muß, so verband sich beides in Battie: er war einer der berühmtesten Ärzte Londons und besaß hohes gesellschaftliches Ansehen. Hinzu kamen seine rastlose und vielseitige Aktivität – er baute ebenso gern Häuser wie er sich in Prozesse verwickelte – und eine Reformfreudigkeit, die Anstoß erregte; so gab er sich auf dem Lande gern als sein eigener Tagelöhner und kleidete sich entsprechend. Er führte ein, daß seine Kähne Themse-aufwärts nicht mehr von Menschen, sondern von Pferden gezogen wurden, was ihm den Zorn der Reichen wie der Armen eintrug. Battie ist somit mit jenen Unternehmern späterer Jahrzehnte zu vergleichen, die die sozialen Mißstände wahrnahmen und die Reformen einleiteten, ohne darüber den eigenen Gewinn zu vergessen. Als Battie starb, besaß er 1–200 000 Pfund, zumal er ab 1754 auch ein eigenes privates Mad-House betrieben hatte.
Seine psychiatrische Tätigkeit begann damit, daß er sich 1742 zum »governor« (also in den »Aufsichtsrat«) des Bedlam Hospital wählen ließ. Hier nahm er sich – neben seinen medizinischen und sonstigen Aktivitäten – acht Jahre Zeit, um die Irren zu beobachten und um die dortigen, schon sprichwörtlichen Mißstände kennenzulernen. Gerade in dieser Zeit wurde Bedlam von den meisten romantischen Schriftstellern besucht, Hogarth umgab mehrere Sujets mit Szenen aus dem Irrenhaus, und bei den Karikaturisten wurde es modern, die großen Politiker angekettet in Irrenzellen zu zeichnen. 1750 versammelten sich – wohl auf Batties Anregung – sechs angesehene Londoner Bürger (unter ihnen zwei Kaufleute, ein Drogist, ein Apotheker und ein Arzt), um einen Spendenaufruf zu erlassen für eine neue, bessere Institution – eigens für die Irren, namentlich die »armen Irren«. Schon diese Schrift, von Battie diktiert, muß als revolutionär angesehen werden: es ist nicht nur ständig von »eure« statt von »care« die Rede, und es wird nicht nur beschrieben, daß nirgends eine Institution für die wenig bemittelten Irren existiert, zumal die Behandlung lange und teuer sei, sondern es wird auch zum erstenmal schriftlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, daß dem Wartungspersonal für die Irren eine Spezialausbildung zuteil werden müsse; und endlich wagt man es, diese neue Einrichtung von vornherein als psychiatrische Ausbildungsstätte für Medizinstudenten zu planen: »For more Gentlemen of the faculty, making this Branch of Physick, their particular Care & Study, it may from thence reasonably be expected that the Cure of this dreadful Disease will hereafter be rendered more certain and expeditious, as well as less expensive.«53 Man versteht das Umwälzende dieser Forderung, wenn man erfährt, daß das Bedlam sich noch bis 1843 sträubte, Medizinstudenten zum klinischen Unterricht zuzulassen. Schon 1751 konnte diese neuartige Einrichtung, als St. Luke’s Hospital, eröffnet werden. Battie wurde von den Governors zum ersten Arzt bestellt und erhielt 1753 von ihnen gleichsam den ersten Lehrauftrag. Obwohl es auch hier noch Zwang (z. B. Handschellen) gab, kam es nie zu Mißbrauch und zu Skandalen, wie sie für das Bedlam charakteristisch waren. Ebensowenig wurde der Brauch der öffentlichen Irren-Schau fortgesetzt. Battie ersetzte diese Einrichtung, in der die Irren in ihrer Ausgegrenztheit der Moralisierung der Öffentlichkeit dienstbar gemacht waren, durch eine neue Institution, in der die Irren zwar in den Raum gesellschaftlicher Tätigkeit hineingezogen werden, aber – abgeschirmt von der bürgerlichen Öffentlichkeit – in einen neutralisierten Sonderbereich verwiesen werden, den der medizinischen Wissenschaft, der seinerseits – durch die Zulassung von Studenten – zu einer immanent-medizinischen Öffentlichkeit erhoben wird.
1758 erschien Batties theoretischer Ansatz A Treatise on Madness, der erste, der auf umfangreicher eigener Erfahrung basiert und entsprechend auf alle theoretische Fundierung der Tradition verzichtet, dabei den Gegenstand vollständig behandelt und zugleich von selten wieder erreichter Kürze ist (99 Seiten). Auch er sieht sich, in der Einleitung, in einem pragmatischen Zusammenhang: die Bürger von London dachten an die Zukunft und an die Irren aller Nationen, als sie die Gründung von St. Luke’s von der Planung an als Gelegenheit und Aufforderung dafür ansahen, daß mehr Mediziner sich mit den Problemen der Irren und ihrer Behandlung vertraut machen sollten. Für diese und andere Studenten habe er seine Gedanken niedergeschrieben. Damit war das erste psychiatrische Lehrbuch entstanden und der Kanon der formalen Bestandteile und Einrichtungen, die die Psychiatrie als Einheit von Forschung, Lehre und Praxis ausmachen, fast vollständig.
Auch der Inhalt dieses Buches ist modellhaft, schon weil Battie Vorstellungen in ein Konzept zusammenbringt, die erst nach mehr oder weniger langer Zeit als Alternativen auseinanderfallen und zum Teil noch heute dem Prinzipienstreit der Psychiatrie Nahrung geben. In einer Art von negativdialektischem Pragmatismus differenziert er zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir nicht wissen, zwischen »positive« und »negative science«, hält aber beides für die Erkenntnis der »practical Truth« für gleich wichtig.54 Die Erklärung der Empfindung (»natural sensation«) bestimmt zunächst anatomisch ihren Sitz in Nerven und Gehirn, in keiner anderen Materie. Er unterscheidet von den (äußeren und inneren) Objekten bzw. Reizen als entferntere Ursachen die essentielle und innere Ursache, die wir nicht kennen, die aber in der Konstitution der Nervensubstanz selbst liegen muß. Das letzte Glied, dessen Wirkung von den Objekten her wir kennen, ist der Druck (»pressure«) auf die Nervensubstanz. Denn die Objekte können schon deshalb nicht die nächste Ursache darstellen, weil die Irren auch ohne die entsprechenden Objekte wahrnehmen können. Von diesem Ernstnehmen der Wahrnehmungen der Irren kommt Battie zu seiner Definition des Irreseins, der »madness«: »Deluded imagination, which is not only an indisputable but an essential charakter of Madness [...] precisely discriminates this from all other animal disorders: or that man and that man alone is properly mad, who is fully and unalterably persuaded of the existence or of the appearance of any thing, which either does not exist or does not actually appear to him, and who behaves according to such erroneous persuasion. [...] Madness, or false perception, being then a praeternatural state or disorder of Sensation.«55 Hier liegt ein Unterschied zu Locke: »madness« ist nicht mehr nur eine reine Verstandesstörung, eine falsche Ideenassoziation, sondern es kann die Empfindung selbst gestört sein, »disordered«, »false«, »deluded«, – sowohl die äußere wie die innere, »sensation« wie »imagination«. Es wird der Irre nicht mehr – aufgeklärt-absolutistisch – nach dem Modell vernünftiger Irrtumswiderlegung bzw. Unvernunft ausgrenzenden Zwangs gesehen, sondern die Störung wird als tiefgreifender und als realer, als neue eigenständige Realität anerkannt – gerade in ihrer Fiktivität. Indem hier die Empfindung selbst als krank erfaßt wird, wird die Störung in einen weiteren Rahmen gespannt, in dem ihr »Inneres« auf der einen Seite in der konkreten Körperlichkeit der Nervenmaterie verankert wird, während ihm auf der anderen Seite gerade dadurch ein Raum des selbständig Psychischen garantiert wird. Diese Konstellation wird es nach einigen Jahrzehnten erlauben, Wahnvorstellung, Halluzination und Paranoia psychologisch zu analysieren, wie Leibbrand und Wettley richtig sehen56, während zunächst noch Lockes »Verstandesstörung« das Modell blieb. Die Formel der »deluded imagination« zeigt darüber hinaus, daß Battie zwar auch von der romantischen Bewegung ergriffen ist. Aber gegen die enthusiastische Benutzung der »imagination« zur Aufhebung aller Grenzen des Gesunden und Kranken, wie Samuel Johnson sie durchspielt57, gewährt dasselbe Konzept der »madness« auch Distanz, insofern es sie – anatomisch lokalisiert – zugleich der materiellen Natur und ihren Gesetzen reserviert.
Eine weitere Kritik Batties richtet sich dagegen, in den Erscheinungen des Lebens eine rationale Vorplanung heilsamer Zwecke, d. h. die Herrschaft einer waltenden Vernunft zu sehen. Willis habe zu diesem Zweck die metaphorischen Begriffe »nature« und »anima« eingeführt. Stahl habe sie fälschlich mythologisiert, »deifyed«. Sie sind aber lediglich nützliche Worte, um die Darstellung medizinischer Tatsachen abzukürzen, und der junge Anfänger muß aufpassen, sie nicht mit einer wirklichen »intellectual agency« der »animal oeconomy«, »vital action« zu verwechseln, was so absurd wäre wie die »Faculties of the Ancients«.58 D. h. die erste Konzeption der »madness« ist verbunden mit der Annahme einer autonomen, sich selbst regulierenden Ökonomie, ohne planende Vernunft »von oben«.
Von »madness«, als qualitativ Neuem, sind zwei quantitativ-mechanische Empfindungsstörungen zu trennen: Angst, als zu große Erregung aufgrund eines realen, aber zu lange wirkenden Reizes einerseits und ihr Umschlag in zu geringe Erregung aufgrund eines realen Anlasses, die »insensibility«, bis hin zur Idiotie, andererseits. Wenn für Battie zu viel Angst »madness« einleitet und »insensibility« (oder Idiotie) ihren Ausgang darstellt, dann wird hier »madness« erstmals als historischer Verlauf konzipiert, in dem die qualitativ-irrationale Störung des Irreseins als mittleres, sich verselbständigendes Stadium eines rational faßbaren, quantitativ-mechanischen Prozesses begriffen wird. Auch hieraus entwickeln sich später – je nach der Akzentuierung des quantitativen oder des qualitativen Aspekts – konkurrierende Alternativen.59
Ätiologisch unterscheidet Battie 1. »original madness«, die nur durch »internal disorder« der Nervensubstanz bedingt ist, und 2. »consequential madness«, bei der die Störung »ab extra« erfolgt und über einen mittelschweren Druck (»pressure«) laufen muß, um jenes mittlere Stadium des Irreseins produzieren zu können. Die möglichen mechanischen und psychisch-moralischen (entfernteren) Ursachen stellt Battie in einem auch für die Zukunft recht vollständigen Katalog zusammen: Unfallverletzungen, Schädel-Exostosen, Hirnhautveränderungen, Gehirnerschütterung, Sonnenstich, Muskelspasmen (Fieber, Epilepsie, Geburtsvorgänge, Leidenschaften wie Freude und Zorn), Gifte, auch Alkohol und Opium, Geschlechtskrankheiten, langdauernde Konzentration des Geistes auf ein Objekt, Bewegungsmangel, Faulheit und Völlerei.60 – Mit der »original madness« hat Battie nicht nur das heutige Problem der Endogenität vorweggenommen, sondern auch die in Halle von G. E. Stahl philosophisch deduzierte »idiopathische Verrücktheit« negativ-klinisch definiert: »madness« ist eher original, wenn weniger Ursachen erkennbar sind, das Nervensystem schon erblich geschädigt ist und die Krankheit spontan, »without any assignable cause«, kommt und geht, weshalb diese Form weniger durch medizinische Wissenschaft, wohl aber oft von selbst heilbar ist. Hingegen ist »consequential madness« durch Ausschalten der sie bedingenden Ursachen zu heilen – doch nur bei schnellem Eingriff, da sonst durch Habitualisierung der mechanischen oder moralischen kausalen Gegebenheiten die Störung – im Sinne einer zweiten Natur – so unangreifbar wird wie der Naturdeterminismus der »original madness«.61 Durch diese Betonung der Macht der Gewohnheitsbildung tritt ein wesentlicher Teil der Unvernunft des Irreseins – wie gleichzeitig auch die Hysterie – hinsichtlich möglicher ärztlicher Praxis in den Bereich moralphilosophischen Denkens.
Unter dessen Einfluß geschieht es auch, daß Battie die spätere, die Irren insgesamt vergesellschaftende Bewegung des »moral management« einführt. Sein lapidarer Satz »management did much more than medicine« besagt für den als Psychiatrie sich verselbständigenden Bereich der Medizin, daß man die herkömmliche Anwendung zahlloser Medikamente als unsinnig abtut und daß diese neue Spezialität sich auch in der Richtung einer »moral science« entwickelt. Für die durch das Medium des St. Luke’s oder ähnlicher Einrichtungen in die bürgerliche Gesellschaft eintretenden Irren bedeutet dieser Satz, daß an die Stelle ihrer bisherigen Ausgegrenztheit, ihrer naturwüchsigen »Freiheit« und ihres Ausgesetztseins privater Willkür und Ausbeutung, beliebiger Gewaltanwendung und allgemeiner Regel- und Rechtlosigkeit nun eine dem Anspruch nach zwar philanthrope, aber ebenso universelle moralische Ordnung aller Daseinsbereiche tritt, solange diese Krankheit »inexplicable by general science and the common law of Nature« ist. Diese Einschränkung zeigt, daß hier »moral management« nur ersatzweise für den eingestandenen Mangel der Naturbeherrschung eintritt, während spätere Zeiten diese »negative science«, die Widerständigkeit der Natur aus ihrem Erkenntniskalkül streichen und »moral management« selbst als spezifisches Mittel bestimmen werden. Die andere Differenz des »moral management« gegenüber der rationalistischen Ausgrenzung liegt darin, daß »madness« jetzt nicht mehr als Irrtum am Maßstab einer objektiven Wahrheit verstanden und durch Korrektur des Irrtums zu heilen ist. Vielmehr gilt »madness« nun als Abweichung (»deviation«) der Empfindungen bzw. des Verhaltens vom rechten Mittelmaß der »animal oeconomy«. Heilung ist Reduktion der Extreme auf diese Mitte der »practical truth«. Die Regeln dieses »management« sind etwa folgende: völlige Loslösung aus den sozialen Beziehungen (Wohnung, Familie), wobei selbst gegenüber den Reichen die wissenschaftliche Autorität sich über die soziale hinwegsetzt, indem solchen Patienten ihre gewohnten Bediensteten zu nehmen sind; Fernhalten der Nerven von allen reizenden Objekten; Ordnung der ungeregelten Strebungen; Zerstreuung der fixierten Imagination; Beschäftigung muß zwischen Lust und Unlust indifferent sein; im Rahmen dieses Regimes versucht man, die erkennbaren Ursachen zu eliminieren, wobei die Leidenschaften durch Narkotika oder durch Erregung der entgegengesetzten Passion (Furcht gegen Zorn, Sorge gegen Freude) aufs Mittelmaß zu temperieren sind; bei Völlerei und Müßiggang ist dem Arzt auch Zwang – z.B. schmerzerzeugende Medikamente – erlaubt, um die Patienten zu einem maßvollen und arbeitsamen Lebenswandel zu konditionieren.62