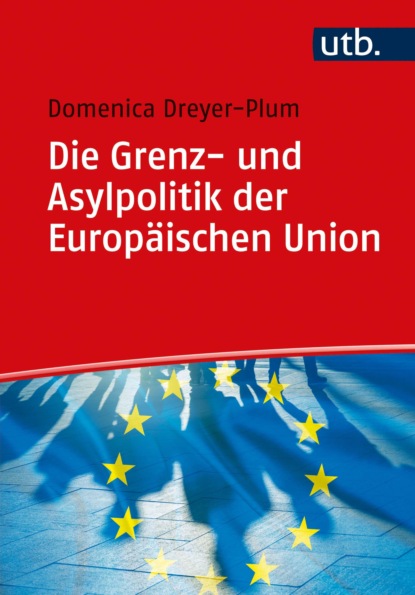- -
- 100%
- +

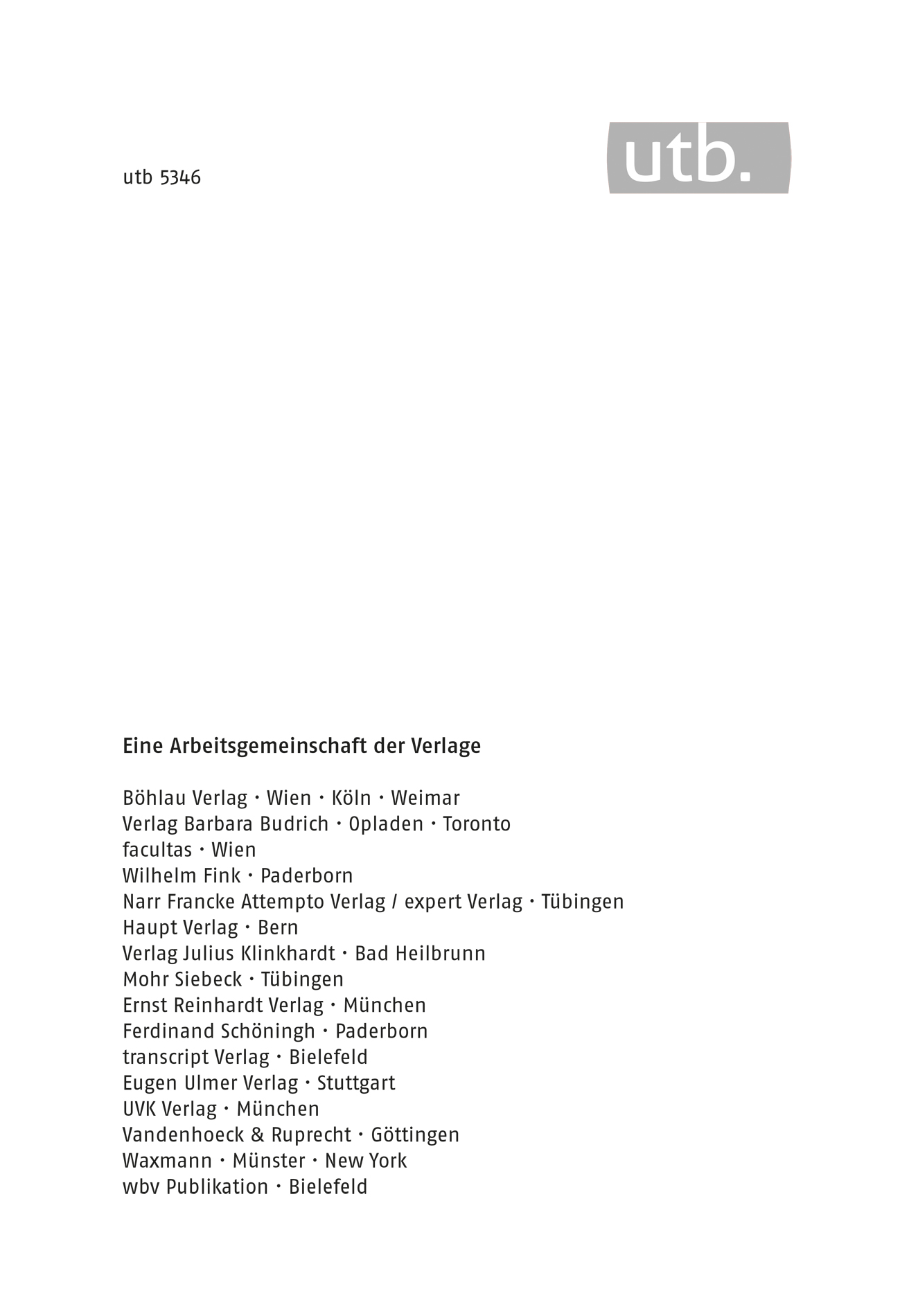
Domica Dreyer-Plum
Die Grenz- und Asylpolitik der Europäischen Union
UVK Verlag · München
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© UVK Verlag 2020
– ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Nymphenburger Straße 48 · 80335 München
www.uvk.de
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · 72070 Tübingen
info@narr.de | www.narr.de
ISBN 978-3-8252-5346-2 (Print)
ISBN 978-3-8463-5346-2 (ePub)
Für meine Eltern
Flucht, Asyl und Migration sind keine nationalen oder europäischen, sondern globale Themen, die Fragen globaler Gerechtigkeit betreffen und liberale Demokratien mit der Frage konfrontieren, ob individuelle Rechte (Asyl) oder staatliche Souveränität (Grenzschutz) Vorrang erhalten.
Flucht, Asyl und vor allem Schutzgewährung sind mit der Zuwanderung im Jahr 2015 von mehr als 1 Mio. Menschen nach Europa – und vor allem nach Deutschland und Schweden – zu Topthemen der Tagespolitik geworden. Rechtspopulistische Parteien wie die Alternative für Deutschland (AfD), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und der Front National (seit 2018: Rassemblement National) in Frankreich nutzen bewusst fremdenfeindliche Parolen, um ihre Wählerschaft in diesem Segment zu gewinnen. Demgegenüber stehen PolitikerInnen und BürgerInnen, die eine humanitäre Asylpolitik im Sinne rechtsstaatlicher Grundwerte einfordern. Seit 2015 ist die Asylpolitik nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene eine Streitfrage mit dem Potenzial, Gesellschaften zu spalten.
Asylpolitik ist unter den geltenden rechtlichen Bestimmungen immer auch Grenzpolitik, weil es bisher nicht möglich ist, ein Visum zu beantragen, um in einem europäischen Land wegen politischer oder religiöser Verfolgung Schutz zu suchen. Daher ist die irreguläre Einreise unter Nutzung von Schleusernetzwerken oft die einzige Möglichkeit für Asylsuchende, unter Umgehung der geltenden Einreisebestimmungen nach Europa zu gelangen.
Die Politikfelder Grenze und Asyl sind in der Justiz- und Innenpolitik angesiedelt und liegen teilweise in der Kompetenz der Europäischen Union, teilweise in mitgliedstaatlicher Souveränität. In jedem Fall erfolgt die Umsetzung des Unionsrechts1 in den Mitgliedstaaten durch deren Behörden und Akteure.
Während die Kontrolle der Außengrenzen prinzipiell in der Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten liegt, so unterliegen die Binnengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union den Schengener Rechtsprinzipien, die die Offenheit der Grenzen zur Gewährleistung des freien Personen- und Warenverkehrs vorsehen. Die Asylpolitik ist stärker europäisiert als andere Politikfelder und dennoch divergieren sowohl die Asylentscheidungen zwischen Mitgliedstaaten als auch die Leistungen gegenüber Asylsuchenden erheblich.
Aus diesen Beobachtungen ergeben sich allerlei Fragen: Wer sind die entscheidenden Akteure in der europäischen Grenzpolitik respektive Asylpolitik? Welche Verantwortung trägt die Europäische Union (EU) und welche Kompetenzen sind ihr zur Gestaltung der Außengrenzschutz- und Asylpolitik übertragen worden? Welche Möglichkeiten haben die Mitgliedstaaten, die europäische Politik mitzugestalten? Durch welche Rechtsinstrumente haben die europäischen Institutionen bisher die Grenz- und Asylpolitik geprägt? Welche Regeln gelten und welche Bedeutung haben sie in der Asylschutzkrise seit 2015?
Ziel dieses Lehrbuchs ist es, einen Überblick über die bestehenden europäischen Regeln in den Bereichen der Grenz‑ und Asylpolitik zu geben. Dabei wird es wichtig sein, den engen Zusammenhang zwischen beiden Bereichen aufzuzeigen und die Kompetenzverwebungen zwischen nationaler und europäischer Ebene aufzuzeigen.
Zunächst widmen wir uns dem historischen und politischen Hintergrund der Vergemeinschaftung europäischer Grenz‑ und Asylpoiltik, die wesentlich im Integrationsprojekt Schengen begründet liegt (Kapitel 2). Darauf folgt eine genaue Betrachtung der Grenzpolitik mit einem Blick auf politische Ziele und praktischen Grenzschutz, Einreisebestimmungen und Konflikte (Kapitel 3). Dem folgt eine Auseinandersetzung mit der Asylpolitik (Kapitel 4) anhand folgender Fragen: Was bedeutet Asyl? Seit wann bestimmt die Europäische Union über europäische Asylpolitik? Mit welchen Mitteln wird Asylpolitik gestaltet? Was ist der Kern des politischen Streits um europäische Asylpolitik? Im Schlusskapitel (Kapitel 5) werden die wichtigsten Antworten auf die aufgeworfenen Fragen festgehalten.
2 Historische Grundlagen
Die europäische Grenz‑ und Asylpolitik ist ebenso wie andere Politikfelder erst im Laufe der europäischen Integrationsgeschichte in die Gemeinschaftspolitik hineingewachsen. Als wesentliche Erklärung für die schrittweise Vergemeinschaftung der Grenz‑ und Asylpolitik gilt der Kooperationsbeginn im sogenannten Schengenraum1 in den 1980er Jahren. Der politische Wille zur Realisierung einer der Grundfreiheiten der Römischen Verträge – freier Personenverkehr (Art. 3 Abs. c EWG-Vertrag) – leitete zunächst Deutschland und Frankreich an, in Kooperation mit den Benelux-Staaten die Öffnung ihrer Binnengrenzen zu verwirklichen. In diesem Kapitel wird in das Thema eingeführt, indem der Beginn der politischen Zusammenarbeit in Grenz‑ und Asylfragen skizziert (Kapitel 2.1) und die Grenz‑ und Asylpolitik als typisches Beispiel für europäische Integrationsprozesse besprochen werden (Kapitel 2.2).
2.1 Kontext des europäischen Integrationsprozesses
Mit dem Begriff europäischer Integrationsprozess ist die Entwicklung der europäischen Rechtsgemeinschaft gemeint, die in den 1950er Jahren begonnen und bis heute nicht abgeschlossen ist. Im Jahr 1952 unterzeichneten sechs europäische Staaten einen Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und StahlEuropäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der die transnationale Zusammenlegung dieser kriegsintensiven Märkte vorsah.
Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg erhofften sich in der Nachkriegszeit von dieser Zusammenarbeit einerseits die Rückgewinnung des Vertrauens ineinander, andererseits bestimmte der wirtschaftliche Wiederaufbau die politische Agenda der Gründerstaaten. Die Zusammenarbeit in den Industriezweigen Kohle und Stahl sollte wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand generieren. Dieses Anliegen hielten die Unterzeichner auch in der Präambel des Vertrags fest. Ihr Ziel war es „durch die Ausweitung ihrer Grundproduktionen zur Hebung des Lebensstandards und zum Fortschtitt der Werke des Friedens beizutragen“ und zeigten sich
„entschlossen, an die Stelle der jahrhundertealten Rivalitäten einen Zusammenschluß [sic!] ihrer wesentlichen Interessen zu setzen, durch die Errrichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter Völkern zu legen“ (EGKS-Vertrag, Präambel).
Eine von den Mitgliedstaaten unabhängige internationale Behörde (Hohe Behörde) war mit der Aufgabe betraut, die Ziele des Vertrags durch Verwaltungsakte zu verwirklichen. Kontrolliert wurde diese Behörde durch einen Rat, in dem die jeweiligen Fachminister der Mitgliedstaaten vertreten waren; sowie durch eine parlamentarische Versammlung, in die gewählte Abgeordnete der nationalen Parlamente für die jährliche Sitzungsperiode entsandt wurden.
Die folgenden knapp 70 Jahre seit Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl – die auch als Montanunion bezeichnet wird – sind gleichermaßen geprägt durch Prozesse der Erweiterung und Vertiefung der Gemeinschaft. Die Aufnahme neuer Mitgliedsländer hat die Gemeinschaft von ursprünglich sechs auf 28 Mitgliedstaaten wachsen lassen. Zur Vertiefung zählt die wachsende Zuständigkeit der europäischen Gemeinschaft in immer mehr Politikfeldern und gleichzeitig die Intensivierung der Zusammenarbeit.
Die Kooperationsbereiche wurden zunächst auf einen gemeinsamen Markt ausgedehnt (Römische Verträge, 1957 unterzeichnet, 1958 in Kraft getreten), dann um Kooperationen im Bereich Forschung und Technologie, Umwelt, Sozialpolitik, Außen‑ und Sicherheitspolitik erweitert (Einheitliche Europäische Akte, 1986 unterzeichnet, 1987 in Kraft getreten). Die Justiz- und Innenpolitik, polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Wirtschafts‑ und Währungsunion sind in den 1990er Jahren hinzugetreten (Maastrichter Vertrag, unterzeichnet 1992, in Kraft getreten 1993). Alle Verträge und Reformen gehen in den 2007 unterzeichneten und 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon ein.
Immer mehr Politikfelder liegen nun in der ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen UnionZuständigkeit der Europäischen Union, darunter gemäß Art. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV): Zollunion, Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt, Währungspolitik, Handelspolitik. In weiteren Bereichen teilen sich die Europäische Union und die Mitgliedstaaten die Kompetenzen, darunter gemäß Art. 4 AEUV: Binnenmarkt, Sozialpolitik, Landwirtschaft und Fischerei, Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr, Energie, Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Forschung und Technologie. Schließlich gibt es Bereiche, in denen die Europäische Union die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt und koordiniert, darunter gemäß Art. 6 AEUV: Gesundheit, Industrie, Kultur, Tourismus, Bildung, Verwaltungszusammenarbeit.
Doch auch die institutionelle Organisation unterlag tiefgreifenden Veränderungen. Von einer technokratischen Struktur der Montanunion (1952/1953), die zunächst ganz auf die Hohe Behörde (heute: Europäische Kommission) ausgerichtet war, wurde mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge (1957) ein System geschaffen, das die exekutiven Regierungsvertreter im Rat zu den Entscheidungsträgern der Gemeinschaft machte. Es folgte die Einführung der Direktwahl des Europäischen Parlaments (1979) und seit der Einheitlichen Europäischen Akte mit dem Kooperationsverfahren die stärkere Einbeziehung des Europäischen Parlaments als Gesetzgeber. Seit dem Lissabonner Vertrag (2009) sind Rat und Parlament in den meisten Politikbereichen gleichberechtigte Gesetzgeber. Europäische Politikentwicklung basiert nun überwiegend auf Vorschlägen der Kommission, die vom Rat der EU und vom Europäischen Parlament gelesen, geändert und beschlossen werden. Immer mehr Entscheidungen werden nun durch qualifizierte Mehrheiten statt nach dem lange im Rat dominierenden Einstimmigkeitsprinzip verabschiedet.
Fragen zu Grenzen und Asyl rückten ab den 1980er Jahren im Zuge der Schengen-Politik (ab 1984) und der Neuausrichtung der europäischen Integration mit der Einheitlichen Europäischen Akte (1985-1987) auf die Agenda der europäischen Politik.
Formal fällt die Grenz‑ und Asylpolitik unter die Justiz‑ und Innenpolitik eines Staates. Es handelt sich um eine der Kernkompetenzen des Staates, schließlich bedeutet die Kontrolle über die Einreise die Kompetenz, darüber zu entscheiden wer sich im Land aufhalten darf. Damit wird – gerade bei langfristigen Aufenthaltstiteln – auch über die Komposition der Gemeinschaft entschieden.
Unter diesen Vorzeichen ist es geradezu revolutionär, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit dem Schengener AbkommenSchengener Abkommen die Grundfreiheiten der Römischen Verträge von 1957 – freier Waren-, Dienstleistungs- Personen- und Kapitalverkehr – verwirklichten, indem sie Kontrollen an den gemeinsamen Landesgrenzen abschafften und zuließen, dass die Außengrenzen der kooperierenden Staaten zu Außengrenzen der Schengengemeinschaft und damit zu gemeinsamen Außengrenzen wurden.
2.1.1 Grenz- und Asylpolitik als Teil europäischer Justiz- und Innenpolitik
Grenz- und Asylpolitik werden klassischerweise dem Innenressort zugeordnet. Dies ist auch auf europäischer Ebene nicht anders. Doch die Bezeichnung entspricht nicht dem üblichen Sprachgebrauch: Im Vertrag von Lissabon wird die Innen- und JustizpolitikInnen- und Justizpolitik der Europäischen Union unter dem Titel Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zusammengefasst. Dazu zählen die Politik im Bereich Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung, justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen sowie polizeiliche Zusammenarbeit (Kapitel 1-5 des Titels V, AEUV).
Die Politikfelder Grenze, Asyl und Einwanderung werden zwar gleichrangig aufgelistet, es gibt allerdings erhebliche Unterschiede bei den Kompetenzzuweisungen zwischen nationaler und europäischer Ebene. Während die Binnengrenzenpolitik ein Gemeinschaftsfeld ist, bleibt der Außengrenzschutz in der Souveränität der jeweiligen Mitgliedstaaten.
In der Einwanderungspolitik gibt es lediglich vereinzelte gemeinsame Ansätze wie die Blaue Karte, die hochqualifizierten Arbeitskräften den Aufenthalt im europäischen Raum für mehr als drei Monate ermöglichen soll (Richtlinie 2009/50/EG v. 25.5.2009). Überwiegend bleibt die Einwanderungspolitik jedoch in der Domäne der Mitgliedstaaten und ist dort als innenpolitisches Streitthema bekannt. Ebendiese politische Brisanz auf nationaler Ebene macht eine Europäisierung bis auf weiteres undenkbar.
Die Asylpolitik ist von den drei Bereichen das am weitesten entwickelte europäische Politikfeld. Von 1999 bis 2013 ist in zwei Etappen ein umfassendes Regelwerk entstanden, das alle Schritte eines Asylverfahrens von der Antragstellung bis zu den Rechten als anerkannter Flüchtling festlegt. Doch wie jedes europäisierte Politikfeld bleibt auch die Asylpolitik davon abhängig, dass die Mitgliedstaaten die Vorgaben vor Ort gewährleisten.
Die Europäisierung dieser Bereiche variiert also stark. Grenzschutz und Einwanderungspolitik liegen weiterhin in nationaler Verantwortung und werden auf europäischer Ebene lediglich koordiniert. Die Asylpolitik hingegen ist ein europäisches Thema. Hinzu kommt die Koordinierung der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit. Daraus ergibt sich die Agenda der Innen- und Justizminister bei ihren regelmäßigen Tagungen im Rat der EU. Die politischen Leitlinien in diesem Politikfeld werden vom Europäischen Rat, also von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten festgelegt (Art. 68 AEUV).
2.1.2 Die Grenz‑ und Asylpolitik in den Verträgen der europäischen Gemeinschaften
Die Grenz- und Asylpolitik ist erst 1999 mit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam zu einem gemeinsamen europäischen Politikfeld geworden. Diese funktionale wie politische Vertiefung europäischer Integration lässt sich jedoch unmittelbar mit dem Gründungsvertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft aus dem Jahr 1957 in Verbindung bringen. Im Zentrum der Gründungsverträge (und damit am Beginn der europäischen Intgration) stand die Errichtung eines gemeinsamen Marktes:
„Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größere Stabilität, eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und engere Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern, die in dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen sind.“ (Art. 2 EWG-Vertrag)
Um diesen gemeinsamen Markt zu errichten, sollten zunächst Zolltarife innerhalb der Gemeinschaft abgeschafft werden, um den freien Warenaustausch innerhalb der neu gegründeten Wirtschaftsgemeinschaft zu ermöglichen (Art. 3 lit. a EWG-Vertrag). Der freie Warenverkehr ist eine der vier GrundfreiheitenGrundfreiheiten, die in den Römischen Verträgen als Ziele der Gemeinschaft festgelegt wurden und bis heute den Charakter der Europäischen Union prägen (Titel I, insbesondere Art. 9 EWG-Vertrag).
Ein Großteil der Rechtsetzung und Rechtsprechung auf europäischer Ebene lässt sich auf diese vier Hauptziele zurückführen: Freier Warenverkehr, freier Personenverkehr, Dienstleistungsfreiheit und freier Kapitalverkehr (Titel I und III, EWG-Vertrag, insbesondere Art. 9, 48, 52, 59 EWG-Vertrag).
Der freie Personenverkehr war zunächst streng auf den Markt begrenzt und bedeutete die Freiheit, in einem der Mitgliedstaaten eine Arbeit aufzunehmen und unabhängig von Staatsangehörigkeit beschäftigt und entlohnt zu werden (Art. 48 Abs. 2 EWG-Vertrag). Ebenso wie sich Bürger frei in einem der Mitgliedstaaten niederlassen können, gilt dies auch für Unternehmen bspw. durch die Gründung von Tochtergesellschaften (Art. 52f. EWG-Vertrag).
Die Dienstleistungsfreiheit sollte es jedem Unternehmer ermöglichen, seine Dienstleistungen im gesamten Raum der Wirtschaftsgemeinschaft anzubieten (Art. 59 EWG-Vertrag). Bisherige Beschränkungen – gerade auch verwaltungsrechtlicher Natur (Anerkennung usw.) – sollten schrittweise abgebaut werden.
Schließlich galt es die Beschränkungen des Kapitalverkehrs soweit aufzuheben, wie es „für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes notwendig ist“ (Art. 67 EWG-Vertrag). Der Vertrag sah vor, dass solche Maßnahmen auf Vorschlag der Kommission vom Rat zunächst einstimmig und nach Ablauf einer Übergangsphase von acht Jahren mit qualifizierter Mehrheit angenommen würden (Art. 69 EWG-Vertrag).
Offensichtlich gerieten die Freiheiten des Marktes in Konflikt mit den physichen Grenzen der Mitgliedstaaten. Durch Grenzkontrollen kam es zu Verzögerungen beim Transport von Waren, doch auch der Personenverkehr wurde dadurch beeinträchtigt. Insofern stand die Grenzpolitik den Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes und damit dem Hauptziel und Motiv der Gründungsverträge entgegen. Wollte man die Freiheiten verwirklichen, so brauchte es eine Öffnung der traditionell national kontrollierten Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten.
Die funktionale Notwendigkeit der Öffnung von Grenzen zwischen den beteiligten Staaten lag damit auf der Hand. Die informelle Kooperation in den Bereichen Justiz, Inneres, Asyl und Grenzen begann bereits in den 1970er Jahren (Hailbronner und Thym 2016a: 2, Rn 2). Doch zu einer verbindlichen Initiative dieser Art kam es erst 1984 mit einem deutsch-französischen Regierungsabkommen und dem 1985 unterzeichneten Schengener AbkommenSchengener Abkommen zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Darin ist die Abschaffung von Personenkontrollen an den Binnengrenzen des Gemeinsamen Marktes festgelegt. Bevor dieses politische Ziel verwirklicht werden konnte, brauchte es gemeinsame Standards bei der Einreise in den Wirtschaftsraum und bei der Frage, wann unter welchen Bedingungen durch welchen Staat Asyl gewährt wird. Denn die Abschaffung von Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten bedeutete, dass die Außengrenze eines Mitgliedstaates zur Außengrenze des gesamten Wirtschaftsraums wurde. Wer in den europäischen Wirtschaftsraum einreiste, konnte sich bei der Aufhebung von Binnengrenzkontrollen prinzipiell frei zwischen den Mitgliedstaaten bewegen.
Die Einheitliche Europäische AkteEinheitliche Europäische Akte (1987) hielt vertraglich fest, dass die Personenfreizügigkeit durch die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen der Gemeinschaft bis Ende 1992 auf eine neue Stufe gehoben werden sollte. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte war der EWG-Vertrag um folgenden Artikel 8a ergänzt worden:
„Die Gemeinschaft trifft die erforderlichen Maßnahmen, um bis zum 31. Dezember 1992 gemäß dem vorliegenden Artikel […] den Binnenmarkt schrittweise zu verwirklichen. Der Binnenmarkt umfaßt [!] einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags gewährleistet ist.“
Diese Öffnung der Binnengrenzen sollte mit gemeinsamen Regeln bei den Außengrenzkontrollen und der Schaffung einer gemeinsamen Einwanderungs‑ und Asylpolitik einhergehen, wofür die Gemeinschaft aber zunächst kein vertragliches Mandat erhielt. Hier bestand also eine rechtliche Lücke zwischen dem Vertragsziel der Einheitlichen Europäischen Akte, die die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen innerhalb von sechs Jahren vorsah, ohne jedoch der Kommission ein Mandat zur Schaffung flankierender rechtlicher Maßnahmen zum Außengrenzschutz, zur Einreise und zur Gestaltung der Asylpolitik zu erteilen (Morijn 2017: 186).
Tatsächlich handelten die Mitgliedstaaten zunächst außerhalb des rechtlichen und institutionellen Rahmens der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft begleitende Maßnahmen der Einreise‑ und Asylpolitik aus. Es wurden mehrere ad-hoc-Arbeitsgruppen gegründet, die sich mit den von der Grenzpolitik berührten Feldern befassten, darunter zu den Bereichen Einwanderung (Außengrenzkontrollen, Visa, Asyl), justizielle Kooperation, TREVI (Polizei, Sicherheit, Terrorismus) und CELAD zur Bekämpfung der Drogenkriminalität (Morijn 2017: 186).
So entstand 1990 im Zuge des Schengener Abkommens das Dubliner ÜbereinkommenDubliner Übereinkommen ebenfalls als völkerrechtliches Instrument, das aber erst 1997 in Kraft trat. Es enthielt einen Kriterienkatalog, nach dem geprüft werden sollte, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. So sollte verhindert werden, dass Asylanträge in mehreren Mitgliedstaaten gleichzeitig oder nacheinander verfolgt werden. Die Frist zur Aufhebung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen verstrich indes im Dezember 1992. Es dauerte noch mehrere Jahre bis die Binnengrenzkontrollen zunächst an den Grenzen zwischen Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten 1995 tatsächlichen aufgehoben wurden.
Im Vertrag von MaastrichtVertrag von Maastricht (1992 unterzeichnet/1993 in Kraft getreten) wurde die Asylpolitik erstmals als Bereich „gemeinsamen Interesses“ definiert (Art. K.1 Abs. 1 EGV-Maastricht), doch zunächst kein Mandat für asylpolitische Rechtsinstrumente erteilt. Der Vertrag von Maastricht hatte damit zwar den Rahmen für europäische Entscheidungsfindung in der Justiz‑ und Innenpolitik geschaffen, die in der neu gegründeten Europäischen Union noch streng nach intergouvernementalen Prinzipien funktionierte (Hailbronner und Thym 2016a: 2, Rn 2). Der Vertrag ermöglichte zunächst nicht mehr als die Verabschiedung unverbindlicher gemeinsamer Positionen, die im Sinne völkerrechtlicher Vorschriften von den jeweiligen nationalen Parlamenten ratifiziert werden mussten (Art. K.2 Abs. 2 EGV-Maastricht). Diese Vorgaben stellten sich als ineffizient heraus, sodass in diesem Bereich kaum politische Ergebnisse generiert wurden (Hailbronner und Thym 2016a: 2, Rn 2).
Erst der Vertrag von AmsterdamVertrag von Amsterdam (1997 unterzeichnet, 1999 in Kraft getreten) benannte konkrete Aufträge zur Rechtsetzung im Bereich Asyl (Art. 73 lit. i und lit. k EGV-Amsterdam). Die europäischen Institutionen – zu diesem Zeitpunkt Europäische Kommission und Rat der EU unter Anhörung des Europäischen Parlaments – sollten Maßnahmen beschließen, um nach objektiven und fairen Kriterien festzulegen, wer für die Prüfung eines Asylantrages zuständig sei. Dies entspricht inhaltlich dem, was bisher durch das Dubliner Übereinkommen geregelt wurde. Tatsächlich wurde auf Grundlage des Mandats im Vertrag von Amsterdam eine Verordnung erlassen, die als Dublin-II-Verordnung (VO (EG) Nr. 343/2003 v. 18.2.2003, Abl. Nr. L 50/1 v. 25.2.2003) bekannt ist und als Nachfolgeinstrument des Dubliner Übereinkommens die Bestimmungen dieses Instruments in weiten Teilen übernimmt.
Der Vertrag von Amsterdam ist gleichzeitig der Vertrag, mit dem der bestehende Schengener Besitzstand, darunter (1) das Schengener Abkommen vom 14. Juni 1985, (2) das Schengener Durchführungsübereinkommen vom 19. Juni 1990, (3) die Beitrittsprotokolle und ‑übereinkommen mit Italien, Griechenland, Österreich, Dänemark, Finnland und Schweden, (4) die Beschlüsse und Erklärungen, die vom Exekutivausschuss auf Grundlage des Durchführungsübereinkommens erlassen wurden; in das Gemeinschaftsrecht aufgenommen wurde.1 Inzwischen gilt der Schengener Besitzstand als das Rückgrat der EU-Einwanderungs‑ und Asylpolitik (Hailbronner und Thym 2016a: 2, Rn 1).