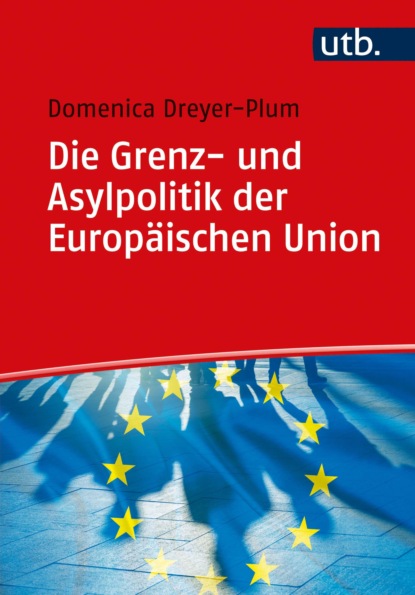- -
- 100%
- +
Die EU ist ein Verbund, „eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der Mitgliedstaaten unterliegt und in der die Völker – d.h. die Staatsangehörigen Bürger – der Mitgliedstaaten die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben. (BVerfGE 123, 267 (348) – Lissabon)
Als wichtigste Akteure gelten die Mitgliedstaaten, die ihre Präferenzen aufgrund ihrer nationalen Interessen bilden und in den intergouvernementalen Prozess einbringen. Der Integrationsprozess wird solange aufrechterhalten, wie das europäische Regieren effizienter ist als auf nationaler Ebene. Ein wesentliches Ziel der Integration ist demnach Effizienz.
Zu den Grundannahmen der Theorie zählt, dass Staaten als rationale Entitäten handeln, dass sie ihre nationalen Präferenzen innerstaatlich bilden und diese im intergouvernementalen Prozess aushandeln; supranationale Organen können in diesem Verständnis nicht wesentlich auf den Integrationsverlauf Einfluss nehmen (Craig 2011: 17).
Aufgrund der strikten Trennung der Ebenen spricht Andrew Morvacsik vom two-level-game (Moravcsik 1993: 514-517): In dieser Argumentation erfolgt die Verlagerung von nationaler Souveränität auf europäische Ebene aus dem Kalkül, dass sich die Staats‑ und Regierungschefs gegenüber der Opposition im Heimatstaat unabhängig machen. Zusammenarbeit erfolgt entweder durch die Zusammenlegung von Souveränitätsrechten auf europäischer Ebene (pooling) oder die tatsächliche Abgabe an die europäischen Institutionen (delegation). Beide Souveränitätsabgaben bergen nach intergouvernementaler Logik Risiken und Chancen (Moravcsik 1993: 507-514).
Durch delegation wird Entscheidungsfindung effizienter. Im europäischen System wurden bereits in der Montanunion Aufgaben an die Hohe Behörde (später: Europäische Kommission) delegiert. Das Risiko besteht jedoch darin, dass Entscheidungen entgegen individueller nationaler Interessen in Kauf genommen werden müssen. Demgegenüber bleiben die Mitgliedstaaten in Person ihrer Minister an solchen Entscheidungsprozessen stärker beteiligt, bei denen die Kompetenzen lediglich zusammengelegt wurden. Auch hier sind im Einzelfall Beschlüsse gegen die Positionen einzelner Staaten möglich (Beispiel: Mehrheitsentscheidungen im Rat), doch die Entscheidungen sind in der Praxis sehr stark am Konsensprinzip ausgerichtet und ermöglichen den Mitgliedstaaten deutlich mehr Einflussnahme (mehr dazu: Craig 2011: 18-19).
In dieser Lesart liegt die Kooperation bei der Binnengrenzpolitik im Interesse der Mitgliedstaaten. Das dahinter liegende Motiv ist die Verwirklichung der Grundfreiheiten des Marktes. Durch die Aufhebung der Binnengrenzkontrollen wird der gemeinsame Markt effizienter, was für alle Beteiligten einen Gewinn darstellen dürfte. Die dadurch implizierte Vergemeinschaftung der Außengrenzen ist solange im Interesse aller, wie die Grenzsicherung durch die jeweiligen Außengrenzstaaten effizient abgesichert ist. Kommt es jedoch zu erheblichen Defiziten und damit zu Rückwirkungen auf den europäischen Raum insgesamt, stellt sich die Vergemeinschaftung der Außengrenzen als Risiko dar.
Die Grenz‑ und Asylpolitik ist sehr stark von pooling gekennzeichnet. Der Lissabonner Vertrag ermöglichte die geteilte Komptenz in Grenz‑ und Asylangelegenheiten. An Gesetzgebungsprozessen sind die Mitgliedstaaten stark beteiligt und letztlich bleiben die Mitgliedstaaten für die Grenz‑ und Asylpolitik selbst verantwortlich, was nicht zuletzt an den Defiziten der Rechtsharmonisierung sichtbar ist. Delegation ist in sehr begrenztem Maße bei der Auslagerung von Grenzschutzaktivitäten an die Agentur Frontex und das Monitoring zu Asylanfragen in der Agentur für Aslyfragen zu beobachten.
Aus welchen nationalen Präferenzen lässt sich hingegen die schrittweise Vergemeinschaftung erklären? Die teilweise Vergemeinschaftung der Grenz‑ und Asylpolitik bedeutet innenpolitisch die Möglichkeit, unangenehme Politikentscheidungen der Grenz‑ und Asylpolitik nach Brüssel schieben zu können. In dieser Lesart wird das two-level-game als bewusstes blame-shifting analysiert. Demnach engagierten sich die Justiz‑ und Innenminister für eine teilweise Verlagerung ihrer Ressorts auf die europäische Ebene, um unliebsame Entscheidungen und die negativen Reaktionen darauf ebenfalls auf die europäische Ebene zu verschieben (so argumentiert: Guiraudon 2000, ähnlich: Parkes 2010, anders: Kaunert und Léonard 2012, Ripoll Servent und Trauner 2014, Trauner und Ripoll Servent 2016). Doch ist diese Erklärung hinreichend? Immerhin beinhaltet die Verlagerung auf europäische Ebene das erhebliche Risiko, politische Entscheidungen umsetzen zu müssen, die den nationalen Interessen widersprechen.
Im Liberalen Intergouvernementalismus ist dieser stufenweise Prozess der Effizienz europäischer Entscheidungen geschuldet und der Möglichkeit nationaler Regierungen, durch gemeinsame Politik auf europäischer Ebene gegenüber nationalen politischen Akteuren mehr Spielraum zu erlangen bzw. politische Verantwortung in unliebsamen Fragen zu delegieren.
2.3 Zusammenfassung und Literatur
Das Wichtigste in Kürze: Historische Grundlagen
Kernmotiv der europäischen Integration war der gemeinsame Markt. Als Kernprinzipien dieses Gemeinsamen Marktes fungierten die vier Grundfreiheiten (Warenverkehr, Personen, Dienstleistungen, Kapital). Wenn Waren, Personen und Dienstleistungen an der Grenze nicht halt machen sollen, dann brauchte es über kurz oder lang eine Überwindung der physischen Grenzen, die bisher an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten die Ein‑ und Ausreise von Personen und Waren kontrollierten. Eine solche Abschaffung der Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten führte dazu, dass die Außengrenzen einzelner Mitgliedstaaten zu Außengrenzen aller Mitgliedstaaten des Wirtschaftsraums wurden. Daraus erwuchs eine funktionale wie politische Notwendigkeit zur Übereinkunft über Krtierien bei Grenzschutz, Einreise- und Asylgewährung.
Die Grenz‑ und Asylpolitik wuchs aus diesen Wirkungszusammenhängen im Zuge der Schengener Kooperation in den Rechtskorpus der Europäischen Union hinein. Mit dem Ziel der Personenfreizügigeit im Gemeinsamen Markt gab es bereits seit den Gründungsverträgen von (1958) ein Vertragsziel, das die Abschaffung der Grenzkontrollen an den Grenzen der teilnehmenden Staaten anvisierte. Doch erst mit der Unterzeichnung des Schengener Abkommens im Juni 1985 wurde dieses Ziel Wirklichkeit. Zunächst schafften Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten die Kontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen 1995 ab. Dadurch entwickelte sich ein gemeinsamer Raum ohne Binnengrenzen mit gemeinsamen Außengrenzen, weshalb Absprachen zum Umgang mit Einreise, Kurzaufenthalten und Asylfragen notwendig wurden. So entstanden Folgeabkommen, wozu das Dubliner Übereinkommen von 1990 zählte, das die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Asylanträge regelte und dessen Kriterien im Kern bis heute fortgeführt werden.
Der Vertrag von Maastricht (1993) überführte erste innen‑ und justizpolitische Bereiche in das Gemeinschaftsrecht und definierte Asylpolitik als gemeinsames Interesse. Mit dem Vertrag von Amsterdam (1999) wurden zum ersten Mal konkrete Mandate zur Rechtsetzung in der europäischen Innen- und Justizpolitik formuliert. Der Vertrag von Lissabon (2009) bestätigte dieses Mandat durch eine Ausweitung der Aufträge zur Rechtsetzung durch die europäischen Organe in den Bereichen Grenze, Asyl und Einwanderung.
Literatur zum Weiterlesen:
Zur europäischen Integrationsgeschichte:
DINAN, DESMOND. 2014. Europe Recast: A History of European Union (Basingstoke: Palgrave Macmillan:).
EPPLER, ANNEGRET und HENRIK SCHELLER. 2013. Zur Konzeptionalisierung europäischer Desintegration: Zug- und Gegenkräfte im europäischen Integrationsprozess (Baden-Baden: Nomos).
SCHORKOPF, FRANK. 2015. Der Europäische Weg. Grundlagen der Europäischen Union, 2. Auflage (Tübingen: Mohr Siebeck:).
VAN MIDDELAAR, LUUK. 2016. Vom Kontinent zur Union: Gegenwart und Geschichte des vereinten Europa (Berlin: Suhrkamp).
WEIDENFELD, WERNER. 2013. Die Europäische Union: Akteure, Prozesse, Herausforderungen (München: Fink).
Zur Einführung in Theorien europäischer Integration:
BIELING, HANS-JÜRGEN und MARIKA LERCH (Hrsg.). 2012. Theorien der europäischen Integration (Wiesbaden: Springer VS).
GRIMMEL, ANDREAS und CORD JAKOBEIT. 2009. Politische Theorien der Europäischen Integration: Ein Text- und Lehrbuch (Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften).
LEUFFEN, DIRK, BERTHOLD RITTBERGER und FRANK SCHIMMELFENNIG (2012). Differentiated Integration. Explaining Variation in the European Union (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
ROSAMOND, BEN. 2000. Theories of European integration (Basingstoke: Macmillan).
Zur Einführung in europäische Politikprozesse:
BUONANNO, LAURIE und NEILL NUGENT. 2013. Policies and Policy Processes of the European Union (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
CINI, MICHELLE und NIEVES PÉREZ-SOLÓRZANO BORRAGÁN (HRSG.). 2019. European Union Politics, 6. Auflage (Oxford: Oxford University Press).
CRAIG, PAUL und GRÁINNE DE BÚRCA (HRSG.). 2011. The Evolution of EU Law (Oxford: Oxford University Press).
HIX, SIMON und BJØRN HØYLAND (HRSG.). 2011. The Political System of the European Union, 3. Auflage (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
WALLACE, HELEN, MARK A. POLLACK und ALASDAIR YOUNG (HRSG.) 2014. Policy-Making in the European Union, 7. Auflage (Oxford: Oxford University Press).
Schengenraum – Geschichte und Politik:
BOSSONG, RAPHAEL und TOBIAS ETZOLD. 2018. Die Zukunft von Schengen, SWP Aktuell 53 (Stiftung für Wissenschaft und Politik), S. 1-8.
PEERS, STEVE. 2013. The Future of the Schengen System (Stockholm: Sieps).
ZAIOTTI, RUBEN. 2011. Cultures of Border Control: Schengen and the Evolution of Europe’s Frontiers (Chicago: University of Chicago Press).
Fachzeitschriften mit aktuellen Publikationen zum Thema:
European Constitutional Law Review, European Journal of Political Research, European Law Journal, European Societies, integration, Journal of Common Market Studies, Journal of Contemporary European Research, Journal of European Integration, Journal of European Integration History, Journal of European Public Policy, West European Politics
3 Grenzpolitik der Europäischen Union
Eine Grenzpolitik der Europäischen Union gibt es streng genommen nicht, weil die Europäische Union nicht über die ausschließliche Zuständigkeit in der Grenzpolitik verfügt. Die GrenzpolitikGrenzpolitik zählt zur Innenpolitik eines Landes. Auf europäischer Ebene wird dieser Politikbereich mit der Umschreibung Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bezeichnet. Im Vertrag von LissabonVertrag von Lissabon (2009) wird der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts als ein politischer Hauptbereich bezeichnet, in dem sich die Europäische Union die Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten teilt (Art. 4 Abs. 2 lit. j. AEUV).
Bei geteilter Zuständigkeit agieren die europäischen Institutionen nur insoweit es die Vertragsziele vorgeben bzw. politische Ziele im Politikbereich nur durch europäische Standards verwirklicht werden können. Hier greift das SubsidiaritätsprinzipSubsidiarität:
„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“ (Art. 5 Abs. 3 EUV)
Die genauen Ziele zur Erreichung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des RechtsRaum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts werden im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Art. 67 genannt:
(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und ‑traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden.
(2) Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, und entwickelt eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Kontrollen an den Außengrenzen, die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten gründet und gegenüber Drittstaatsangehörigen angemessen ist. […]
(3) Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koordinierung und Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den anderen zuständigen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
(4) Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen.
Diese detailgenaue Legitimierung zur Rechtsetzung wird als Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung bezeichnet. Demnach wird die Europäische Union bzw. die in ihrem Namen wirkenden europäischen Institutionen für jede Tätigkeit spezifisch legitimiert (Art. 4 Abs. 1 EUV). Ausdrücklich ist im Vertrag festgehalten, dass die europäischen Institutionen bzw. die Europäische Union die Identität der Mitgliedstaaten, ihre verfassungsrechtliche Organisation und grundlegenden politischen Strukturen achtet, wozu auch die nationale und regionale Selbstverwaltung zählt (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV). Die nationale Grenzpolitik betrifft die Integrität der Mitgliedstaaten und ist ein besonders sensibler Bereich für die nationale SicherheitNationale Sicherheit, die weiterhin ausdrücklich in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt:
„Sie [Anm.: die Union] achtet die grundlegenden Funktionen des Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit. Insbesondere die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten.“ (Art. 4 Abs. 2 Satz 2-3 EUV)
Die nationale Sicherheit stellt ein hohes Gut für jeden Staat dar und zählt zu den Grundpfeilern der staatlichen Aufgaben. Gerade auch im Verhältnis zu den BürgerInnen ist die nationale Sicherheit eine der wichtigsten staatlichen Aufgaben. Entsprechend wird diesem Gut hohe politische Priorität eingeräumt. Auch wenn die Binnengrenzkontrollen aufgehoben werden, so können Gründe der nationalen Sicherheit für die vorübergehende Wiedereinführung von GrenzkontrollenGrenzkontrollen führen. Diese kann die Europäische Union (in dem Fall: die Kommission) den Mitgliedstaaten nicht verwehren. Tatsächlich erfordert das Schengenrecht, dass die Mitgliedstaaten die Personenfreizügigkeit so hochachten, dass sie für die außerordentliche Wiedereinführung von Grenzkontrollen Anträge stellen müssen. Dies kann die Kommission den Mitgliedstaaten jedoch nicht verwehren.
So erklärt sich auch, weshalb der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des RechtsRaum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts unter den Vorbehalt gestellt wird, dass Maßnahmen greifen, die die grenzberührenden Themenfelder Kriminalität, Einwanderung und Asyl betreffen:
„Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist.“ (Art. 3 Abs. 2 EUV)
Auffallend ist die Formulierung, dass die Union ihren Bürgern diesen Raum „bietet“. Er muss also nicht geschaffen werden, sondern ist bereits Realität. Dennoch werden im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union Mandate für diesen Politikbereich formuliert. Tatsächlich betreffen diese Mandate zur Rechtsetzung vor allem die Bereiche Asyl, Einwanderung und Kontrolle an den Außengrenzen. Diese Regelungen zielen alle darauf ab, den nach innen geschaffenen Raum nach außen hin zu kontrollieren bzw. abzusichern. Demnach besteht der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des RechtsRaum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts überweigend aus Maßnahmen, die diese Freiheit, Sicherheit und Rechte gegenüber Dritten absichern.
Die Freiheit dieses Raums verweist einerseits auf freiheitliche Grundprinzipien einer demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung. In konkretem Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verweist der Begriff auf die Personenfreizügigkeit, die eine wesentliche Errungenschaft des Raums ohne Binnengrenzen darstellt.
Das Recht im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts schafft positive Rechte für die Bürger der Union: Zum einen werden grundsätzlich die Rechtsordnungen und Grundrechte innerhalb der Verfassungen der Mitgliedstaaten geachtet. Konkret soll durch den gemeinsamen Raum der Zugang zum Recht für die Bürger vereinfacht werden, was durch den Grundsatz der grenzüberschreitenden gegenseitigen Anerkennung von Rechtsprechung im Zivilrecht realisiert werden soll.
Bezüglich der SicherheitNationale Sicherheit sieht der Vertrag zum anderen vor, dass die Mitgliedstaaten ohne den Umweg über die europäischen Institutionen oder Unionsrecht direkt miteinander kooperieren. Dazu können sich die zuständigen Dienststellen und Verwaltungen der Mitgliedstaaten „Formen der Zusammenarbeit und Koordinierung“ einrichten, „die sie für geeignet halten“ (Art. 73 AEUV).
In Bezug auf die GrenzpolitikGrenzpolitik entwickelt die Union eine Politik, mit der
a) sichergestellt werden soll, dass Personen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit beim Überschreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden;
b) die Personenkontrolle und die wirksame Überwachung des Grenzübertritts an den Außengrenzen sichergestellt werden soll;
c) schrittweise ein integriertes Grenzschutzsystem an den Außengrenzen eingeführt werden soll.
(Art. 77 Abs. 1 AEUV)
Diesem Politikauftrag wird in diesem Kapitel nachgegangen, indem folgende Fragen besprochen werden: Welche der genannten Ziele hat die Europäische Union bereits erreicht? Wie sieht die Grenzpolitik in der Theorie – im Recht – und in den Mitgliedstaaten – in der Praxis – aus? Auf welchem Stand ist das europäische Grenzschutzsystem? Wie arbeitet es und welche Kritik gibt es daran?
Zunächst nähern wir uns diesen Fragen, indem wir die Lage an der Grenze betrachten (Kapitel 3.1). Wir wollen wissen, welche Bewegungen in den vergangenenen Jahren an den Außengrenzen der Europäischen Union beobachtbar waren und welche Bedeutung diese für den Schengenraum haben (3.1.1). Daraufhin ordnen wir ein, wie sich das Schengensystem und das europäische Grenzschutzsystem in Tandem entwickeln (3.1.2). Dann betrachten wir die geltenden Einreisebestimmungen für Kurz‑ und Langzeitaufenthalte in der Europäischen Union (3.1.3). Die bestehenden Bestimmungen und die Realität an der Grenze vergleichen wir mit den strategischen Zielen für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, die die Staats‑ und Regierungschefs seit 1999 in regelmäßigen Abständen verfasst haben (3.1.4).
Im Folgenden gehen wir genauer auf die Kompetenzen der Europäischen Union ein (Kapitel 3.2) und halten fest, über welches Mandat die Europäische Union für eine gemeinsame Grenzpolitik verfügt (3.2.1) und welche Rechtsinstrumente bisher zum Aufbau eines europäischen Grenzschutzmanagements genutzt wurden (3.2.2).
In Kapitel 3.3 greifen wir diese Bestimmungen auf und setzen uns mit den gemeinsamen Verfahren zu Einreisekontrollen auseinander, die die Europäische Union mit dem Schengener Grenzkodex geschaffen hat (3.3.1). Auch die gemeinsame Visapolitik rückt in den Fokus als Kontrollinstrument (3.3.2). Daraufhin wird behandelt, welche Einreisemöglichkeiten Asylsuchende unter diesen Bedingungen haben (3.3.4).
Kapitel 3.4. konzentriert sich dann auf die Geschehnisse an der Grenze selbst und die Umsetzung der Grenzpolitik in den Mitgliedstaaten: Wie stellt sich die Lage an den Außengrenzen dar? (3.4.1) Wie sieht Grenzschutz in der Praxis an den Außengrenzen aus, welche Akteure sind daran beteiligt? (3.4.2) Und kann man die Binnengrenzen des Schengenraums tatsächlich ohne Kontrollen passieren? (3.4.3)
Schließlich beschäftigen wir uns mit Konflikten der europäischen Grenzpolitik, besonders in Zusammenhang mit der Asylzuwanderung über das Mittelmeer (3.5). Wir diskutieren die geographischen Asymmetrien des gültigen europäischen Grenzschutzsystems, analysieren den fortwährenden politischen Streit um die europäische Grenzpolitik und halten fest, welche Entwicklung sich andeutet.
3.1 Grenzen der Europäischen Union – Auflösung der Binnengrenzen
Rechnet man die See‑ und Landaußengrenzen der Europäischen Union in Kilometern zusammen, so summieren sich etwa 14.000 km. Die üblichen Einreisepunkte sind internationale Flug‑ und Seehäfen sowie offizielle Grenzübertrittspunkte. Darüber hinaus erfolgen irreguläre Einreisen seit Beginn der 2000er Jahre vor allem an den Land‑ und Seegrenzen der Mitgliedstaaten Griechenland, Italien, Malta und Spanien. Während der Asylzuwanderung von 2015 sind hunderttausende Menschen von der Türkei nach Griechenland und anschließend über die sogenannte Balkanroute Richtung Österreich, Deutschland und Schweden gewandert.1
Die Begrifflichkeiten rund um GrenzenGrenzen und Migration sind mitunter unscharf. In Bezug auf Grenzschutz wird oft synonym von Grenzmanagement und Grenzkontrollen gesprochen. Gerade bei den Begriffen Grenzmanagement und Grenzkontrollen sind jedoch deutliche Unterschiede festzumachen (so Zaiotti 2017: 107): Während sich Kontrollen spezifisch auf Aktivitäten zur Überprüfung an der Grenze beziehen (bspw. die Überprüfung einer Identität oder eines Transports), so handelt es sich beim Management umfassender um Aktivitäten an der Grenze, die darauf abzielen ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen – bspw. die Zahl irregulärer Ankünfte zu reduzieren). Grenzmanagement ist also deutlicher an Politikgestaltungsprozesse geknüpft als konkrete Kontrollen. Diese sind ein Teil des Grenzmanagements, weshalb die Begriffe beide Bestandteile des Grenzschutzes sind, jedoch nicht synonym verwendet werden sollten.
In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Auflösung der Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch die Kooperation im wachsenden Schengenraum (3.1.1). Danach blicken wir auf die strategischen Ziele für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, den die Mitgliedstaaten seit dem Vertrag von Amsterdam (1999) sukzessive aufbauten (3.1.2).
3.1.1 Von Schengen-5 zu Schengen-26
Welche Ziele wurden mit dem Schengenraum verbunden?
Die politischen Vordenker auf deutscher und französischer Seite erhofften sich vom SchengenraumSchengenraum die Schaffung eines europäischen Raumes, in dem man sich ohne Grenzkontrollen frei bewegen kann, was den Austausch zwischen Menschen, aber auch den Handel erleichtert und damit ein grundlegendes Fundament des gemeinsamen Marktes realisiert.
Wann sind welche Mitgliedstaaten dem Schengen-Raum beigetreten?
Als Gründerstaaten gelten Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Italien. Es folgten in der Reihenfolge der Erweiterungen der Wirtschaftsgemeinschaft Portugal, Spanien, Griechenland, Österreich bis Mitte der 1990er Jahre. Im Jahr 1996 wurde der Schengenraum um Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden erweitert. Danach wuchs im Zuge der großen EU-Erweiterung von 2004 auch der Schengenraum um Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern. Bulgarien und Rumänien folgten 2007, ein Jahr später Liechtenstein und Kroatien im Jahr 2013.