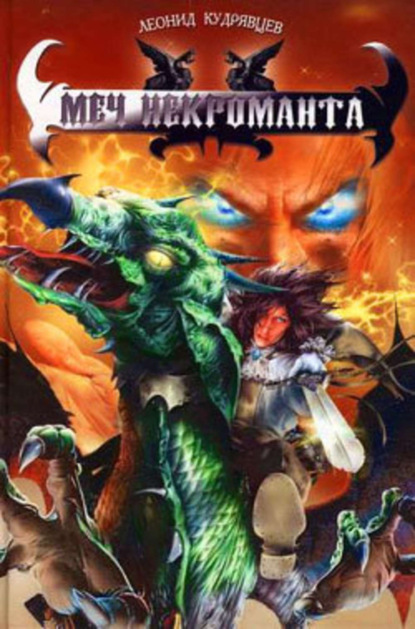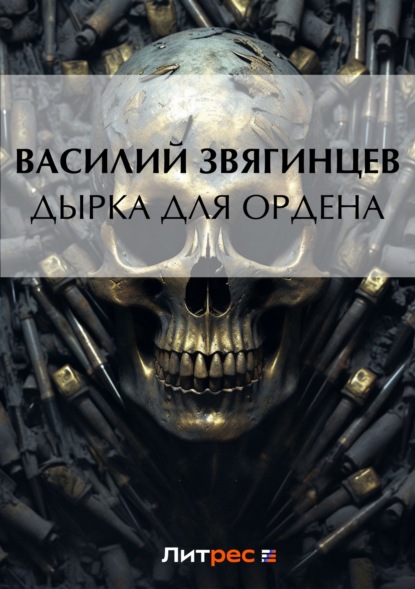- -
- 100%
- +
Dezente Zurückhaltung überlässt der ausflügelnde Berliner anderen. Er ist inzwischen im Lokal angekommen und verlangt Bedienung. Die steht ihm zu, aber zack-zack. Ungläubig und widerwillig muss dieser Vertreter der Ausflugssorte Mensch zur Kenntnis nehmen, dass nicht allein er und die Seinen auf die singulär außergewöhnliche Idee einer Ausfahrt kamen; viele, viele andere sind ausgeflogen, manche sogar schon vor ihm. Bekommt er jetzt vielleicht nicht sofort einen Platz und alles, worauf er ein Anrecht hat? Skandal! Verrat! Ja, auch – vor allem aber Frechheit, jawohl: »’ne Frechheit is dett!«
Mürrisch und kurz vor maulen steht der ausflugszielfixierte Berliner im Lokal und hühnert mit den Füßen. Beinahe schon hat er ein abschließend wegwerfendes »Also hier kannste ja ooch jarnisch mehr hinjehn!« auf den Lippen, als er doch noch einen freien Tisch erspäht. Allerdings steht dieser recht entlegen halb um die Ecke, und die Rückenlehnen der Stühle sind gegen die Tischkanten gekippt. Über diese kleinen Zeichen sieht und geht der Ausflügler großzügig hinweg, eilt mitsamt seinem Tross hinzu, rückt und ruckelt sich das Gestühl allseits gut vernehmlich zurecht, macht es sich bequem und schaut mit erwartungsvoll gerundetem Karpfenmund zu Kellnerin und Kellner.
Die allerdings haben gut zu tun, und ihre Wegschneisen liegen abseits des Tisches, an dem Familie Sitzsack Platz genommen hat. Die Stimmung am Tisch verdüstert sich; wie kann das sein? Wir sind schon zwei Minuten hier, und das Essen steht noch nicht auf dem Tisch? Es wird nach Bedienung gewinkt, gerufen, mit den Fingern geschnipst und sogar gepfiffen; auch diese groben Regelverstöße bleiben folgenlos, in jeder Hinsicht. Nun macht der Ausflugsfamilienvorstand die Angelegenheit zur Chefsache, steht auf, strafft sich, sandalettet in einen weniger dezentral gelegenen Bereich des Gartenlokals hinüber und stellt sich entschlossen und mutig einer Kellnerin in den Weg. Die, ein volles Tablett in den Händen, erklärt ihm dennoch geduldig, dass an jenem Tisch leider nicht bedient werde, weswegen sie ja auch die Stühle gegen den Tisch gelehnt habe.
Das Gesicht des Ausflüglers wird zur Bühne, auf der ein faszinierendes Schauspiel sich ereignet: Zehntelsekunde für Zehntelsekunde kann man dabei zusehen, wie lange es dauert, bis der Groschen fällt. Als er durchgerutscht ist, klappt dem Ausflügler der Mund auf. In wortloser Wut starrt er die Kellnerin an, dreht sich um und macht seinem Klüngel ein Handzeichen, aufzustehen. Geräuschvoll rauscht die Truppe ab. Im Gesicht des Chefausflüglers arbeitet es weiter. Er dreht sich noch einmal um, schwillt zu voller Bedeutung an und entlässt den Inhalt seines Triumphatorenkopfes in den Tag: »So kann ditt ja nüscht wern im Osten!« – Nein, da muss erst einer wie er kommen, bis alles so schön ist wie überall.
Was ist der Unterschied zwischen Terroristen und Touristen? Terroristen haben Sympathisanten.
Aus der Mückengaststätte
Von der Perspektive einer Mücke aus betrachtet ist der Mensch eine Mischung aus Tankstelle und Gastwirtschaft. Für einen Einzelmück oder eine Solo-Mücke ist ein menschliches Wesen ein Schnellimbiss, an dem der kleine Blutdurst zwischendurch mal eben rasch im Vorbeifliegen gestillt werden kann. Einem Mückenschwarm dagegen gilt der Homo sapiens als eine Art Großraumkantine, an deren Tischen alle Platz finden. Zwar gibt es weder ein Menü noch kann man à la carte bestellen – ausgeschenkt wird Einheitskost –, aber satt immerhin werden hier alle.
»Stammessen Eins!« sirrt routiniert das Personal, ein rot gesprenkeltes, schon etwas angeschmuddeltes Tuch um die gerundeten Küchenbullenhüften geschlungen. Die Mitglieder der hungrigen Mückenmeute binden sich erwartungsfroh die Servietten vor, klopfen mit den vorfreudig gehärteten Saugrüsseln in rhythmischem Stakkato auf die Tische und verlangen im Chor: »Bsss! Bsss! Blutsuppe à la nature! Bsss! Bsss!«
Der ohne sein Einverständnis zur Speisegaststätte umfunktionierte Mensch aber will der Mücke nicht als Freibank dienen. Fluchend schlägt er um sich und versucht, die auf seinen Gliedmaßen oder in seinem Gesichte sitzenden Vampire zu verjagen oder sie mit der flachen Hand am eigenen Leib oder auf der eigenen Wange zu zerquetschen.
Die andere Wange hinhalten? Nein, das kommt im Fall des Mückenbefalls auch für Christen längst nicht mehr in Frage, hier wird mit der Eigenohrfeige schnell und unerbittlich Selbstjustiz geübt. Die übrigen Delinquenten werden im Eilverfahren dem Insektenbeauftragten, Kardinal flache Hand, überstellt, und der macht kurzen Prozess, urteilt die lästigen Säuglinge ab und weihräuchert sie aus, bevor er saftig klatschend zulangt.
Doch der Mücken sind viele; die Hoffnung des Menschen, ein langer und frostiger, beißend kalter Winter hätte die stechenden Insekten schon im Larvenstadium vernichtet oder doch entscheidend dezimiert, war trügerisch und erfüllte sich nicht. Zerstochen und zerschunden, sich überall die scheußlich juckenden Mückenstiche kratzend, muss der Mensch einsehen, dass der kommode Platz am Ende der Nahrungskette ihm nicht automatisch und selbstverständlich, nicht unbedingt und unangefochten gehört. Selbst sichtlich passiver Teil des Ernährungskreislaufs geworden, muss er kleinlaut einräumen: Wer nichts wird, wird Zwischenwirt.
Der gesättigte Mückenschwarm erhebt sich; einige wenige Angehörige der Großgruppe haben mit ihrem Leben bezahlt, der Rest prellt frech die Zeche und surrt davon, die nächste Raststätte schon im Blick: Ein Trupp älterer Ausflügler rentnert am Seeufer herum; viele von ihnen stützen sich mit einer Hand auf einen Stock oder halten sich mit beiden Händen an einem Rollwägelchen fest. Drei erfahrene Mücken, die als Vorhut und Späher unterwegs sind, reiben sich die Flügel, machen kehrt, fliegen zu den anderen retour und können frohgemut vermelden: »Leichte Beute voraus!«
Grausam und unerbittlich ist die Natur. Die Kleinen fressen die Großen – zumindest dann, wenn die Großen nur noch mit Kölnisch Wasser bewaffnet sind. So erlitt eine Seniorengruppe in Rheinsberg noch einmal das Schicksal von Flucht und Vertreibung.
Denn mit Rollator und Krücke
Erschlägst du keine Mücke.
Anmerkungen über die Übergangsjacken
Bösartig lang und düster ist der deutsche Winter. In dicke, nasse oder angefrorene Mäntel gehüllt, strickbemützt und in Schals gewickelt, stehen Menschenklumpen wie Falschgeld in der Welt; triefnasig, rotäugig und vergrippt starren sie aus der grauen Wäsche. Was sie verströmen, ist das, was sie fürchten und mit dem sie zugleich liebäugeln: Untergang.
Doch pünktlich zum Termin kommt der Frühling und streichelt mit zarten Sonnenstrahlenfingern vorsichtig die verwinterten Gesichter und Gemüter. Das Signal wird gleich richtig verstanden: Ihre Behausungen, in denen die Menschen eben noch in Agonie ausharrten, schmücken sie nun und tauchen sie in Meere von Blumen. Das Leben fügt sich wieder, es reimt sich Luft auf Duft, allenthalben wird froh und albern gedichtet und mit den Vögeln geträllert:
Im Frühling walten Gefühle,
die treiben mich aus dem Haus.
Denn die Wirte stellen die Stühle
und die Frauen die Beine heraus.
Nach draußen, ans Licht, zieht es den Menschen. Nur – was zieht er an beziehungsweise über? Den Winterkram kann und will er nicht mehr sehen, der ist ihm oll geworden und eine Last. Am liebsten spränge er gleich im leichten Sommerzeug umher, so luftig ist’s ihm in der Seele, aber das wäre nicht klug, zu leicht ist eine Erkältung eingefangen, und die würfe ihn um Tage, ja Wochen zurück. So greift der Mensch zum Übergangsmantel, oder, kühner noch, zur Übergangsjacke.
Vom Untergang zum Übergang – wenn das kein Fortschritt ist! Doch was genau ist eine Übergangsjacke? Was hat man sich darunter vorzustellen? Etwa Bruno Ganz, die alte Untergangszwangsjacke, eingekleidet von Jack Wolfskinhead? Zicke-zacke, Übergangsjacke? Und um was für einen Übergang handelt es sich überhaupt? Was geht von wo nach wohin über? Der Winter zum Frühling, oder gleich, in einer Art klimatischer Gleitzeit, zum Sommer? In jene Jahreszeit also, in der speziell der junge Mensch möglichst unbekleidet durch den öffentlichen Raum eiert? Und dabei aber immer eine Trinkflasche in der Hand festhält, um der Welt zu demonstrieren, dass er, obschon kaum volljährig, doch eigenständig und ambulant Flüssigkeit in sich aufzunehmen und zu versenken versteht, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um Bier, Bier oder Bier handelt? Ist es der Übergang vom Leben zum Tod – und die Übergangsjacke also ein letztes Hemd? Nein, dazu ist die Übergangsjacke zu bunt und hat auch zu viele Taschen.
Scheußlich und den Menschen schändend ist alles, was nach Freizeitkleidung aussieht; auch jede Anmutung von Funktionskleidung ist unbedingt zu vermeiden. Wer zu klassischen Geriatriefarben wie beige, grau, schlàmme oder grünlich greift, darf sich über Stigmatisierung und Ausgrenzung nicht wundern. Auf Grellheit allerdings möge gleichfalls verzichtet werden. Das Auge sieht mit und will nicht farbenblind werden. Der Mensch ist kein Buntstift und soll sich als solcher nicht aufführen.
Das Schönste an der Übergangsjacke ist der Tag, an dem die Übergangsjackenzeit dann auch schon wieder vorbei ist. Bis dahin gilt die Regel: Der Deutsche ist vernarrt in den Untergang, trägt dabei aber, zumindest zeitweise, Übergangsjacke.
Doch über den Übergangsjacken
Prangt – ohne oder mit Zopf –
Dabei modisch gleichsam altbacken
Dieses Ding namens Übergangskopf.
Pilgerstrom
Eine Besonderheit der deutschen Sprache ist das Kompositum, das aus zwei oder mehr Wörtern zusammengefügte Wort. Dabei entstehen schnell Ungetüme wie »Sicherheitsarchitektur«, »Zeitschiene«, »Gerechtigkeitslücke« oder »Rettungsschirm«.
Ein ganz besonderes Kompositum beschert uns turnusmäßig die massenhafte Versammlung organisierter Gläubischer aller Art; sie bietet Anlass, von einem »regelrechten Pilgerstrom« zu sprechen. Das Wort löst bei mir uneingeschränktes Wohlgefallen aus: Pilgerstrom. Das klingt nach einem neuen Stromanbieter, dessen Dienste man unbedingt nutzen sollte.
Pilgerstrom, die religiöse Energiequelle, ist eine Alternative zu Stromerzeugern, wie man sie bisher kannte. Pilgerstrom kann schmutzige Braunkohlekraftwerke genauso überflüssig machen wie radioaktiv gefährlichen Atomstrom, und selbst die hässlichen Windenergieräder, auch Storchenschredder genannt, braucht man nicht mehr. Kriege um Öl müssen nicht länger geführt werden, und einen verheerenden Ölteppich wie jenen, der entstand, als Karl-Theodor zu Guttenberg und Kai Diekmann einander im Golf von Mexiko die Haare wuschen, wird es nie wieder geben.
Denn die jederzeit erneuerbare Energie heißt: Pilgerstrom. Mehr als 2000 Jahre lang lag diese Kraftquelle brach und blieb ungenutzt. Ungeheuer sind die Ressourcen an krimineller Energie, die von unbeirrbaren Glaubetrottern ausgeht. Man muss diese Kraft und Herrlichkeit nur technisch umwandeln – auch religiöse Reibung erzeugt Wärme!
In Ministrantenkreisen ist Kirche von hinten seit Jahrhunderten ein stehender Begriff; mit dieser von Generation zu Generation energisch weitergegebenen Methode und Praxis sollen aber doch besser Generatoren betrieben werden! Man muss nur das Gesetz »Kirche erst ab 18!« erlassen, und schlagartig wird unglaublich viel Energie freigesetzt – die sofort und weltweit in die Wiederabschaffung der erblindungsfördernden und entwürdigenden Energiesparfunzeln investiert werden kann.
Sind das nicht Gründe genug für einen Wechsel des Stromanbieters? Ich finde schon – und steige ausnahmsweise um auf ein Kompositum: Pilgerstrom, direkt aus der Steckdose.
Krise in der Loderhose
Das Wort »Krise« hat sich zu einem Passepartout entwickelt, zu einer Gemeinschaft stiftenden Abnickvokabel. Es muss nur einer »Krise« sagen, sofort erzeugt er flächendeckend Affirmation: Krise, ja, genau. Krise ist die Konsensmilch der lammfrommen Denkungsart.
Das Wort ist unspezifisch und wattig und genau deshalb universell einsetzbar. Wer »Krise« sagt, muss nicht konkret werden, egal, ob er mit der Krise droht oder ob er suggeriert, er nähme alle mit ins Krisenrettungsboot. So leicht ist ein Kollektivgefühl zu erzeugen: Die Weltwirtschaft in der Krise, also die Welt, also alle, also wir alle. Unterschiede verschwimmen oder verschwinden ganz.
Deshalb ist »Krise« eine Lieblingsvokabel von Demagogen jeder Couleur. Sie ist ein gezielt Angst und Panik schürendes Instrument, und wer Angst hat, lässt sich übergriffige Zumutungen und Kaltschnäuzigkeiten aller Art eben eher gefallen.
Es leitartikelt sich mit Hilfe der Krise aber auch ganz von allein. Fängt man mit Krise an, schreibt sich der Rest wie von selbst weg, gewissermaßen vollautomatisch. Es gibt schließlich Journalisten, die gern etwas geschenkt bekommen, nicht nur Reisen, Gefälligkeiten oder schöne Produkte, sondern vor allem Gedanken. Im letzteren Fall genügt auch die Simulation, es muss nur gut klingen und darf nicht auffallen im eintönigen Konzert des Pluralismus. Auch deshalb ist ›Krise‹ perfekt. Das Wort insinuiert, dass sein Sprecher auf der Höhe der Zeit sei, deren Zeichen er erkannt habe; dass er mit dem gebotenen Ernst bei der Sache und auch emotional nicht unberührt sei – und dass er zu denen gehöre, die nach Lösungen suchen. Auf diese Weise wird aus einer geistabsenten Plaudertasche ein Krisenlenker von Dickdenkerformat.
So geriet die Krise auch in eine der vielen Zeitschriften hinein, die weniger zum Lesen, also zum Anstiften von Gedanken gemacht sind als vielmehr zum bräsigen Herumblättern: fit for fun heißt ein monatlich erscheinendes Druckerzeugnis, dessen Titel so gar nicht krisenorientiert klingt. fit for fun ist die etwas holprige Übersetzung von »Kraft durch Freude«. Schon im Editorial hat das Blatt Sätze zu bieten wie: »Es ist Krise, und viele Dinge werden danach nicht mehr sein wie vorher.« Ob diese Worte in der Welt sind oder nicht, macht nur diesen Unterschied: Sie sind Verschwendung von Ressourcen an Papier und Arbeitskraft bei der Herstellung und an Lebenszeit bei der Lektüre.
Geschrieben hat den Nullsatz der Chefredakteur von fit for fun. Der Mann heißt Willi Loderhose, und man ahnt, was er wegen dieses Nachnamens hat durchmachen müssen seit seiner Pubertät. Möglicherweise haben die erlittenen Verspottungen zu einer Erosion seines Charakters geführt – die es Willi Loderhose erst ermöglichten, Chefredakteur von so etwas wie fit for fun zu werden. Das ist Spekulation; gesichert dagegen ist, dass es Willi Loderhose gelingt, den Einstieg per Krise anschließend zu erweitern und in ihr, nicht minder konfektioniert, »auch Positives zu sehen«. Denn Krise, schreibt Loderhose, »bedeutet auch ›sich trennen‹« – woraus der Autor folgert: »Trennen Sie sich jetzt von schlechten Gewohnheiten! Trennen Sie sich von ein paar Kilos Körpergewicht.«
Auf einem Krisenherd kann eben jeder seine eigene Suppe kochen – auch Willi Loderhose, mitsamt fit for fun. Zwar gilt gemeinhin das Gebot, Namenswitze gütig zu unterlassen. Im Kasus Loderhose bringe ich den Verzicht auf einen Schüttelreim allerdings nicht über mich.
Krise in der Loderhose?
Kann sein, da ist ein Hoden lose.
Vom Niedergang der Sülze
Das Wort Schweinskopfsülze hat unbestreitbar einen heftigen, martialischen Klang. Dabei ist Sülze, wenn sie von einem guten Metzger aus guten Materialien hergestellt wird, ein wohlschmeckendes Lebensmittel. Wie konnte geschehen, dass Sülze seit langem ein Synonym für inhaltsleeres Gerede, für überflüssigen, nichtigen Verbalschwall geworden ist? Soviel Gesülze wird von Menschen mit nimmermüden Mundwerkzeugen produziert, dass bei dem Wort ›Kaisersülze‹ kaum jemand mehr an die so bezeichnete kulinarische Köstlichkeit denkt, sondern, im Gegenteil, an den selbstgefälligen, medial begeistert aufgesogenen wie überhaupt erst hergestellten Brumm- und Bummseich, den der in denselben Medien »Kaiser« genannte Franz Beckenbauer regelmäßig wegplätschert.
Beckenbauer ist allerdings überhaupt nicht der einzige, dem die Mutation der Sülze von einer guten Mahlzeit zum unerträglichen Geseire anzulasten ist. Am Niedergang der Sülze sind viele beteiligt, die öffentlich auf dem Glatteis der freien Rede herumrutschen. Ganz weit vorn sind Politiker und Verlautbarungsjournalisten, die immerzu »auf gutem Wege« sind und für die alles »auf einem guten Weg« ist – der zuvor selbstverständlich »frei gemacht« wurde. Das klingt ein bisschen nach Arztbesuch – »Guten Tag, Herr Weg, machen Sie sich doch bitte gleich frei« –, ist aber noch trüberen Ursprungs. »Wir machen den Weg frei« ist eine alte Reklameparole der Volks- und Raiffeisenbanken, die ihre Kundschaft unter Zuhilfenahme von Bausparverträgen zu fesseln und zu knebeln gedenken. Die Phrase hat ihren Weg in die Politik und in den Journalismus gemacht; man könnte auch zum ixypsilonsten Mal konstatieren, dass Politik und Journalismus sich eben längst in den Niederungen der Werbung eingebunkert haben.
Wer »Wege frei macht« und »auf gutem Wege ist«, der betreibt Politik mit derselben Vollautomatik auch »auf Augenhöhe«. Die »Augenhöhe« wurde nicht nur vom Alfred-E.-Neumann-Double Horst Köhler beständig »angemahnt«, sondern wird auch vom Schauspielerdarsteller Till Schweiger für sich reklamiert: »Mit Tarantino rede ich auf Augenhöhe, mit Brad sowieso…«, prahlte der in Quentin Tarantinos Film »Inglourious Basterds« so wohltuend und überzeugend textarm inszenierte Schweiger, der mit dem angekumpelten »Brad« irrtümlicherweise Brad Pitt meinte, nicht aber das weit bedauernswertere Brett vor seinem eigenen Kopf – das mit Till Schweiger ja tatsächlich »auf Augenhöhe« leben muss, und das schon und für immer.
Voll »auf Augenhöhe« befindet sich auch die Musikzeitschrift spex – und zwar mit dem Nudelhersteller De Cecco, dem sie ihr Impressum als Werbefläche vermietet. spex-Chefredakteur Max Dax weiß, was Feuilleton bedeutet: die branchenübliche Hurerei als Husarenstück verkaufen. Das hört sich so an: »Wir wollen einen Diskurs darüber anregen, wie wahnsinnig hart es ist, Qualität sowie innere und äußere Unabhängigkeit im Journalismus zu garantieren.« Von einem »Diskurs« ist bevorzugt dann die Rede, wenn aus Muffensausen vor dem wirtschaftlichen Bankrott der geistige vorauseilend vollzogen wird. Das Ergebnis des spex-De Cecco-Ex-und-hopp-Diskurses steht so fest wie die Max-Dax-Definition von »innerer und äußerer Unabhängigkeit im Journalismus«:
Ein neues Kunststück kann der Pudel.
Er besingt jetzt auch die Nudel.
Auf diesen Hund hat kein Metzger die Sülze je gebracht. Das schafft die deutsche Medienöffentlichkeit ganz allein.
Dicke Denke an der Raste
»Denke«, »Kenne«, »Schreibe«, »Tanke«, »Raste«: Optimistische Philologen könnten wohl meinen, bei diesen viel gebrauchten Wörtern handele es sich um den von ihnen bevorzugten Umgangston, den Imperativ – oder aber um die jeweils dritte Person Singular Konjunktiv von »denken«, »kennen«, »schreiben«, »tanken« und »rasten«. Die Worte beschrieben also in indirekter Rede, dass jemand denkt, etwas kennt oder schreibt, dass er oder sie tankt oder rastet. Aber erstens gibt es keine optimistischen Philologen, sondern nur zermürbte und kulturpessimistische, und zweitens handelt es sich nicht um Verbformen, sondern um moderne Substantive.
Mangelt es jemandem an einer zündenden Idee, dann hat er einfach nicht »die richtige Denke«. Verfügt er nicht über ausreichend Wissen, fehlt ihm »die nötige Kenne«. Manchem Schriftsteller wird »eine gute Schreibe« attestiert; der Leiter des Göttinger Literaturherbstes, Christoph Reisner, sprach sogar schon von »geilen Briten«, die »einen heißen Reifen schreiben«, weshalb er sie »nach vorne bomben« wolle. Das passt dann schon eher an die »Tanke«, den Treffpunkt von zum Komasuff entschlossenen jungen Menschen, die das Wort »Tankstelle« nicht mehr vollständig auslallen können, sondern es gerade noch zur »Tanke« schaffen, oder, falls sie motorisiert sind, zur »Raste«, der Autobahnraststätte.
Das »Denken«, das »Kennen« und das »Schreiben« sind sächlich abstrakt – in der Umgangssprache werden sie weiblich konkret: die »Denke«, die »Kenne«, die »Schreibe«. Hat, wer schnell laufen kann, analog »eine gute Renne«? Und wer treffsicher schießt, »die richtige Knalle«?
»Tanke« und »Raste« allerdings sind keine Verweiblichungen, sondern Abkürzungen – Ausdrucksformen also, die einerseits die Sprache schneller machen und andererseits die Souveränität des Sprechers unter Beweis stellen sollen. Wer zugunsten einer Initiative Transparente malt und Flugblätter schreibt, der fertigt in seiner eigenen Sprache – beziehungsweise seiner eigenen »Spreche« – »Transpas« und »Flugis« für die »Ini« an. Das klingt niedlich, cool, locker, flockig und fluffig, es scheint die Zugehörigkeit zur richtigen Gruppe zu beweisen – und es suggeriert, da beherrsche einer den Gegenstand, mit dem er es zu tun hat.
Die DDR-Wortschöpfungen »Plaste« und »Elaste« dagegen dienten ursprünglich der gesellschaftlichen Unterscheidung; »Plastik« und »Elastik« waren englischstämmig, kapitalistisch und böse, Plaste und Elaste deutsch, sozialistisch und gut. Wer heute »Plaste« oder gleich »Plaste und Elaste aus Zschkopau« sagt, betont damit entweder seine DDR-Herkunft – oder demonstriert, durch ironischen Gebrauch, dass er zur DDR auf Abstand hielt und immer noch hält, obwohl es sie längst nicht mehr gibt.
Die Bundesrepublik ihrerseits hatte vieles, das es in der DDR nicht gab – zum Beispiel Religionsunterricht, der bei Schülern selbstverständlich verkürzt »Reli« hieß, manchmal aber auch »Region«. Diese saloppe sprachliche Entheiligung setzt sich fort, wenn im Andenkenladen christliche Devotionalien als »Devos« angeboten werden, was stark nach dem englischen Plural »Devils« klingt, nach Teufeln. Und die Dämonen des Kommerzes und des schlechten Geschmacks stecken ja tatsächlich in jeder Devotionalie, in jedem Kitschbild vom Pontifex, in jedem Kruzifix aus Plastik oder Plaste, das man sogar an der Tanke kaufen kann oder an der Raste.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.