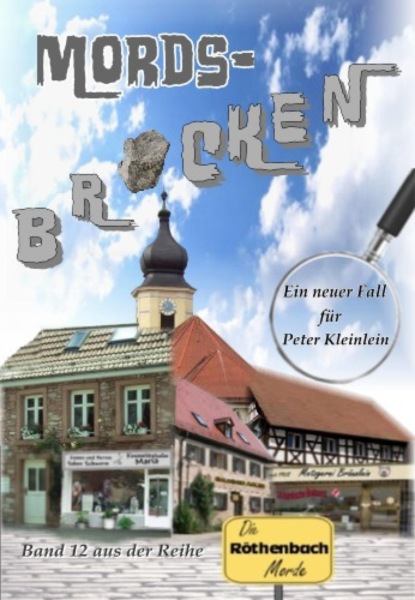- -
- 100%
- +
Simon war ob Peters Lästerei keineswegs beleidigt, sondern stellte nur lakonisch fest.
„Ich geh ja schließlich als Dorfbooder, falls ers nunni gmergd hobd. Dou konni ja schlechd riechn wäi a Ring Stadtworschd.“
Die Stimmung schien also schon zu Beginn prächtig zu sein und machte Hoffnung auf einen launigen Abend im Kreis von Freunden. Das Essen verlief dann auch in der harmonischen und in freundschaftlichen Atmosphäre, die die Beziehung der drei Familien untereinander schon seit jeher auszeichnete. Als die Herren mit ihrem dritten Veldensteiner und dem ersten Schnaps und die Damen mit dem Abwaschen und Aufräumen in der Küche beschäftigt waren, war die Zeit gekommen, sich über die neuesten Nachrichten zu unterhalten.
„Hobd ers scho ghärd?“, meinte Lothar. „Der Radio hodds heid nachmiddooch brachd, dass etz in Nordrhein-Wesdfahln aa scho an Haufn Infizierde gibd. Wahrscheinli homm ser si alle auf an Kabbmabnd angschdeggd. Dess wird nu woss gebn, wenn dee närrischn Rheinländer am Rosnmondooch erschd richdi loslegn. Bei uns in Deitschland kommer beschdimmd aa bald mid grössere Brobleme rechner. Mid derer Globalisierung bleibd dess gor nedd aus“, orakelte der Aushilfsmetzger und wackelte dazu mit dem ausgestreckten Finger, so als wollte er seinem Gegenüber die Schuld dafür zuschieben, was er natürlich nicht beabsichtigte. Seine aufgeregte Gestik war lediglich Ausdruck seiner ehrlichen Befürchtungen.
„Naja“, räumte Peter ein, „mir wolldn ja im Abrill nach Münchn, erschd amal um unser neis Enggerla zu besuchn und dann wolld mer eigndlich weider nach Idalien, ins Biemonde, ins Wein- und Drüfflbaradies. Abber dess wird wohl kaum woss wern, wenns schdimmd, woss die Exberdn brognosdiziern. Dee dreedn ja neierdings alle Dooch im Fernseeng im Fümbferback auf. Demnach kummd dess Virus etz aa zu uns und werd si in kürzesder Zeid soweid ausbreidn, dass äs öffndliche Leben mehr odder wenicher stillgleechd wern muss. In Oberidalien überleegns ja grod scho a allgemeine Ausgangsschberre. Abber sei’s wäis mooch. Ich braucherd ja nedd unbedingd an Urlaub, abber mei glanne Bianca mächerdi scho amol besuchn.“
„So isses“, bestätigte Simon und fügte auch gleich hinzu, was er damit genau meinte. „Urlaub brauchd ner bloß der Mensch, der wo woss ärberd. Du bisd ja scho lang Rendner, dou brauchd mer doch ka Erholung mehr. Von woss denn? Nedd amal als Dedeggdief brauchd di im Momend anner. Etz bisd braggdisch scho äs zweide Mal in Rende gschiggd worn. Äs erschde Mal vo deiner Firma und etz als Dorfgriminaler. Du hosd doch etz scho fasd zwaa Jahr kann Einsatz mehr ghabd. Sinn die Verbrecher alle ausgschdorbn? Odder hosd ka Lusd mehr?“
„Schäi wärs, abber äs Gsindl sterbd ned aus, wäi mer sachd“, meinte Peter lachend, „aber ich misch mich ja nedd in Alles ei. Dou derfür hommer ja die Bollizei und in mein letzdn Fall hodd si der Schindler ja nedd amal so bläid ohgschdelld. Jednfalls war ich heilfroh, wäi er mid seiner gesamdn Kavallerie zu meiner Befreiung angrüggd is. Ich bin ehrlich gsachd froh, wenni nedd immer hindern Rüggn von der Marga ermiddln muss. Dee dauerndn Heimlichkeidn sinn unsern häuslichn Gliema aa nedd grad zudräglich.“
Und um von diesem brisanten Thema abzulenken, wechselte er schlagartig die Richtung.
„Abber woss anders, hobbd er von derer Sabine woss midgrichd?“
„Heimlichkeidn? Sabine? Woss soll nern dess bedeudn?“, fragte Lothar verwirrt. „Woss hosdn du mit andere Weibsbilder zu schaffn?“
„Loodah“, rief Peter kopfschüttelnd, „doch ka andere Frau! Sabine iss doch der Name von dem Sturm, der vor drei Dooch gedoobd hodd. Scho vergessn? Ich wolld bloß wissn, ob ihr an Schadn dervo dragn habd, bei dem Unwedder.“
Beide verneinten unisono. Aber über eine Verwüstung im Wald in Richtung Heinerslohe wusste Lothar zu berichten. Er bekam die Neuigkeiten in seiner Eigenschaft als Dorffriseur immer als Erster mit, als Erster unter den Männern versteht sich. Mit Gisela, der einzigen und zugleich besten Fleischereifachverkäuferin von Röthenbach konnte er diesbezüglich aber natürlich nicht mithalten. Wenn sie von einem Ereignis nichts gehört hatte, dann konnte man getrost davon ausgehen, dass es in der Realität schlicht und ergreifend auch nicht existierte.
Besagte Gisela konnte man gegenwärtig nicht dazu konsultieren. Sie war mit den anderen Damen noch in der Küche beschäftigt, inzwischen wahrscheinlich bereits beim Espresso aus Margas neuester Errungenschaft, einem chromglänzenden Kaffeevollautomaten mit allen Schikanen, also war es an Lothar die Verwüstungen zu beschreiben.
„In Richdung Heinersloh naus, dou hodds a ganze Schneisn in Wald neigschloong. Die Bäum liegn kreizaquer überanander. Deilweis hängers abber aa bloß nu an an seidener Fadn in der Lufd, weils von an anderen Baum am Umfalln ghinderd wern. Noch. Kein Mensch konn soong, wann dee dann endgüldich umfalln. Dou konn a einfacher Windstoß scho langer. Drum soll mer zur Zeid aa ned in Wald naus, wall mehr odder wenicher Lebnsgefahr bestehd. Die Waldbesitzer könner im Momend aa nu nix undernehmer hobbi ghärd, weil die Entfernung von dem Windbruch aa für sie selber zu gfährlich wär. Etz wardns, bis a sogenannder Harvester frei wird, der die diggsdn Baumstämm einfach mid an hydraulischn Greifer fesdhäld und der wo‘s undn dann aa glei absäächd und danach zielsicher und ohne Wackler ableechd wäi a Mikadostäbler. Abber dess konn nu dauern, weil der ganze Landgreis auf des Monsdergeräd warded.“
„Ja“, stimmte ihm Simon bei, „dess hobbi aa scho glesn. In der Zeidung war a längerer Ardiggl drin. Manche Bäum hodds ja glei midzsamds der Wurzl rausgrissn. Dou homm mir im Dorf direggd ja nu Glügg ghabd.“
„Dou konnsd Rechd haben“, fuhr Lothar nun fort, „Und dou wo‘s so steil nunder gäihd, wissd er scho, an der Schdell wo damals der Sommer Helfried den junger Kerl beobachded hodd, wäi er midsamds derer Gelddaschn und dee erbressdn hunderddausnd Euro abghaud iss. Dou derf mer etz überhaubd nimmer hie, weil dou scho a boar mordsdrummer Felsbroggn nundergschdürzd sinn und die Gefahr besteht, dass nu mehrer bassiern konn. Wissder scho, dou, wo undn die Bank an der Bushaldestelle stäihd. Du konnsd di doch beschdimmd nu an dee Schdell erinnern, Beder, an den Fall mid dem verschwundner Zahnarzdsohn und seiner syrischen Freundin.“
Die Freunde nickten zustimmend. Die Örtlichkeit und die damaligen Vorkommnisse hafteten immer noch deutlich in Peters Gedächtnis. Dieser Fall hatte ihm eine Menge Kopfzerbrechen bereitet, bevor er schließlich die beiden gesuchten Ausreißer finden und sowohl den Erpresser, als auch einen Mörder zur Strecke bringen konnte. Die beschriebenen Verwüstungen bedeuteten für ihn aktuell aber kaum eine Gefahr, denn in diese Gegend kam er so gut wie nie.
Sie erzählten sich noch die eine oder andere Neuigkeit, von der sie glaubten, dass sie auch für die beiden anderen von Interesse sein könnten. Bald stießen auch die Damen wieder zu ihnen und man zog vom abgeräumten Esstisch um auf die großzügige Couch der Kleinleins. Es wurde wieder einmal einer der beliebten Abende im Kreis der besten Freunde oder der BKS-Familie, wie man mittlerweile sagen musste.
Eine virtuelle Familie
Die Maria hatte schon seit Langem eines, aber nun hatten sich auch die Gisela und die Marga eines zugelegt. Die Rede ist natürlich von einem nagelneuen Smartphone. Die Maria brauchte alleine fürs Geschäft schon eines, da ihre verwöhnten Kundinnen auch schon mal außerhalb der Öffnungszeiten ihres Schönheitstempels einen Termin vereinbaren wollten. Die Gisela dagegen hatte sich lange gegen diesen neumodischen Kram gewehrt. Letztendlich wurde sie dann aber doch mit diesem neuen Volksleiden infiziert und zwar ausgerechnet in ihrem ureigenen Revier, dem Metzgerladen. Die Rede ist natürlich von der Whatsapp-Seuche, die, im Gegensatz zu Corona, in der Regel die jüngere Bevölkerung zu befallen pflegt, die auch die deutlich schwereren Symptome bis hin zu suchtartiger Abhängigkeit zeigt. Mit zunehmender Häufigkeit gehörten mittlerweile aber auch schon viele Ältere zur Risikogruppe.
Die ganze Misere begann damit, dass die Metzgersfrau die übliche Frage 'Woss derfs denn heut sei?' mehrfach wiederholen musste. Es dauerte dann, bis die geistig völlig abwesenden Damen sich von den eminent wichtigen Informationen auf ihrem Handy losreißen, sich widerwillig, fast schon patzig ob dieser Störung, zu einer Antwort herbei lassen konnten. Danach mussten sie sich sogleich wieder ihren unverzichtbaren kleinen Wunderkästchen widmen, um hektisch über deren bunte Displays zu wischen.
Am Anfang hatte sich die Gisela über die unhöfliche Missachtung ihrer Bemühungen natürlich maßlos geärgert, konnte aber mit Rücksicht aufs Geschäft nicht so reagieren, wie sie gern gewollt hätte. Die Kundin war noch immer Königin. Doch sie, die beste Fleischereifachverkäuferin von allen, war schließlich auch nicht gerade ein Niemand und wenn sie zum Beispiel einen wertvollen Einblick in die höheren Sphären der Qualitätsfleisch- und Wurstwaren gab, dann erwartete sie auch, dass man ihren fundierten Ratschlägen die verdiente Beachtung schenkte.
Mit der Zeit bekam sie jedoch mit, wie praktisch es sein kann, schnell mal zuhause rückfragen zu können, was denn dem werten Herrn Gemahl nun anstelle des ausverkauften Pressacks genehm wäre. Aufgrund dieser Erfahrungen hatte sie von Tag zu Tag mehr angefangen ernsthaft zu überlegen, ob sie sich nicht auch so ein Gerät anschaffen sollte. Aber nicht etwa, weil sie Simon nach seinen Wünschen fragen wollte. Sie hatte andere Pläne.
Eine Eingewöhnungszeit benötigte sie so gut wie gar nicht. Die Gisela ist ja schließlich nicht auf den Kopf gefallen und kannte sich deshalb im Handumdrehen bereits bestens aus. Bald hatte sie mit ihrer unnachahmlichen Überzeugungskraft, von der so manche Kundin ein Lied singen konnte – 'derfs a bissler mehr sei, gell, ja, dess maani doch aa' - , auch ihre Freundin Marga von den Vorteilen dieser zeitgemäßen Kommunikation überzeugt. Vor allem dieses fabelhafte Whatsapp hatte die Damen bald schon in ihren Bann gezogen. Nun konnten sie sogar Bilder in Windeseile miteinander teilen. Die Gisela brauchte jetzt auch nicht mehr mitten im Verkaufstrubel ans Telefon zu eilen. Die Textnachrichten konnten ja warten, bis sich der Andrang im Laden wieder gelegt hatte. Die Neuerung war wirklich praktisch.
Eines Tages hatte sie sogar einen weiteren Schritt gewagt, war einseitig vorgeprescht und hatte eine Whatsapp-Gruppe „BKSF“ eingerichtet. Was wie das Firmenkürzel eines großen Konzerns klingt war in Wahrheit eine Kreation aus den Anfangsbuchstaben der Familiennamen Bräunlein, Kleinlein und Schwarm plus ein F für Familie. Somit hatte sie im Nu die Beteiligten Damen zu einer virtuellen Großfamilie verschmolzen. Peter, der schon seit langem ein geeignetes Mobiltelefon besaß, wurde gnädigerweise auch in die Liste aufgenommen. Er hatte es von seiner Marga geschenkt oder um bei der Wahrheit zu bleiben, verordnet bekommen. Sie wollte, dass er wenigstens immer erreichbar wäre, wenn er es denn schon nicht lassen konnte seine Nase in die kriminellen Angelegenheiten anderer Leute zu stecken. Das waren aber auch die einzigen Gründe. Es war keinesfalls so, dass ihm Marga damit seine kriminalistischen Umtriebe ausdrücklich erlaubt hätte, bei Weitem nicht. So weit würde es wohl kaum jemals kommen.
Wie sie alle schon bald leidvoll erfahren mussten, hat die schöne neue Welt der drahtlosen Kommunikation auch ihre Schattenseiten. Zu Beginn war alles noch prima, die Gisela schickte ständig irgendwelche Kochrezepte, die von der Marga prompt mit ebenso raffinierten Backanweisungen beantwortet wurden. Nur das Rezept für ihre berühmte Donauwelle war nie darunter. Das fiel unter die Rubrik Familiengeheimnisse, wobei in diesem Fall ausschließlich die reale Familie Kleinlein zu verstehen ist. Diesbezüglich gab es keine Kompromisse. Alles hat schließlich seine Grenzen. Sie würde ja auf nicht auf die Idee kommen, Simon nach den geheimen Zutaten für seine preisgekrönten bräunleinschen 1A Bratwürste zu fragen.
Sehr bald schon begann zum Leidwesen beider Damen eine inflationäre Flut mehr oder weniger origineller Videos und Fotos von überall her einzutrudeln, mit guten Ratschlägen für ein sorgenfreies Leben, mehr oder weniger geistreichen Sprüchen und fernöstlichen Weisheiten. Solange diese nur auf der Rückseite der Abreißblättchen des Apothekenkalenders gestanden hatten, konnte man sie ja noch einfach ignorieren. Nun aber ertönte beinahe pausenlos ein aufdringliches Geräusch, das an das Gezwitscher einer Nebelkrähe im Stimmbruch erinnerte, um das Eintreffen einer weiteren dieser unerwünschten Allerweltsweisheiten anzukündigen. Angeblich konnte man dies in den Einstellungen ändern. Bisher hatten sie das aber noch nicht geschafft und Patrick, den Sohn der Bräunleins zu fragen, kam nicht in Betracht. Der würde sie nur wieder auslachen. Es begann daher mittlerweile gewaltig zu nerven, Tendenz steigend. Das Problem war, dass die beiden Damen allen Bekannten, die meist schon längst über ein Smartphone verfügten, voller Stolz über ihre Neuerwerbung ihre Handynummer mitgeteilt hatten mit eben diesen bekannten Folgen.
Die Maria, als Betreiberin eines professionellen Kosmetikstudios, hatte für solche Spielchen keine Zeit. Sie nutzte das Handy fast ausschließlich für die notwendige geschäftliche Kommunikation. Die wenigen Kundinnen, denen sie ihre Nummer gegeben hatte, waren zudem während einer der Verschönerungssitzungen dezent aber unmissverständlich darauf hingewiesen worden, dass die wahllose Verbreitung von Kettenbriefen und schlauer Sprüche zur Streichung aus der Kundenliste führen konnte. Und die Damen, die in Zukunft noch Aussichten auf einen der begehrten Termin haben wollten, die hielten sich besser daran.
Doch jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Das Ganze hatte neben der Flut von vielen unerwünschten guten Ratschlägen auch einen unschätzbaren Vorteil für die Kleinleins mit im Gepäck. Ihre Tochter Heidi schickte nun von Zeit zu Zeit kurze Videosequenzen von der kleinen Bianca, was bei der Marga jedes Mal Ausbrüche größten Entzückens auslöste.
Eben zeigte die Marga eines dieser kleinen Filmchen, was die beiden Freundinnen veranlasste, die Köpfe noch enger zusammen zu stecken. Es gibt wohl kaum ein anderes Thema, das geeignet wäre so viele aah’s und ooh’s, ergänzt von einem gelegentlichen 'ach Godderla, oadli', auf die Lippen der Damen zu zaubern.
„Wie ald iss etzerdler, eier Glanne?“, fragte die Gisela.
„Morng werns drei Wochn“, antwortete die Marga sichtlich stolz „und bis etz hommers noch nedd amal besuchn könner, weil doch der Beder die ganze Zeid so an hardnäggichn Husdn ghabd hodd und dou kommer ja nedd in an Haushald mid an glann Bobberler auf Bsuch kommer.“
Sie sandte erneut einen sehnsuchtsvollen Blick in Richtung des kleinen Bildschirms.
„Unser glanns Waggerler woll mer doch nedd anschdeggn, auf gar kann Fall. Dess wär uns ja selber nedd Rechd. Abber etz wo der Beder widder vill besser beinander iss und aa nimmer anschdeggnd, dou woll mer nächste Wochn scho amal fahrn.“
Die Herren hatten ein völlig anderes Gesprächsthema. Bei ihnen drehte sich alles um die große Politik, genauer gesagt um die bevorstehende Wahl zum Gemeinderat und um die des Bürgermeisters. Amtsinhaber Helmut Holzapfel hatte seine erste Amtsperiode mittlerweile ohne größere Skandale hinter sich gebracht. Die anfänglichen Zweifel an seiner Eignung hatte er allerdings nie ganz abschütteln können, was aber einen Vollblutpolitiker wie den Holzapfel in keinster Weise anfechten konnte. Ein paar ewig Unzufriedene gibt es schließlich immer und überall und einem jeden Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, wie der Volksmund schon seit alters her absolut richtig erkannt hat. Andererseits hatte er aber auch keine gravierenden Fehler auf seine Kappe nehmen müssen. Das musste nicht weiter verwundern, denn er gehörte zum Typus des allgegenwärtigen Vereinsmeiers und Gschafdlhubers, der sich in alles einmischte. Er tauchte unweigerlich auf den Veranstaltungen aller ortsansässigen Vereine auf, wobei er es meisterlich verstand, seine Verdienste allenthalben in den Vordergrund zu stellen. Wer erinnerte sich nicht an die protzige 900-Jahr-Feier des Ortes vor einigen Jahren. Diese hatte ihm eine willkommene Bühne für seine Selbstdarstellung geboten und er vergaß seither bei keiner seiner meist langatmigen Reden, den Bürgern die unbestreitbaren Verdienste ihres Bürgermeisters an diesem Jahrhundertereignis in Erinnerung zu rufen.
Alles in Allem hätte er daher eher zuversichtlich in die kommende Auseinandersetzung mit seinem Gegenkandidaten gehen können, doch aus unerfindlichen Gründen erhielt dieser, ein gewisser Tobias Kanzler, seines Zeichens aktueller Oppositionsführer im Gemeinderat, einen enormen Zuspruch. Jede geplante Wahlkampfaktion Holzapfels schien er vorauszusehen und verstand sie zu unterlaufen. Es war wie beim Rennen zwischen Hase und Igel. Was immer er vorhatte, Kanzler war schon vorher da. Dazu kam, dass der Neubau des großen Einkaufszentrums am Ortsrand für viele ein Anlass zur Kritik war. Man konnte schwer einschätzen, inwieweit dies die Aussichten auf eine Wiederwahl beeinträchtigen würde. Eines war sicher, es hatte ihm nicht nur Freunde eingebracht.
Vor allem die von Einigen als unerträglich empfundene Überflutung des Dorfs mit Ortsfremden, speziell an den Samstagen und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen und Verschmutzungen rund um die Parkplätze durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, Eisverpackungen, Taschentücher und dergleichen brachten viele Alteingesessene auf die Palme. Seit die Metzgerei Bräunlein auch noch die Fleisch- und Wurstabteilung im Supermarkt übernommen hatte, war Röthenbach mehr oder weniger zu einem Ausflugsziel, ja zu einem Wallfahrtsort für Städter geworden, die sich vergleichsweise günstig und trotzdem mit bester Qualität für eine ganze Woche eindecken wollten. Früher war Röthenbach ein Ort der Idylle, argumentierten die Kritiker, nun aber rollten bis spät am Abend noch gefühlt unzählige Fahrzeuge polternd durch die Hauptstraße. Lärmbelästigung und Luftverschmutzung waren die Folge.
Allen voran war es jener Tobias Kanzler, der sich zum Anwalt dieser Unzufriedenen aufgeschwungen hatte und der versuchte mit deren Stimmen im Rücken den selbstgefälligen Amtsinhaber, Bürgermeister Holzapfel, von seinem bequemen Sessel im Rathaus zu verdrängen. Wer ihn über seine eigene Person philosophieren hörte, was nicht gerade selten vorkam; der durfte getrost annehmen, dass hier der Familienname Programm war. Einer wie er konnte zweifellos auch Kanzler, ganz sicher aber Bürgermeister einer so unbedeutenden Gemeinde wie Röthenbach.
Ein unübersehbarer Makel blieb aber trotz aller Redekunst und ungeachtet aller Hochglanzprospekte wie eine Erbsünde an ihm haften: Er war unbestreitbar kein reinrassiger Röthenbacher. Gerade erst einmal knapp fünfzehn Jahre wohnte er in der Gemeinde, was ihn für viele Röthenbacher nur wenig heimischer erscheinen ließ, als die wilden Horden, welche im dreißigjährigen Krieg das Dorf heimsuchten und mehrmals verwüsteten, wie aus den alten Kirchenchroniken hervorging. Röthenbach hätte wohl gut und gerne einen Integrationsbeauftragten vertragen können, auch ohne massenhaften Zuzug aus orientalischen Regionen.
Tobias Kanzler machte vehement Stimmung gegen den Bau des BIGMA-Supermarkts und die damit verbundenen Störung der Dorfidylle. Er wollte damit den Makel seiner Herkunft aus der Großstadt wett machen, sich als aufrechter Anwalt der berechtigten Interessen der alteingesessenen Röthenbacher Bürger präsentieren und somit einen entscheidenden Schritt in Richtung einer gelungenen Integration machen.
„Mir gfälld der aane so wenich wäi der andre“, ließ sich Simon vernehmen, „obwohl ich nix Schbezielles geecher die zwaa Herrn soong konn. Sie kaufen alle zwaa ihr Fleisch und Worschd bei mir, dess hassd ihre Frauen nadürlich und dou hodds nu nie woss gebn. Abber so richdi symbadisch kummers beide drotzdem nedd bei mir rüber. Der Aa is a Reigschmeggder, woss er drotz aller Gschafdlhuberei nedd verbergn konn und der Ander a eingebildeder Aff. Siebngscheid sinns alle zwaa. Dou wassd nedd, woss dassd wähln sollsd, Besd odder Cholera. Ich mach wahrscheinli für kann von dene zwaa mei Kreizler.“
„Dess konnsd doch nedd machen“, warf Lothar ein, „mir leben ja Goddseidank in anner Demmogradie. Dass mer wähln derf iss doch unser höchsdes Gut. Wähln gäih iss für mich Bürgerpflichd!“
„Ich gäih ja wähln“, korrigierte in Simon, „abber ich mach hald beim Burchermasder ka Kreizler. In Gemeinderad wähl ich nadürli scho, dou mou mer sich ja a nedd für aans von zwaa gleich große Übl endscheidn, dou konnsd dee achd Kandidadn quer über alle Bardeien aussoung, dee der gfalln und basda.“
Peter lachte über den Schlagabtausch der beiden Freunde. Auch er tat sich schwer, sich für einen der beiden Bürgermeisterkandidaten zu entscheiden, aber so lange kein anderer Bewerber zur Verfügung stand musste es zwangsläufig einer der beiden Herren werden.
Es war mittlerweile schon fast 20 Uhr und so fragte er die Freunde, ob sie etwas dagegen einzuwenden hätten, wenn er kurz für die Nachrichten den Fernseher anmachen würde. Die bevorstehende Coronakrise hatte ihn schon von Anbeginn an in eine gewisse Spannung versetzt und er wollte die neueste Entwicklung unbedingt verfolgen.
Er hatte gerade zur rechten Zeit eingeschaltet. Die letzten Töne der Erkennungsmelodie der Tagesschau waren gerade verklungen, da verkündete der Sprecher auch schon die neuesten Meldungen von der Virusfront. In China griff die Seuche immer weiter um sich. Die gespenstischen Bilder zeigten menschenleere Straßen, nur ab und zu war eine einzelne dahin eilende Person mit Gesichtsmaske zu erkennen. Dann kam eine Stellungnahme des deutschen Gesundheitsministers. In Deutschland gäbe es bisher lediglich 16 Infizierte, verkündete er erleichtert. Viele davon stammten aus dem Ort Gangelt im nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg. Anscheinend hatten sie sich allesamt bei einem Kappenabend, einer Karnevalsveranstaltung, angesteckt. Wer das Virus eingeschleppt hatte, war derzeit aber noch nicht geklärt. Der Minister versicherte, er sehe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gefahr für eine Pandemie. In Deutschland habe man die Lage vollständig im Griff, ließ er sich vernehmen. Das mochte für den Moment auch tatsächlich richtig sein. Anders verhielt es sich allerdings für die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs namens „diamond princess“, das mit 621 Coronainfizierten vor Yokohama in Quarantäne lag. 'Die Lage der 3711 Passagiere und der Besatzung ist verzweifelt', vermeldete der Sprecher mit ernster Miene.
Auch die Gesichter auf dem Röthenbacher Kappenabend hatten plötzlich bedenkliche Züge angenommen, ganz im Gegensatz zu ihren Pappnasen und Faschingshütchen.
Der Feind rückt näher
Gut drei Wochen waren seit den beiden denkwürdigen Kappenabenden vergangen, dem recht harmlosen in Röthenbach und dem fatalen in Gangelt. Inzwischen hatte sich gezeigt, dass sich das Virus von dem kleinen Gangelt ausgehend in weite Teile Deutschlands ausgebreitet hatte. Auch in Baden-Württemberg schien sich ein Infektionsnest zu bilden. Die dort Erkrankten hatten ausnahmslos in Italien, genauer in Südtirol oder dem Piemont Urlaub gemacht. In Italien, dem ersten europäischen Hotspot, hatte die Epidemie bereits ein verheerendes Ausmaß erreicht. Die komplette Ausgangssperre, die zuvor nur in Norditalien gegolten hatte, war nun über ganz Italien ausgeweitet worden. Die Fernsehbilder zeigten leergefegte, von bewaffneten Militärstreifen kontrollierte Straßen.
Gleichzeitig wurde in Spanien der Weltfrauentag mit Massendemonstrationen und großem Tamtam gefeiert, Verbrüderungs-, sorry, Verschwesterungsszenen eingeschlossen, mit fatalen Folgen. Wie sich bald herausstellte, hatten sich dabei Zehntausende infiziert und bildeten somit die Basis für eine todbringende Krankheitswelle, die nach einem weiteren Monat bereits mehr als 20000 Todesopfer gefordert haben würde.
Die Unvernunft wurde aber auch hierzulande auf die Spitze getrieben. Als Italien bereits komplett abgeriegelt war, waren noch ganze Reisegruppen, vor allem aus der Tübinger Gegend, zum Skilaufen nach Südtirol aufgebrochen. Entsprechend hoch waren danach die Ansteckungszahlen. Den Vogel schoss jedoch eine Gemeinde in Österreich ab. Als kein vernünftiger Mensch mehr die Augen vor dem kommenden Inferno verschließen konnte, feierte im Tiroler Ischgl die Apres-Ski-Gemeinde fröhlich weiter, so als ob es kein Morgen gäbe. Doch der Morgen kam natürlich und er war verheerend. Zahllose Erkrankungen hatten hier ihren Ausgangspunkt mit Auswirkungen bis ins entfernte Island. Als andernorts bereits Menschen mangels Beatmungsmöglichkeiten dem sicheren Tod überliefert werden mussten, dachten die Tiroler Behörden nicht im Ansatz daran, das fröhliche Treiben zu beenden. Während die Kassen munter klingelten blieben die Alarmglocken stumm. Die Lifte liefen munter weiter und was weit schlimmer war, auch die Partys in den zahlreichen Unterhaltungsbetrieben der Region. 'Schifoan, jojojojo! Schifoan! Jo, Schifoan is des leiwandsde, woss mer si nur vurstölln ko-o-onn!', schallte es aus den Lautsprechern.