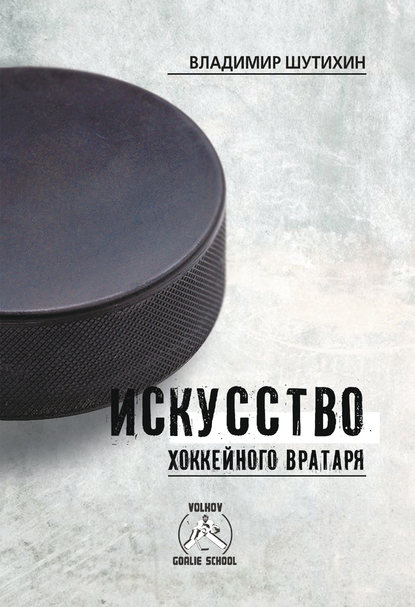- -
- 100%
- +
Kennengelernt hatten Arnie und er sich Ende ’48 in Luckau, einer unbedeutenden märkischen Stadt, deren Namen in gewissen Kreisen kein guter Klang anhaftete. Im alten Luckauer Knast hatte schon so mancher ein paar Jährchen abgebrummt. Funze hatte nur achtzehn Monate dort gesessen, und das allein durch einen unglücklichen Zufall. Er war im Berliner Wedding aufgewachsen und alles andere als ein Ganove von Format. Lieber angelte er die kleinen Fische, stand mal Schmiere, sammelte Informationen und gab sie an Interessierte weiter. Der dilettantische Bruch in einer Provinzsparkasse, zu dem Funze sich hatte überreden lassen und der ihm Luckau beschert hatte, war eine Nummer zu groß ausgefallen, wie er sich inzwischen insgeheim eingestand. Noch dazu hatten sie das Ding kurz vor der Währungsreform gedreht – aber wer hatte das damals ahnen können?
In der überfüllten Zelle, wo unverbesserliche Nationalsozialisten taten, als hätten sie um ein Haar den Krieg gewonnen, und ein paar Politische, die nicht mal wussten, weshalb sie inhaftiert waren, sich mausigmachten, versuchte er anfangs große Bögen zu spucken. Er renommierte mit seinen kriminellen Erfahrungen, bis Arnie, der dank seiner Körperkraft und Persönlichkeit tatsächlich den Ton angab, ihm einen schmerzhaften Rippenhieb verpasste und ihm kategorisch das Maul verbot.
Funze, sonst nicht der Klügste, begriff rasch, dass Arnie das Recht des Stärkeren auf seiner Seite hatte. Also schwieg er fortan und hielt sich wohl oder übel an Arnies Führerrolle. Der spielte in einer höheren Liga als er. Vier Jahre hatten sie dem übergeholfen, weil er irgendwo einen Tresor geknackt hatte. Mehr erfuhr Funze nicht. Das war auch besser so, denn die Bullen holten ihn manchmal, einfach so, um ihn auszuhorchen. Er war der Richtige dafür, ein Quatschmaul, das wusste jeder. Über Arnie zu reden, weigerte er sich jedoch standhaft.
Es dauerte lange, bis Arnie ihm das mit ein bisschen Vertrauen lohnte, und es kostete Rudi Fenske die Adresse der eigenen Mutter am Gesundbrunnen. «Über die erreichst du mich jederzeit», musste er Arnie eins ums andere Mal versichern, bis der ihm endlich glaubte. Das hatte er nun davon!
Nachdem Funze nach Berlin zurückgekehrt war, verschwand Arnie vorerst aus seinem Gedächtnis. Mit der neuen Währung und den gänzlich veränderten Verhältnissen zwischen Ost und West stürmte zu viel Neues auf ihn ein. Ein halbes Jahr Plötzensee verdrängte die Luckauer Erlebnisse endgültig.
Arnie jedoch hatte den Berliner Kumpel und dessen angeblich weitreichende Verbindungen in den einschlägigen Kreisen nicht vergessen. Der Osten war sowieso nichts für ihn: Hungerlöhne bei hohen Normen, Lebensmittelkarten, knappes Fressen und eine allgegenwärtige Polizei. Kaum aus Luckau entlassen, zog es Arnie nach West-Berlin – wohin sonst. Außerdem hatte er da noch eine dicke Rechnung offen, wie er Funze gegenüber andeutete. Um die zu begleichen, brauchte er ortsansässige Hilfe.
Als Erstes suchte er Funzes alte Mutter auf und bequatschte sie so lange, bis sie ihm haarklein den Weg zu der Laube in Mariendorf beschrieb, in der sich Funze nach dem letzten Reinfall verkrochen hatte. Seit über einer Woche hausten sie nun zu zweit in der Bretterbude, in der Arnie sofort das Kommando übernommen hatte. Er wollte nicht in irgendeinem Flüchtlingsnotquartier beklaut werden. Die Befragungen durch die drei Besatzungsmächte und etliche deutsche Stellen verlangten sowieso ein ungewohntes Maß an Zurückhaltung von ihm. Dabei standen seine Chancen, als politischer Flüchtling anerkannt zu werden, nicht einmal schlecht. Nur die Freiheitlichen Juristen ließen ihn abblitzen. Die kannten überraschenderweise sein Strafregister.
Arnie verstand es, das Maul zu halten, das wusste Funze. Ihn auszuhorchen, hatte er längst aufgegeben. Wenn es jedoch sein musste, konnte Arnie auch beredsam sein wie ein Missionar auf Seelenfang. Dem fühlte Funze sich in keiner Weise gewachsen. Bis in die tiefe Nacht erzählte Arnie von den Fachleuten, mit denen er zusammengesessen hatte, richtigen Schränkern der alten Schule, die von nichts anderem geredet hätten als vom großen Geld, das in festen, stählernen Behältnissen aufbewahrt werde. Die warteten nur darauf, von geschickten Händen geknackt zu werden. «Das ist künftig unser Feld!», schwärmte Arnie, der sich in der neuen Umgebung fühlte wie ein Golddigger am Klondike. «Es kann doch nicht so schwer sein, irgendwo in dieser Stadt einen gutgefüllten Tresor ausfindig zu machen und dazu ein, zwei Leute, die was auf dem Kasten haben. Ich denke, du kennst hier Gott und die Welt!»
Funze gab sich wenig optimistisch. Namen nannte er schon gar nicht. Doch an Arnie prallten alle Einwände ab. Immer wieder fing der davon an. Auch jetzt beobachtete er aufmerksam die Betuchten, die sich in der Nähe des Rings sammelten. «Irgendwo müssen die ihre Kohle bunkern!», stieß er zwischen den ungepflegten Zähnen hervor.
Um ihm wenigstens das Hirngespinst eines mühelosen Tresoreinbruchs auszutreiben, fiel Funze nichts Besseres ein, als ausgerechnet den Bruch in der Verkehrskasse als abschreckendes Beispiel aufzubauschen. «Du hast keine Ahnung, wie das hier zugeht! Die im Osten haben alle Beteiligten ganz schnell gegriffen. Dabei sind die Jungs echte Profis, das kannst du glauben!»
«Und das Geld?», fragte Arnie, der ihm mit leuchtenden Augen zuhörte. Bis Luckau war nur eine verschwommene Version von dem Raubzug gedrungen. Jetzt wollte er jede Einzelheit hören.
Funze hob die schmalen Schultern. «Danach fragt man besser keinen», meinte er. «Die Bullen haben es jedenfalls nicht gefunden.»
Arnie grinste breit. «Na siehste! Da ist noch alles drin! An so ein Ding muss man sich ranhängen, Mensch!»
Funze zuckte zusammen. «Das lass mal lieber sein! Die Jungs sind gut organisiert und sehr empfindlich. Gegen die hast du keine Chance!»
«Erzähl mal!», verlangte Arnie. «Und lass nichts aus!»
So erfuhr Arnie zwischen den Kämpfen in Bruchstücken die Geschichte vom Raub in der Verkehrskasse, wie Funze sie sich aus Zeitungsberichten und umlaufenden Legenden zusammenreimte. «Zwei werden immer noch gesucht», schloss er. «Ein gewisser Panitzke und Muhme Geißler. Den hab ich sogar danach noch …» Er verstummte, und das nicht nur, weil Arnie ihn heftig am Arm packte.
«Sag das noch mal!», verlangte er scharf. «Muhme Geißler? Ist das so ’n Spitznasiger, der sich gerne ‹Doktor› nennen lässt?»
Funze schwante nichts Gutes. «Kennste den etwa?», erkundigte er sich vorsichtig.
Und ob Arnie den kannte! «Wenn ich den erwische, mach ich ihn kalt!», sagte er so laut, dass Funze sich erschrocken umsah. Im Ring lief die letzte Runde im Mittelgewicht. Erbarmungslos wurde der Franzose, der sich nur mit Mühe bis in die sechste Runde gerettet hatte, von seinem deutschen Gegner zusammengeschlagen. Hilflos hing er in den Seilen und glotzte stieren Blicks auf den zählenden Schiedsrichter. Die Menge johlte. Aus der Ecke des Franzosen flog das rettende Handtuch als Zeichen der Aufgabe.
«Genau so verhackstücke ich deinen Muhme!», kommentierte Arnie das Geschehen im Ring.
Funze tat beleidigt. «Wieso denn mein Muhme?», fragte er. «Ich kenn den kaum.»
«Dafür kenne ich ihn umso besser», sagte Arnie grimmig. Er sah aus, als ginge er jeden Moment hoch wie eine Rakete. «Der ist mir einiges schuldig!»
Sorgenvoll lüftete Funze die Mütze und kraulte seine wirre Tolle. Sein loses Maul hatte ihn mal wieder tief in die Kacke geritten! Er war Geißler nach dem Bruch tatsächlich begegnet, rein zufällig, und er wusste auch noch, wo das gewesen war. Aber Arnie durfte das auf keinen Fall erfahren! Der kriegte es fertig und richtete sonst was an. Ein echter Provinzganove! Der kannte sich nicht aus in den Berliner Verhältnissen.
Aber er war schnell von Kapee, wie sich herausstellte. «Wann und wo hast du den zuletzt gesehen?», wollte er wissen.
«Nu mal langsam!», wich Funze aus, doch es half ihm nichts. Wie eine Schraubzwinge presste Arnies Riesenpfote seinen Arm. «Keine Fisimatenten, mein Junge! Ich will alles wissen. Alles! Ist das klar?»
«Ich weiß fast gar nichts …», ächzte Funze schwach. Am liebsten hätte er geheult ob seiner eigenen Dämlichkeit. Er wusste, dass er den Mund nicht halten würde.
Im Ring ging es inzwischen auf den Hauptkampf des Tages zu. Der 32-jährige Hein ten Hoff, seit fünf Jahren Deutscher Meister im Schwergewicht, musste den Wiener Joschi Weidinger besiegen, wollte er gegen den amtierenden Europameister Heinz Neuhaus antreten, der den Titel erst seit März trug. Nach seinem sensationellen Sieg gegen den Engländer Jack Gardener waren ten Hoff kaum fünf Monate als Europameister vergönnt gewesen. Es wurde Zeit, dass er den Titel zurückeroberte! Darin stimmte Kappe mit seinen beiden Sitznachbarn ausnahmsweise überein. Nachdem er Klaras Stullen vertilgt und sich mit Kaffee und ein paar Schlucken aus dem Flachmann gestärkt hatte, war er mit ihnen ins Gespräch gekommen. Während der eine ten Hoffs Laufbahn am Ende sah, setzten Kappe und sein direkter Nachbar ihre Hoffnungen auf den langen Hamburger, über dessen Größe man uneins blieb. Ob 1,91 Meter oder 1,96 Meter, war aber letztlich egal. Der Wiener, ebenfalls kurzzeitig Europameister, war jedenfalls ein ebenbürtiger Riese mit einer entsprechenden Reichweite. Hatte ten Hoff nicht sogar den gefürchteten Amerikaner Tiger Jones nach Punkten besiegt?
Ten Hoff ließ es in der ersten Runde ruhig angehen und tastete den Gegner ab, um ihn in der zweiten Runde in die Ecke zu drängen und einen wahren Hagel von Schlägen auf ihn niederprasseln zu lassen.
«Der macht nicht mehr lange», prophezeite Kappes Nachbar bedauernd. Immerhin war der Kampf auf zehn Runden angesetzt.
Sechzig Sekunden Pause reichten Weidinger nicht, um sich von dem Trommelfeuer zu erholen. Angeschlagen und noch immer etwas benommen ging er in die dritte Runde. Ten Hoff nutzte die Schwäche seines Gegners und setzte ihm blitzschnell seine harte Rechte direkt aufs Kinn. Weidinger stürzte wie ein gefällter Baum und wurde unter dem tosenden Jubel des Publikums ausgezählt.
Damit war der Tag eigentlich gelaufen, fand Kappe. Der Hintern schmerzte, und die Blase drückte. Es war also höchste Zeit, sich wenigstens die Beine zu vertreten. Gemeinsam mit dem Nachbarn, der wortreich zugab, ten Hoff unterschätzt zu haben, machte er sich an den Aufstieg. Klaras alte Einkaufstasche ließ er in der Obhut des anderen. Nur das Opernglas steckte er in die Jacketttasche.
Vor den Toiletten standen die Männer in langen Reihen. Der Lärm der Arena drang dumpf an- und abschwellend herauf, überlagert von verzerrten Lautsprecherdurchsagen. Kappe merkte, dass er Kopfschmerzen hatte und ihm das ganze Spektakel allmählich zu viel wurde. Während er noch brav in der Schlange wartete, sprach ihn plötzlich jemand an. «Guten Abend, Herr Kappe!»
Er brauchte einen Augenblick, um den Mann zu erkennen. «Holtefret!», sagte er erstaunt. Den hatte er hier am allerwenigsten erwartet. Ihr letztes Zusammentreffen lag mindestens vier Jahre zurück und ihr gemeinsames Abenteuer in der Wadzeckstraße am Alex fast sechs. Damals hatte der Kriminalassistent Eddie Holtefret ihm möglicherweise das Leben gerettet. Später hatten sie sich aus den Augen verloren. Eddie war nach der Spaltung bei der Volkspolizei im Osten geblieben. «Bist du nicht mehr bei der Konkurrenz?», fragte Kappe deshalb auch als Erstes.
Eddie schüttelte den Kopf. «Das ist endgültig vorbei», sagte er. Es klang nicht gerade erfreut.
Kappe musterte ihn etwas eingehender. Ein glücklicher Mensch sah anders aus. Eddie Holtefret war wohl ein Flüchtling. Spontan sagte Kappe: «Lass dich doch mal sehen! Wenn ich dir helfen kann …» Es war nur eine Phrase, wie er selbst wusste. Er mochte Eddie, aber ein ehemaliger Volkspolizist würde es nicht leicht haben.
Eddie lächelte gequält und winkte ihm zu. «Mal sehen», sagte er. «Da drüben wartet meine Verlobte.» Weg war er.
Vergebens hielt Kappe nach ihm und der Verlobten Ausschau. Dass es sich noch um die gleiche Braut wie vor sechs Jahren handelte, erschien ihm unwahrscheinlich.
Nachdem Kappe sich endlich erleichtert hatte, drängte ihn nichts, sich sofort wieder hinunter in den brodelnden Hexenkessel zu begeben. Den Nachbarn, der mit ihm zur Toilette gegangen war, hatte er aus den Augen verloren, an Karl-Heinz dachte er nur flüchtig. Durch das alte Opernglas hatte er von oben einen guten Blick auf den Ring.
Dort begann inzwischen der letzte Kampf über acht Runden: Conny Rux gegen den zwölf Jahre älteren Belgier Eugene Robert, der 23 Kilogramm mehr auf die Waage brachte, von seinen letzten fünf Kämpfen jedoch vier verloren hatte. Aber auch Rux war vor zwei Jahren hier in der Waldbühne von Tiger Jones in der fünften Runde k. o. geschlagen worden. Kappe erinnerte sich noch gut an seine Enttäuschung.
Es wurde ein harter Kampf. In der fünften Runde ging Rux nach einer vollen Rechten des Belgiers zu Boden. Verärgert wandte sich Kappe ab. Jetzt bedauerte er es, nach ten Hoffs Sieg nicht gleich gegangen zu sein. Jeden Augenblick konnten sich die Massen in Bewegung setzen, und dann würde es unmöglich, im Gegenstrom zu seinem Platz zurückzugelangen. Es war allemal gescheiter, sich unverzüglich auf den Weg zur S-Bahn zu machen, bevor der große Ansturm einsetzte.
Die Tasche fiel ihm ein. War die es wert, sich in ein hoffnungsloses Getümmel zu stürzen? Klara besaß mindestens drei davon. Das olle Ding stellte keinen echten Verlust dar, und auch die verbeulte Thermosflasche ließ sich leicht ersetzen. Die wirklich wichtigen Dinge wurden am Mann getragen. So war Kappe noch nie etwas gestohlen worden. Klara dagegen hatte man im Laufe der Jahre zweimal das Portemonnaie geklaut und einmal die Wohnungsschlüssel. Aus reiner Gewohnheit tastete Kappe nach Polizeimarke, Brieftasche und Schlüsselbund. Alles war an seinem Platz. Beruhigt setzte er seinen Weg fort. Die ersten eiligen Heimkehrer stürmten an ihm vorbei. Hundert Meter vor dem S-Bahnhof merkte er, dass es zu regnen begann. Das Regencape! Klara würde wegen der unförmigen Pelle einen Heidenspektakel veranstalten. Resigniert schlug Kappe den Jackettkragen hoch. An Karl-Heinz dachte er nicht mehr.
MENSCHENRAUB
HILDEGUND HRIBAL saß an ihrem Arbeitsplatz und träumte. Nicht gerade von besseren Zeiten, aber wenigstens vom bevorstehenden Pfingstfest. Das bescherte ihr zweieinhalb freie Tage. Sie freute sich darauf, zumal laut Wetterbericht angenehme Temperaturen und Sonne zu erwarten waren. Wölfchen hatte versprochen, mit ihr an die Havel zu fahren. Vielleicht würden sie essen und eventuell auch tanzen gehen. Bei Wölfchen wusste man nie, wie er gerade bei Kasse war. Das wechselte in letzter Zeit. Bei ihr war das anders, da herrschte immer Ebbe im Geldbeutel. Das kleine Gehalt reichte nur für das Notwendigste. Immerhin war sie für Montagabend zum Nachtdienst eingeteilt worden und erhielt so einen kleinen Zuschlag. Sie musste Wölfchen nur beibringen, dass solche Dienste nun mal zu ihrem Beruf gehörten.
Ohne wirklich hinzusehen, blickte Hildegund hinüber auf die grauen Fassaden der Messehallen, die jenseits der breiten Allee in der Mittagssonne glänzten. Lehnte sie sich ein wenig zurück, konnte sie sogar die winzigen Gestalten auf dem Funkturm erkennen, die von der Aussichtsplattform auf das schiffförmige Klinkergebäude hinunterschauten, in dem sie an ihrem Schreibtisch darauf wartete, dass ein vor Aufregung schwitzender Jungredakteur ihr stammelnd einen Kommentar diktierte. Darin würde er zum tausendsten Mal in mäßigem Deutsch das «Kriegstreiberregime da draußen» madigmachen. Direkt vor ihren Augen lag der böse, wilde Westen mit den vielen Arbeitslosen – und mit all jenen Verlockungen, denen Hildegund insgeheim ganz gerne erlegen wäre. Sie seufzte. Vielleicht ergab sich einmal eine Gelegenheit …
Aus dem Zimmer des stellvertretenden Chefredakteurs drangen streitende Stimmen. «Wir werden dem Gegner keine Steilvorlage liefern!», dröhnte er. «Eine solche Meldung geht nicht über meinen Tisch!» Worauf jemand sarkastisch anmerkte, dass den Hörern bei dieser Zurückhaltung nichts anderes übrigbleibe, als sich beim RIAS über die Unterbrechung des Telefonnetzes zu informieren. Das war Hünicke, ein junger Bursche mit einer frechen Schnauze, dem der Chef sofort lautstark über den Mund fuhr: «Darüber unterhalten wir uns an anderer Stelle! Einer wie du braucht einen alten Genossen wie mich nicht über die Rolle des RIAS aufzuklären!»
Die Drohung des «alten Genossen» von knapp dreißig Jahren überraschte Hildegund nicht. Jeder wusste, dass der von den Amerikanern bezahlte Rundfunk aus dem amerikanischen Sektor hier im Haus als rotes Tuch galt. Die Erwähnung des Feindsenders war – wenn überhaupt – nur unter Beifügung saftiger Vokabeln üblich. Und dass der Telefonverkehr zwischen Ost und West seit Dienstag unterbrochen war, musste inzwischen auch der Letzte mitgekriegt haben.
Hildegund hatte sich längst abgewöhnt, auf den Inhalt der Phrasen zu achten, die täglich nicht nur an ihre Ohren drangen, sondern auch auf ihren Stenoblock und anschließend in die Tasten gerieten. Nur gelegentlich machte sie auf eine besonders unpassende Formulierung aufmerksam oder korrigierte die schlimmsten Sprachschnitzer. Sie war inzwischen zur Sekretärin des stellvertretenden Chefs aufgestiegen, aber keiner von diesen neunmalklugen Fatzken ließ sich gerne von einer einfachen Tippse belehren. Stattdessen machten die Kerle sich auf schleimige Art an sie ran oder versuchten, ihr mehr oder weniger direkt an die Wäsche zu gehen. «Sexualproviant», hatte mal einer gesagt und damit all die schlechtbezahlten jungen Frauen im Haus gemeint, die in den Sekretariaten, in der Telefonzentrale und in der Technik arbeiteten.
Sexualproviant! Für so was war sich Hildegund zu schade. Ihr beinahe vergessener Verlobter, eine Kinderfreundschaft aus dem Nachbarhaus, war vom letzten Einsatz an der Oder nicht zurückgekehrt, ihr kurzzeitiges Verhältnis mit einem Kaffeeschieber bald gescheitert. Und schließlich hatte sie es nach zwei Versuchen auch aufgegeben, sich mit einem der Redakteure aus dem Funkhaus einzulassen. Politische Agitation störte sie im privaten Bereich. Zu allem Unglück hatte sich der erste Kandidat, bei der täglichen Arbeit ein besonders scharfer Genosse, unerwartet als westlicher Provokateur entpuppt, der seine Agentenausbildung in britischer Kriegsgefangenschaft verheimlicht hatte. Ihr hatte das einigen Ärger eingebracht. Der zweite, ein ausnehmend schöner Mann, um den alle Frauen sie beneideten, hatte sich im Endeffekt als einer von den vielen Homosexuellen im Hause erwiesen und wollte die Beziehung zu einer Frau als Tarnung nutzen.
Allen schlechten Erfahrungen zum Trotz wäre Hildegund mit ihrem Leben zufrieden gewesen, hätte sich Zufriedenheit überhaupt unter den von ihr erwogenen Möglichkeiten menschlicher Existenz befunden. Sie war ein von Natur aus kritischer Mensch, der nicht zu viel von den eigenen und noch weniger von den Leistungen und Fähigkeiten anderer hielt. Glücklicherweise hinderte ihre Intelligenz sie daran, sich diesbezüglich zu äußern. Im jahrelangen engen Zusammenleben mit einer starrsinnigen Mutter war es ihr gelungen, ihre Schweigsamkeit so weit zu vervollkommnen, dass man sie allgemein für zurückhaltend, ja beinahe schüchtern hielt. Als eine nicht mehr ganz junge, stets wie aus dem Ei gepellte, dezent geschminkte und sorgfältig frisierte junge Frau hinterließ sie überall den allerbesten Eindruck. In normalen Zeiten wäre sie längst als Mutter schulpflichtiger Kinder mit anderen Gedanken beschäftigt gewesen. Aber die Zeiten waren, sieben Jahre nach Kriegsende, in ihren Augen keineswegs als normal anzusehen.
Anders als ihr armer Vater, der in den Weiten Russlands verschollen blieb, hatte sie den Krieg leidlich überstanden. Als 25-jährige Nachrichtenhelferin mit Fernschreibpraxis, mit guten Schreibmaschinenkenntnissen also, besaß sie keine schlechte Ausgangsposition für einen Neuanfang. Das bisschen Steno flog ihr beinahe zu. Die kränkelnde Mutter hatte den Nahrungsmangel und den kalten Winter ’47 nicht überstanden und ihr die schlicht eingerichtete Wohnung der einstigen Familie in der Palisadenstraße hinterlassen: Stube und Küche im Hinterhof, immerhin mit Innentoilette. Das war keine erstklassige Adresse, doch sehr viel mehr, als andere junge Frauen ihr Eigen nannten. Wohnraum war knapp in Ost und West. Von den Neubauten an der Stalinallee erwarteten bloß Aktivisten des Nationalen Aufbauwerks und sächsischsprechende Funktionäre eine Verbesserung. Hildegund stand der Sinn nicht nach freiwilligen Aufbaustunden, wenn sie abends todmüde nach Hause kam.
Dass ihr die Wohnung noch zu einem ganz anderen Vorteil gereichen würde, hätte sie nicht erwartet, als sie sich vor drei Jahren auf den Rat einer Bekannten hin beim Berliner Rundfunk bewarb. Dessen Generalintendanz befand sich im alten Goebbels-Ministerium am Kaiserhof, der jetzt Thälmannplatz hieß, die Personalabteilung saß nicht weit entfernt, in der Friedrichstraße. Dort empfing sie ein finster wirkender, dunkelhaariger Mann unbestimmten Alters, dessen durchdringender Blick sie irritierte. Erst als sie den Beruf des Vaters – der war Maurer – angab, wurde seine Miene wohlwollender und hellte sich bei ihrer Adresse endgültig auf. «Wir brauchen dringend junge Arbeiterkader aus dem Osten», äußerte er mit dem rollenden R des Sudetendeutschen, und damit war sie eingestellt.
Es war ein bemerkenswertes Unternehmen, in das sie da geriet. Berliner Rundfunk und Deutschlandsender residierten als Deutscher Demokratischer Rundfunk unter sowjetischem Schutz im Funkhaus der ehemaligen Reichsrundfunkgesellschaft in Charlottenburg und damit im britischen Sektor von Berlin. Vor dem ansehnlichen Klinkerbau an der Masurenallee verkündeten nicht zu übersehende Tafeln: Achtung! Dies ist kein Westberliner Sender! Dennoch führten alle Kabel aus dem Funkhaus in den amerikanischen Sektor nach Schöneberg, zum Verstärkeramt in der Winterfeldtstraße, wo sich bis 1948 die RIAS-Studios befunden hatten. Damals hatten die Sendeanlagen noch in Tegel im französischen Sektor gestanden.
Einen eigenen Rundfunksender besaß die von den Westmächten gepäppelte Insel im roten Meer, sah man vom amerikanischen RIAS ab, nicht. Der Nordwestdeutsche Rundfunk NWDR betrieb im Haus der Zahnärzte am Heidelberger Platz ein bescheidenes Studio und weit hinter dem Olympiastadion einen schwachen Sender, der kaum über West-Berlin hinausdrang. Aus der Ribbentrop-Villa in der Dahlemer Podbielskiallee erfreute der AFN des American Forces Network die amerikanischen Soldaten und eine jugendliche deutsche Hörerschar in Ost und West mit der Musik, die sie wirklich hören wollten. In der Masurenallee lagerte Derartiges als «imperialistisch verseucht» im Giftschrank.
Zu Hause in ihrer düsteren Hinterhofstube bevorzugte Hildegund wie die meisten ihrer Nachbarn den RIAS. Das Programm fiel allemal unterhaltender und informativer aus als die dröge Propaganda aus der Masurenallee. Bei flotter Musik erfuhr man, was im Westen, vor allem aber, was im Osten wirklich passierte, und montags hörte alle Welt die Schlager der Woche. Das West-Berliner Radiokabarett Die Insulaner mochte Hildegund nicht so sehr, die populäre Unterhaltungssendung Mach mit dafür umso mehr. Die versuchten die östlichen Betriebsabende vergebens zu übertreffen.
Dass die RIAS-Kommentare genauso giftig klangen wie diejenigen, die sie täglich zu tippen hatte, störte Hildegund kaum. Es überraschte sie nur immer wieder, dass der Westen nichts Ernsthaftes gegen die feindselige Stimme in der eigenen Stadthälfte unternahm. Umgekehrt hätten die Russen sich das vermutlich nicht so lange gefallen lassen. Im Haus wurde viel darüber gemunkelt, wie lange das noch gutgehen würde. Die Übertragungstechnik war bereits in den Ostsektor umgesiedelt. Vor einigen Tagen hatte man in einer Nacht- und Nebelaktion auch den größten Teil des Musikarchivs in den Osten transportiert. Unter strengster Geheimhaltung natürlich, doch Hildegund besaß, wenn es darauf ankam, ein gutes Gehör. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass die Unzahl von Tonbändern in dem kleinen Funkhaus in Grünau Platz finden sollte. In das ehemalige Bootshaus draußen an der Dahme musste sie von Zeit zu Zeit vertrauliche Materialien bringen.
Wie der hauseigene Mundfunk meldete, war man seit einem Jahr irgendwo in Ost-Berlin dabei, ein neues Funkhaus einzurichten, zu dem West-Berliner keinen Zutritt haben sollten. Das wiederum glaubte Hildegund nicht, wohnten doch viele Schauspieler und Regisseure und fast alle Musiker seit eh und je im Westen der Stadt. Zu einem Umzug in den Osten würde sich kaum einer von denen überreden lassen.