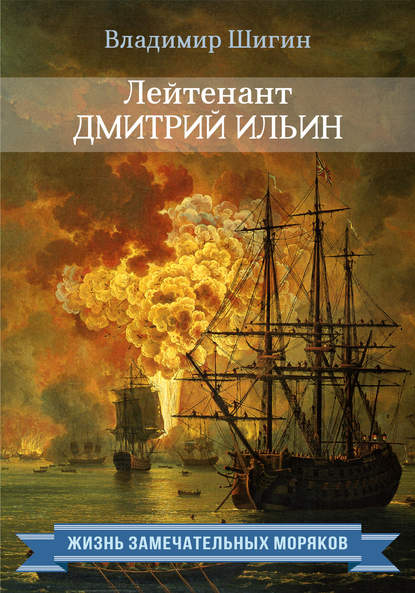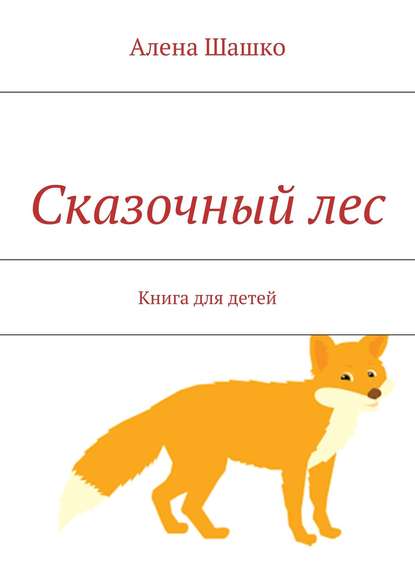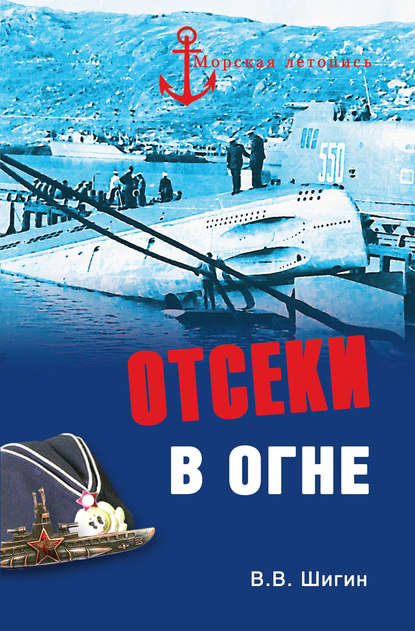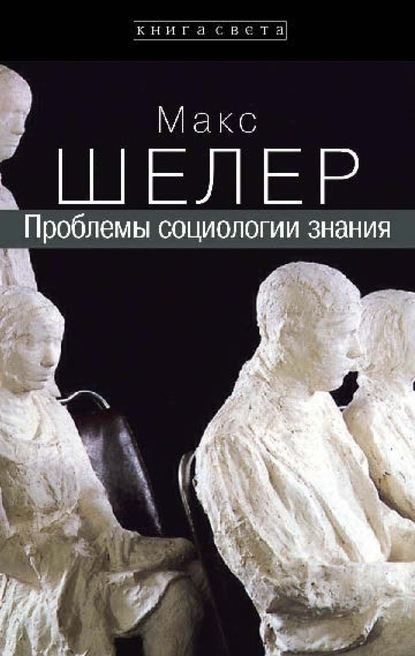Verhängnis in der Dorotheenstadt
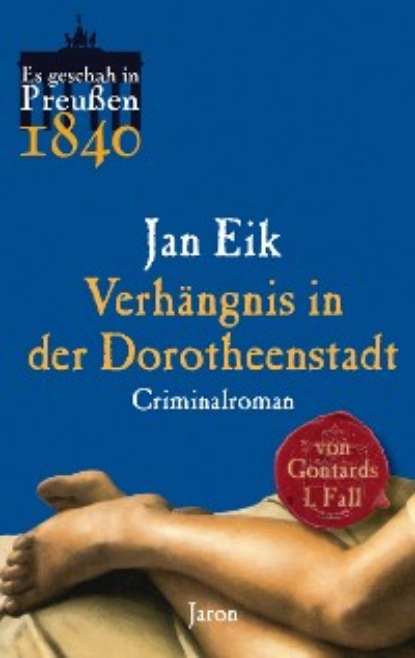
- -
- 100%
- +
Auch mit diesem historischen Vorfall hatte sich der Enkel ernsthaft beschäftigt, dabei aber keine Spuren crimineller Machenschaften entdecken können. Christian Philipp war bei allem romantischen Interesse für Ereignisse ungewöhnlicher Art ein nüchtern und rational denkender Mensch, der seine Berufung darin gefunden hatte, die künftigen preußischen Artillerie-Offiziere in der Kunst ihrer Waffen und in der Ballistik zu unterrichten. Dass der Umgang mit dem Pulver gewisse gefährliche Besonderheiten aufwies, war ihm nicht unbekannt. Häufig referierte er vor seinen Schülern über die Explosion des alten Pulverturms am Spandauer Thor, bei der im August 1720 insgesamt 72 Personen den Tod gefunden hatten und der König selbst nur durch eine gottgewollte Verspätung mit dem Leben davongekommen war.
Ob es sich tatsächlich um eine göttliche Vorsehung - immerhin war die Garnisonkirche samt Schule zerstört worden - oder um eine höchst irdisch vorbereitete Verzögerung gehandelt hatte, war ihm bei aller Mühe nicht gelungen herauszufinden. Der Soldatenkönig war alles andere als eine beliebte Persönlichkeit gewesen.
Derlei ketzerische Erwägungen erwähnte Gontard niemandem gegenüber. Er war ein königstreuer Offizier und klug genug, nicht wider den Stachel zu löcken. Das überließ man besser den Burschenschaftern und anderen Feuerköpfen, denen sich die politische Polizei mit all ihren Spitzeln und Zuträgern und am Ende das Untersuchungsgericht in Köpenick widmeten. Nicht mehr lange, wie man allgemein hoffte.
Es klopfte an der Tür, und ohne eine Antwort abzuwarten, schob sich seine Wirtschafterin Madame Koblank ins Zimmer, eine resolute Person unbestimmbaren Alters und ebenso unbestimmter Haarfarbe und -tracht. Sie hatte nicht mit seiner heutigen Rückkehr gerechnet. »Jewiss jedenken der Herr Major noch auszujehn?«, vergewisserte sie sich. »Sonst müsste ick zum Abendbrot leider was aus’n Jasthof holen …«
Nach dem langen Ritt fühlte sich Gontard eigentlich nicht in Stimmung, das Haus noch einmal zu verlassen, doch den Rest des Tages in der tristen Stube zu verbringen, danach stand ihm der Sinn noch weniger. Eine gute Woche Landaufenthalt hatte genügt, seine Leidenschaft für den Glanz und die Freuden der Residenz erneut anzufachen. Er liebte seine Henriette, und sobald er Wutike verlassen hatte, sehnte er sich nach ihr und den Kindern. Denen gegenüber hatte er ein besonders schlechtes Gewissen. Was sollte in dieser ländlichen Einöde nur aus ihnen werden?
Doch all sein Bemühen, Henriette zu einem Umzug in die Stadt zu bewegen, scheiterte an ihrer kategorischen Ablehnung. »Du weißt, ich habe es versucht«, so lautete ihr Einwand. »Ich werde krank von all diesem Gerenne und Getue, diesen alltäglichen und allabendlichen Aufregungen. Du hast gewusst, dass du ein einfaches Mädchen vom Land ehelichst …«
Nun, ein ganz so einfaches Mädchen war sie nicht, und ausgehalten hatte sie es mit ihm kaum ein halbes Jahr in Preußens Hauptstadt. Die Familie derer von Herzsprung besaß rings in der Mark umfangreiche Ländereien bis hinauf nach Mecklenburg-Strelitz, und der alte Baron hatte seinen drei Töchtern wie den sechs Söhnen eine wahrhaft fürstliche Erziehung angedeihen lassen. Dennoch war eines der Mädchen früh ins Kloster gegangen und die Älteste unlängst im Gefolge eines Musikers zweifelhafter Herkunft gen Italien verschwunden. Aus dem Bruder Heinrich war ein bigotter Pfaffe geworden, der seinem Sprengel in der nahen Spandauischen Vorstadt mit pietistischer Sittenstrenge vorstand und überdies zu Gontards Ärger dazu neigte, jeden Schritt seines ungeliebten Schwagers Christian Philipp zu überwachen, moralisch zu bewerten und nach Wutike zu melden.
Nicht etwa, dass Gontard sich etwas vorzuwerfen hatte. Sein ungebundenes Leben quasi als Junggeselle brachte eben die eine oder andere Anfechtung mit sich, der er sich nicht in jedem Falle entzog. Für Heinrich jedoch galten bereits der bloße Aufenthalt in einer der Berliner Conditoreien als verwerflich, das Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke als Todsünde. Glücklicherweise reagierte Henriette, die in mancher Hinsicht ebenfalls zu gewissen Affektionen neigte, mit Gelassenheit auf Heinrichs Anzeigen. Gontard aber stieg die Röte ins Gesicht, wenn sie ihm lächelnd pikante Stellen aus dessen denunziatorischer Correspondenz vorlas. Es war weniger die Scham vor Henriette als vielmehr die Gewissheit, dass derlei auch im schwarzen Postkabinett aufmerksam gelesen und vermerkt wurde und dem Fortkommen eines preußischen Offiziers kaum förderlich sein konnte.
Vielleicht würde sich das jetzt ändern. Seit dem Tod des alten Monarchen sprach man allerorten davon, und auch heute Abend würde es in den Cafés und Tabagien, in den billigen Bierschwemmen wie den vornehmen Stadtpalais kaum ein anderes Gesprächsthema geben. Am 21. September war Friedrich Wilhelm IV. mit seiner Elise durch eine reichgeschmückte Triumphpforte in die Stadt eingezogen, für den kommenden Donnerstag waren die Huldigungsfeierlichkeiten für den neuen Herrscher angesagt.
Erst jetzt merkte Gontard, dass Minna Koblank seit mindestens fünf Minuten von nichts anderem schwatzte als von ebendieser Ehrenerweisung für Fritz und Lörchen, wie sie das Königspaar vertraulich titulierte. Er nahm kaum wahr, dass da mancherlei Despektierliches in ihrem Redefluss dahinplätscherte, vermutete sie doch, dass der neue König sich vor den Anstrengungen der Festlichkeit mit einem kräftigen Trunk stärken würde, wie es nun einmal seine Art sei. »Der Butt«, so nannte sie ihn mit dem von ihm selbst gewählten Namen, verdanke seinen Leibesumfang gewiss nicht allein dem reichhaltigen Essen bei Hofe.
»Es ist gut, Minna«, sagte Gontard mit einem missbilligenden Unterton, den sie geflissentlich überhörte. »Ich gehe noch aus.« Nach den Tagen in der ländlichen Einsamkeit verspürte er geradezu das Bedürfnis nach einem guten Gespräch. Henriette hatte ihn mit den Nichtigkeiten der Kindererziehung und des Landlebens geplagt, und der fischige Schwager hatte fast immer mit vorwurfsvollem Gesichtsausdruck geschwiegen. Er missbilligte von Gontards fortwährende Abwesenheit und war doch im Grunde seines Herzens beglückt, in Wutike ungestört den Herrn spielen zu können.
Trotz seines Perleberger Misserfolges freute sich Gontard auf einen Abend mit den Herren Alexis - der eigentlich Häring hieß - und Hitzig. Die beiden würde er zu dieser Stunde sicher im roten Salon bei Stehely am Gensdarmen-Markt antreffen. Möglicherweise las dort auch sein Freund, der Mediziner Doktor Friedrich Kußmaul, die ausliegenden Journale. Sein Freund und Kollege Gebhardt Heidenreich verkehrte hingegen eher in Etablissements etwas niederer Kategorie, wo er dem Trunke in den letzten Monaten ein wenig zu heftig zusprach und außerdem sicher sein konnte, unter den Studenten der Universität oder des eigenen Bildungsinstituts eine halbwegs aufmerksame Zuhörerschar zu finden. Vielleicht aber, und das schien wahrscheinlicher, hockte Heidenreich wieder einmal über seinen Experimenten und hatte Raum und Zeit und hoffentlich auch den Alkohol vergessen. Gontard war sicher, dass irgendein stiller Kummer Heidenreich plagte, doch wenn es um Persönliches ging, verschloss der sich selbst dem engen Freund gegenüber wie eine Auster.
Irgendwann wird es noch einmal ein böses Ende mit ihm nehmen, dachte Gontard besorgt, während er sich für den Abend umzog.
Fünf
Dabei war zu diesem Zeitpunkt keineswegs vorauszusehen, dass es mit Gebhardt Heidenreich einmal ein schlimmes Ende nehmen würde. Nur Albertine Knoppe, die ebenso tugendhafte wie neugierige Tochter seiner Wirtsleute, prophezeite es ihm mitunter im halben Ernst, wenn sie den Staub zwischen seinen Gerätschaften zu beseitigen versuchte und dabei wie von unsichtbarer Hand von einem Schlag getroffen wurde, der auf seltsame Weise ihren ganzen Körper durchzuckte. Selbst gelb und bläulich knisternde Blitze von beachtlicher Länge waren ihr schon begegnet in der zugigen Mansarde direkt neben ihrer Schlafkammer, die Heidenreich für seine eigenwilligen Machenschaften nutzte. Dennoch hatten alle Verbote des jungen Gelehrten, irgendetwas zu berühren, seine verstreuten Papiere zu ordnen, ja sein Laboratorium überhaupt zu betreten, nicht gefruchtet. Allein der Anblick der blinkenden Kupferapparaturen, denen diese unheimliche Wirkung innewohnte, lud förmlich zur Berührung ein. Wie unter Zwang gab Albertine immer wieder ihrer Wissbegier und dem von der Mutter ererbten Ordnungstrieb nach.
Ansonsten verhielt sie sich so achtungsvoll zu dem jungen Mann, wie es sich gehörte, zumal Heidenreich nicht dazu neigte, sich in irgendeiner Form ungebührlich zu benehmen. Da hatte Albertine mit gewissen Studenten, die im Knoppe’schen Hause in der Mittelstraße zur Miete gewohnt hatten, ganz andere Erfahrungen machen müssen.
Umso mehr schätzte sie den zurückhaltenden jungen Menschen, der sie immer ein wenig geistesabwesend durch seinen Kneifer betrachtete, als blicke er durch sie hindurch. Sie empfand eher schwesterliche Gefühle für ihn, ja, sie neckte ihn mitunter absichtlich, um ihn ein wenig aufzuheitern. Seit einer ebenso heimlichen wie unglücklichen Liebesaffäre mit einem adligen Fräulein, an der sie infolge der durch ihre Hände gehenden Post wie dank Heidenreichs spärlichen Andeutungen innigen Anteil genommen hatte, schien ihr das nötig. Zu tief nistete der eigene Kummer in ihr, hatte sie sich doch vor vier, fünf Jahren sterblich in einen blondlockigen Studenten der Philosophie verliebt, der ihre Neigung bald auf das Heftigste erwiderte, sich dadurch jedoch nicht von seinen gefährlichen politischen Umtrieben abbringen ließ und schließlich Hals über Kopf das Weite suchen musste, wollte er nicht wie die 165 anderen Burschenschafter vom Kammergericht zu einer lebenslangen Haftstrafe oder gar zum Tode verurteilt werden.
Sie wusste nicht einmal, ob ihrem Ludwig die Flucht wirklich gelungen war. Noch immer hatte sie die Hoffnung nicht aufgegeben, die unregelmäßig einlaufende Post würde ihr eines Tages endlich eine Nachricht aus seiner Hand bescheren. Andererseits ängstigte sie der Gedanke, eine solche Botschaft aus dem Ausland könnte im gefürchteten schwarzen Postkabinett bemerkt und aufgehalten werden, worauf sie und der Vater mit einem unangenehmen Polizeibesuch rechnen mussten.
Auch der junge Doktor Heidenreich neigte gelegentlich zu unbedachten Äußerungen über die Obrigkeit. Oder vielmehr zu wohlbedachten, denn er wusste sich stets geschickt herauszureden. Dennoch war und blieb er in Albertines Augen ein echter Gelehrter, ein wenig weltfremd und dadurch in mancherlei Hinsicht gefährdet. Allzu oft hatte sie ihm in letzter Zeit zu später, mitunter sogar zu frühester Stunde die Haustür geöffnet, worauf er mit ihrer Hilfe hinauf in seine Stube im zweiten Stock gestolpert war. Albertine bezweifelte, dass ihn der im Übermaß genossene Branntwein auf die Dauer über den Liebeskummer hinwegtrösten würde, und sie argwöhnte, dass er sich im trunkenen Gespräch zu unbedachten Bekenntnissen würde hinreißen lassen.
Außerdem belästigte das nächtliche Gepolter die Hausbewohner, insbesondere ihren Vater August Knoppe, der vor dem Königsthor eine nicht eben üppig florierende Cichorienfabrik betrieb, die sein frühes Aufstehen erforderte. Ihm gehörte das einst solide, inzwischen ein wenig heruntergekommene Haus mitten in der Neustadt, das sich nahezu seit deren Gründung im Familienbesitz befand.
Früher hatte Albertines Mutter Martha Knoppe, die aus Heidenau bei Dresden gebürtig und dem Dialekt der sächsischen Heimat noch immer verfallen war, das Haus und den Garten dahinter gepflegt und sogar einen Mittagstisch für die Herren Studenten unterhalten. Seit einigen Jahren aber folgte sie jeden Morgen ihrem Mann in die Fabrik und überließ der Tochter die Hausarbeit und allen Kummer mit den Mietern und der greisen Großmutter, die im zweiten Stock das vordere Zimmer zur Straße bewohnte. Das erste Geschoss hatte einige Monate leer gestanden, ohne dass der Vater sich bereit gefunden hätte, den Mietpreis herabzusetzen oder die Stuben an einzelne Studenten zu vermieten. Er sollte recht behalten. Gerade erst war es der Mutter gelungen, einem aus süddeutschen Landen zugereisten Mediziner die Beletage mit allen Nebenräumen zu einer ansehnlichen Jahresmiete zu überlassen.
Albertine hatte sogleich einen guten Eindruck von dem Doktor Henricus Bächerle gewonnen, einem dunkelhaarigen, nicht unansehnlichen Mann von aufrechtem Wesen und Blick, dessen Barttracht die Einschätzung seines wahren Alters ebenso erschwerte wie seine wohlgesetzte Redeweise. Alt war er jedenfalls nicht, wie sie ihrem heimlichen Schützling Heidenreich mitzuteilen wusste, der sich jedoch noch nie für die häuslichen Mitbewohner interessiert hatte. Nicht einmal für den prinzlichen Vorreiter Eginhard Spielvogel, der mit seiner totenblassen Frau Elise und drei kränkelnden Kindern in der Stube neben ihm hauste und den Albertine für einen obrigkeitlichen Ohrenbläser hielt. Sie traute ihm und seiner stillen Frau nicht über den Weg.
Heidenreich focht das nicht an, wenn er Albertine gelegentlich mit gewissen Hohenzollern-Histörchen unterhielt, denen sie mit brennenden Ohren lauschte, den Erzähler jedoch inständig anflehte, ja vorsichtig mit solcherlei Äußerungen über das geliebte Herrscherhaus umzugehen.
Heidenreich stieß darauf, je nach Stimmung, nur ein unwilliges Schnauben oder ein höhnisches Lachen aus, mäßigte aber gewöhnlich seine Stimme. Seiner Ansicht nach schien die allgemeine Demagogenriecherei und -fresserei seit dem Tode des alten Königs ein wenig nachgelassen zu haben, wovon man allerdings in der Artillerieschule kaum etwas merkte. Zu viele der alten Kalkköpfe gaben hier immer noch den Ton an, von denen Heidenreich der stockreaktionäre Oberst-Lieutenant Aemilius von Elster, genannt von Streyth, gleich aus mehreren Gründen so verhasst war, dass sogar Albertine der Name geläufig war und sie Heidenreichs tiefe Abneigung teilte, obwohl sie den fraglichen Offizier gar nicht kannte.
Heute war Heidenreich früh aus der Artillerieschule heimgekehrt und hatte den verregneten Nachmittag in der kalten Mansarde verbracht. Als Albertine sich gegen Abend entschloss, ihm ein wärmendes Getränk zu kredenzen, stand sie lange lauschend vor der Kammertür, hinter der Heidenreich seltsame Laute ausstieß, beinahe eine Art Singsang, da-di-di-da-di-da … in vielerlei Folgen.
So fröhlich hatte sie ihn lange nicht erlebt, und so öffnete sie entschlossen die Tür, fand ihn jedoch mit gewohnt ernsthafter Miene am Tisch hockend vor, auf dem er mit der Hand zum Gesang passende Rhythmen schlug.
»Sind Sie nunmehr auch noch unter die Komponisten gegangen?«, erkundigte sich Albertine mit jener Mischung aus Spaß und Respekt, die sie sich im Gespräch mit ihm öfter erlaubte.
Heidenreich schüttelte den Kopf. Seine blonde Haarmähne, die sie so schmerzlich an ihren Ludwig erinnerte, stand wirr nach allen Seiten. »Ich übe es, eine Meldung zu senden«, erklärte er. »Nach einem ganz neuen amerikanischen System. Aber das verstehst du sowieso nicht.«
Da hatte er recht. Von dem, was er hier oben tat, begriff sie leider nie das Geringste, obwohl er sich durchaus bemühte, es ihr zu erklären. Die wenigen Jahre in der Parochialschule hatten gerade genügt, ihr neben der Religion ein wenig Lesen und Schreiben zu vermitteln. Rechnen hatte sie der Vater gelehrt.
Weshalb Heidenreich unbedingt und angeblich in Windeseile irgendeine Nachricht nach Paris senden wollte, blieb ihr unklar. Waren die Franzosen nicht noch immer Feinde, die zudem eine Revolte gegen ihren eigenen König angezettelt hatten?
»Es könnte ebenso gut Königsberg oder meinetwegen Stuttgart sein«, berichtigte Heidenreich sie geduldig.
»Wichtig sind ausschließlich die weite Entfernung und die hohe Geschwindigkeit.«
Das half ihr nicht weiter. Eine größere Entfernung als die ins sächsische Heidenau, wo sie einmal die Großmutter besucht hatte, vermochte sie sich nicht vorzustellen, und was die Geschwindigkeit anging, so bereiteten bereits galoppierende Pferde ihr Unbehagen. Die neue Eisenbahn nach Potsdam, die sie nur bei der Bahnhofsausfahrt gesehen hatte, fuhr unterwegs angeblich noch rascher. Und im Tivoli am Kreuzberg, wohin Ludwig sie einmal ausgeführt hatte, waren sie mit einer geradezu ungeheuerlichen Geschwindigkeit die glatte Bahn hinuntergeglitten. Mit Schaudern, aber nicht ohne eine gewisse Sehnsucht erinnerte sie sich daran, wie Ludwig sie mit seinen starken Armen fest umklammert gehalten hatte.
Heidenreich schlürfte inzwischen dankbar die dunkle Flüssigkeit in sich hinein. »Schmeckt beinahe wie echter Kaffee«, brummte er, was im Hause eines Cichorienfabrikanten als ein zweifelhaftes Lob gelten mochte. Albertine registrierte es ohne Empfindlichkeit. Scherze über das wenig geschätzte und doch so ausgiebig genutzte Produkt aus der Brennerei des Vaters begleiteten sie seit ihren frühesten Kindertagen. Selbst Ludwig hatte seinen gutmütigen Spott damit getrieben und behauptet, es enthielte ohnehin ein Gutteil verfälschender Beimengungen wie Beinschwarz oder gar Steinkohlenpulver. Empört hatte der Vater derlei Verdächtigungen von sich gewiesen.
Albertine war der Duft der gebrannten Unkrautwurzel ebenso vertraut wie unangenehm. Sie bevorzugte die poetische Bezeichnung Sonnenwirbelwurz, aber auch die machte das Produkt aus dem gemeinen Wegwart kaum sympathischer.
Glücklicherweise befand sich die Knoppe’sche Brennerei nicht wie andere Gewerbe im Hof des eigenen Hauses, und das keineswegs aus Platzgründen. Die scharf gebrannten, zu Haufen aufgeschütteten oder in Fässern eingestampften Wurzeln entzündeten sich angeblich leicht von selbst, weshalb die Produktion nur außerhalb der Stadtmauern geduldet wurde.
Doktor Heidenreich hatte sich bei ihr nach allen Einzelheiten der Fabrikation erkundigt und auch den Vater eingehend befragt, dann jedoch jegliches Interesse an dem braunen Pulver verloren, das ihm seine tägliche Morgenlabsal lieferte. Dass er ansonsten Wein oder noch stärkere Getränke bevorzugte, war kein Geheimnis. Er stammte schließlich aus dem Süddeutschen, wo der Wein etwas bekömmlicher ausfiel als der heimische Berliner Essigtrunk.
Heidenreich war der hoffnungsvolle jüngste Spross einer im hohenzollernsch-sigmaringschen Ländle alteingesessenen Familie von Feldschern, Handelsleuten und angesehenen Militärs. Er war in jenem Jahr nach Berlin gekommen, in dem zu seiner Begeisterung die erste Lokomotive einen Zug ins nahe Zehlendorf und wenig spatter bis nach Potsdam gezogen hatte. Zwar hatte man die erste Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth erbaut, doch erst die riesigen Flächen und Entfernungen im erstarkenden Preußen ließen ahnen, wo die Zukunft für das neue Verkehrsmittel zu erwarten war. Inzwischen baute man eine Strecke ins Anhaltinische, Schienenpaare nach Stettin und Hamburg würden folgen.
Dennoch war es nicht die Eisenbahn, die das Interesse des jungen Wissenschaftlers in erster Linie fesselte. Seine wahre Berufung sah er in der Erforschung jener geheimnisvollen Kraft, die gewissen Elementen und Stoffen unsichtbar innewohnte, der Elektrizität. Seine außergewöhnliche Begabung für alles Verstandesmäßige, am besten mathematisch oder physikalisch Erfassbare, hatte ihm früh die Abneigung seiner geistlichen Mentoren eingebracht, ihm dessen ungeachtet jedoch zu einem baldigen Universitätsstudium verholfen. Da die württembergische Eberhardo-Carolina zu Tübingen in den Naturwissenschaften lediglich eine medizinische Laufbahn eröffnete, war er nach Freiburg und Jena und schließlich nach Göttingen gewechselt, ohne dort indes so tief in die Geheimnisse der Physik einzudringen, wie er es sich vorgestellt und gewünscht hatte. Nicht zu Unrecht bezweifelte er, dass einer der Herren Professoren - vom großen Gauß einmal abgesehen - nur annähernd den wissenschaftlichen Gehalt seiner eingereichten Doktorarbeit über den Aufbau und das Verhalten elektrischer Felder unter atmosphärischer Beeinflussung zu erfassen in der Lage war. So musste er sich mit einem flauen cum laude als Bewertung zufriedengeben.
Rastlos war Gebhardt Heidenreich durch die im Deutschen Bund vereinten Lande gezogen. Das junge, erst von Napoleon geschaffene Königreich Württemberg reizte ihn so wenig zum Bleiben wie das enge Großherzogtum Baden. Viel freier fühlte er sich im protestantischen Norden, wo sich in den Manufacturen der großen Städte nüchterner Geschäftssinn mit technischem Interesse zu paaren begann. Hier, so durfte er träumen, würde es ihm gelingen, wenigstens einige der Ideen, die in seinem Kopf herumspukten, in die Wirklichkeit umzusetzen.
Seit ein gewisser Simon Ohm die Abhängigkeit der Stärke des elektrischen Stromes von den elektromotorischen Kräften und dem in der galvanischen Kette vorhandenen Widerstand entdeckt und in einem Gesetz formuliert hatte, gab es für Heidenreich kaum Wichtigeres, als beinahe Tag und Nacht im Laboratorium herumzuwerken und zu experimentieren. Insbesondere fesselten ihn alle Mitteilungen über Versuche, Nachrichten mittels elektrischen Stroms schnell und über größere Entfernungen zu befördern. Der optische Telegraph, dessen windmühlenartige Flügel den Turm der Sternwarte neben der Universität zierten, war nur ein bescheidener Anfang. Immerhin konnte eine Nachricht nach Paris den Zielort im Verlauf von etlichen Stunden erreichen - kein Vergleich mit dem höchst unsicheren und schleppenden privaten Correspondenzverkehr, von der scharfen preußischen Postkontrolle ganz abgesehen. Die Elektrizität mit ihrer bislang unmessbar hohen Geschwindigkeit würde die Übermittlung von Nachrichten innerhalb von Minuten ermöglichen. Davon träumte Gebhardt Heidenreich insgeheim, wobei er die Postzensur keineswegs vergaß. Die würde in jedem Falle mitlesen.
Fasziniert hatte er zur Kenntnis genommen, dass von dem Amerikaner Samuel Morse in New York das Modell eines Drucktelegraphen aufgestellt und in Funktion gesetzt worden war. Sein erklärtes Ziel bestand darin, ein ähnliches System zur zuverlässigen elektrischen Nachrichtenübermittlung zu konstruieren. Da es sich bei einer solchen Apparatur ausschließlich um den Bedarf für militärische Belange handeln konnte, fühlte Heidenreich sich als ziviler Lehrer wie als Erfinder an der Artillerie- und Ingenieurschule durchaus am rechten Platz.
Bis 1816 hatte in Berlin nur eine allgemeine Kriegsschule mit einer kaum den Ansprüchen einer modernen Armee genügenden Ausbildung existiert. Erst die Freiheitskriege und die damit für wenige Jahre verbundene Zeit der Reformen hatten die längst notwendige Gründung einer speziellen Artillerieschule und wissenschaftlichen Ausbildungsstätte für die Ingenieur-Offiziere begünstigt. Neben einigen alten Starrköpfen waren fähige Lehrkräfte herangezogen worden. Selbst der von Heidenreich so verehrte Simon Ohm hatte an der Kriegsschule gelehrt, und sein Bruder, der Mathematiker und Universitätsprofessor Martin Ohm, gehörte zu Heidenreichs Beglückung zum Kollegium der Artillerieschule.
Mit dessen Hilfe gedachte sich Heidenreich in der Mathematik zu vervollkommnen. Nicht weniger glücklich stimmte ihn die Feststellung, dass sein Kollege Christian Philipp von Gontard seine Leidenschaft für die Physik, wenn auch nicht im gleichen Maße für die elektrische Telegraphie, mit ihm teilte.
Mit dem nur wenig älteren Major von Gontard, der ihn um mehr als Haupteslänge überragte und dem es dennoch im Gegensatz zu fast allen anderen adligen Offizieren an jeglichem Hochmut oder gar Standesdünkel gebrach, verstand sich Heidenreich in den letzten Monaten immer besser. Manchmal verbrachten sie Stunden und Tage miteinander in dem Kellerraum der Schule, den der Director Heidenreich mit einem anzüglichen Lächeln zur Verfügung gestellt hatte. Wie viele Offiziere des Lehrkörpers glaubte er nicht recht an jene wundersame Kraft, die den komplizierten Versuchsaufbauten der beiden Enthusiasten innewohnen sollte. Selbst den schmerzhaften Schlag, der seine entgegen Heidenreichs dringender Warnung zwischen zwei Kupferplatten gehaltene Hand getroffen hatte, war er geneigt, für einen Taschenspielertrick des Physikers zu halten.
Neben der Physik, die sie im Geiste vereinte, begünstigte ein weiterer Umstand die enge und bald auch freundschaftliche Beziehung zwischen Heidenreich und Gontard. Sie tolerierten gegenseitig die außerphysikalischen Vorlieben des jeweils anderen: Heidenreich die Passion des Majors, sich für die Aufklärung von Verbrechen zu interessieren, an denen es in der königlich preußischen Residenz nicht mangelte - von Gontard hingegen Heidenreichs geradezu manische Schwäche für die Genealogie des Hohenzollerngeschlechts. Dass es darin mancherlei dunkle und aufklärenswerte Punkte und Fehltritte gab, bestritt Gontard nicht, teilte jedoch Heidenreichs Leidenschaft für die illegitimen Verzweigungen und nachträglich geadelten Seitenlinien des Königshauses nicht.