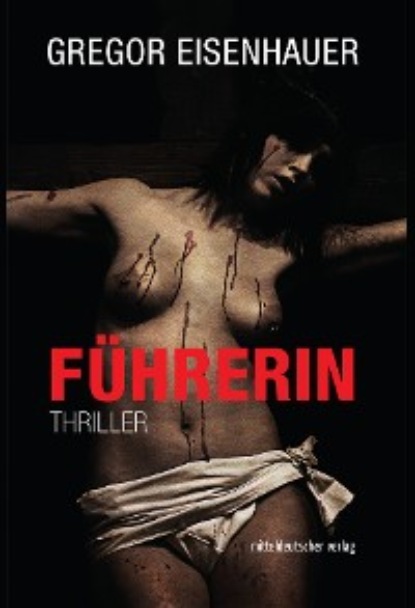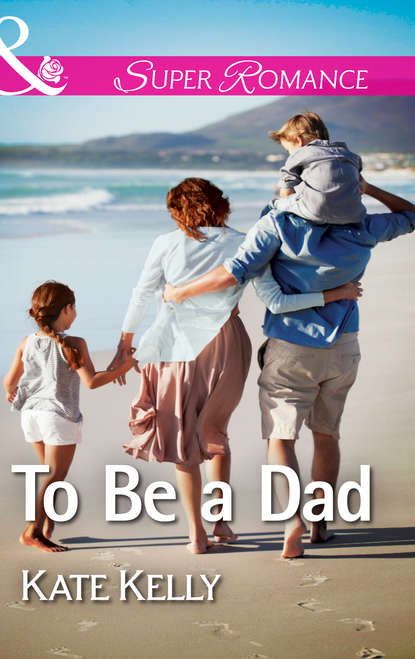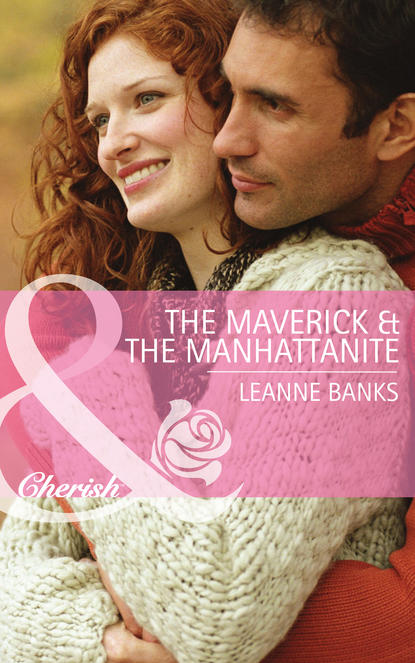- -
- 100%
- +
«Hier, wie immer am äußersten Rand, seinen langen Beinen zuliebe, Signore Othello. Und wie immer ganz in Schwarz gekleidet! Ein Held der unveräußerlichen Gewohnheiten!»
Klimt hüstelte, als hätte er sich an einer Fischgräte verschluckt.
«Wilson, Ihre Witze bringen mich noch mal ins Grab!»
«Ich fürchte, das steht nicht in der Macht meines Humors! Signore Othello bereitet im Übrigen die Publikation einer neuen Kampfschrift gegen Sie vor, Auszüge kursieren bereits im Internet, eine Lektüre erübrigt sich, er verharrt auf dem Niveau seiner untalentiertesten Studenten.»
Martin Moses war wegen wiederholter sexueller Belästigung von Studentinnen wie Studenten unehrenhaft entlassen worden, und zwar ausgerechnet in jenem Monat, als Klimt drei Gastvorträge in Berkeley hielt. Moses vermutete einen Zusammenhang, welcher genau, war ihm selbst unergründlich, und so bezichtigte er Klimt zunächst einmal des Ideenklaus. Eine absurde Unterstellung, die auch nie ernsthafte Diskussionen ausgelöst hatte. Was ihn, den universitären Stalker dennoch so gefährlich machte, war, dass er die Treibjagd der Presse gegen ihn seit geraumer Zeit schon in eine Hexenjagd gegen Klimt wenden wollte, indem er immer neue Enthüllungen über dessen Sexualgewohnheiten ins Netz stellte, gern auch mit gefälschtem Bildmaterial oder gekauften Zeugenaussagen, was zuweilen schon sehr ernsthafte Auseinandersetzungen mit den uneinsichtigen Ermittlungsbehörden diverser Gastländer ausgelöst hatte.
«Es ist kein Spaß, in jedem neuen Land mit einem anderen Sexualdelikt konfrontiert zu werden. Seine Fantasie scheint da keine Grenzen zu kennen. Nur weil er sich als Täter vergessen machen will … Was für ein Waschweib! Sorgen Sie für seine Ausweisung! Gerne auch mit pikantem Bildmaterial. Das wird doch hier in Berlin nicht so schwer sein!»
Klimt verzog angewidert den Mund. Er empfand es geradezu als persönliche Beleidigung, dass ihm Martin Moses noch immer eine sexuelle Regsamkeit zutraute.
«Wir sollten den deutschen Behörden zudem einen Tipp geben, was seinen Drogenkonsum anbelangt. Vielleicht beschleunigt das Othellos Heimreise!»
Wilson hatte es sich angewöhnt, den Intimfeinden seines Chefs Namen aus Shakespeares Dramen zu geben. Klimt fand das nicht sonderlich witzig, aber er musste zugeben, es nahm den Figuren ein wenig von ihrer Bedrohlichkeit. Mit einem abschätzigen Lächeln musterte er das Standbild. Verstreut im Zuhörerraum saß ein weiteres Dutzend «Gewohnheitsspinner», die ihn mit Hass-Mails rund um den Globus verfolgten.
«Fast schon ein Familientreffen. Kein neues Gesicht dabei, schade, aber das war ja auch nicht zu erwarten!»
«Unser eigentlicher Gegner», Wilson ignorierte Klimts kokettes Aufseufzen und zeigte auf einen leger am Rand sitzenden älteren Herrn mit Fliege, «hält sich wie immer diskret im Hintergrund. Shylock, alias Ludwig Müller von Hausen, Generalssekretär der ‹Humanistischen Liga›. Ich vermute, er wird in den nächsten Tagen an Sie herantreten und Sie sehr höflich bitten, auf den zweiten Teil des Vortrages zu verzichten.
«Was wissen wir über von Hausen exakt?»
Wilson klappte sein Notebook auf und tänzelte mit den Fingern über die Tastatur. Er bildete sich viel darauf ein, das nahezu geräuschlos tun zu können, was Klimt nur ein verächtliches Schnaufen abnötigte.
«Warum ist von Hausen gefährlich? Er hat über alle Mächtigen dieser Stadt ein Dossier angelegt. Politiker, Wirtschaftsbosse und Kriminelle. Wer in Berlin etwas zu sagen hat, ist in seiner Datenbank.»
«Wir auch? Haben wir auch Zugriff auf diese Datenbank?»
«Selbstredend!» Wilson hüstelte selbstzufrieden. «Aber das ist nebensächlich, insofern dieses provinzielle Surrounding hier in Berlin für uns nicht weiter von Interesse ist. Wichtiger, brisanter sind von Hausens internationale Kontakte. Er ist, dank der von ihm gegründeten D’Annunzio-Gesellschaft, bestens vernetzt mit der italienischen Mafia. Er unterhält rege Kontakte zu der White-Nation-Bewegung in den Staaten, und er kennt dank seiner juristischen Beratertätigkeit für die Stasi-Waffenverkäufer die einflussreichsten Politiker, soll heißen Kriminellen im Nahen Osten. Von Hause aus ist er ein Enkel des berüchtigten SS-Oberführers Hilmar von Hausen, der für seine eigenhändigen Erschießungen von Dutzenden Partisanen den Ehrennamen Bluthund von Batschka erhielt. Hilmar von Hausen gelang seinerzeit die Flucht auf der «Rattenlinie», soll heißen, dank der tätigen Mithilfe des Roten Kreuzes und des Vatikans konnte er nach Paraguay entkommen. Dort verlor sich seine Spur. Vermutlich kehrte er unter anderem Namen zu seiner Familie in die Bundesrepublik zurück. Auffällig ist jedenfalls, dass die keineswegs reichen von Hausens seit Beginn der Fünfzigerjahre einen Chauffeur beschäftigten, der Hilmar von Hausen auffällig ähnlich sah. Die Kriminalpolizei hier in Berlin ging entsprechenden Hinweisen allerdings nie nach. Es bestand kein Fahndungsbedarf.» Klimt schnaufte verächtlich, was Wilson nicht aus der Ruhe brachte. «Hilmars Sohn starb früh. Es hieß, er sei geistig umnachtet gewesen, was man von Ludwig Müller von Hausen nicht behaupten kann – er geriet ganz nach seinem Großvater. Eine eiskalte Intelligenz und ein unbezähmbarer Machtwille. Der Mann ist ein Gegner von Format.»
«Nationalsozialist noch immer?» Klimt schien nicht sonderlich beeindruckt, aber seine Augen verengten sich hoch konzentriert. «Schlimmer. Ein Nationalsozialist der Zukunft. Was ihn treibt? Schwer zu sagen! Ich fürchte, es ist ein sehr antiquiertes Gefühl von Stolz. Er hasst die Gegenwart, die Moderne schlechthin. Er verachtet die Generation seines Großvaters, weil sie Deutschland in den Abgrund führte. Er nimmt es Hitler persönlich übel, dass Berlin bombardiert wurde. Er möchte nur eins, Rache dafür nehmen, dass ihm persönlich in dieser Zeit nicht die große Bühne bereitet wurde. Ein Achill ohne die trojanische Bühne und ohne Homer!»
«Dieses Gefühl werden die wenigsten nachvollziehen können!»
«Das macht ihn so unberechenbar. Jeder vermutet etwas anderes hinter seinem Tun. Geldgier, Geltungssucht, Fanatismus, nichts von alldem. Er unterstützt die Bewegung nur aus einem Grund: Vernichtungswille. Zwei Kinder, eine Frau, die keinen Hehl daraus macht, dass sie ihn gern und häufig betrügt, was wiederum ihm völlig gleichgültig ist. Dieser Mann ist faktisch unangreifbar … Ihm ist nichts lieb und teuer, sein Ego ausgenommen.»
«Was plant er?»
«Nun ja, Ihre Auslöschung, das versteht sich. Sie sind ihm schon rein körperlich zutiefst zuwider. Die Frage ist nur, wie er es bewerkstelligen will. Ich fürchte, sein Talent zur Grausamkeit steht seiner Fantasie, was den Tathergang betreffen wird, in nichts nach.»
«Wollen Sie mir Angst machen?!»
«Aber sicher! Das lässt Sie hoffentlich ein wenig vorsichtiger agieren! Allzu einfach wollen wir es den anderen ja auch nicht machen!»
«Was tun?»
«Nun, wir haben noch etwas Zeit. Er wird sich mit uns, mit Ihnen treffen wollen. Er wird zu erfahren suchen, was genau Sie alles wissen. Er wird Ihnen drohen, sie zu bestechen versuchen, kurzum ein wenig Katz und Maus mit ihnen spielen, und dann wird er sie töten. Eigenhändig, könnte ich mir vorstellen.»
«Und wir? Was können wir gegen ihn tun?» Klimt wurde ungeduldig, was Wilson noch bedächtiger sprechen ließ.
«Wir können dafür sorgen, dass die Allianz seiner Opfer tätig wird. Die Frage ist nur, ob uns das rechtzeitig gelingt.»
«Die Allianz seiner Opfer?! Geht es ein wenig konkreter?!»
«Nun ja, kein Bürgermeister wird sich gern nachsagen lassen, dass sein liebster Zeitvertreib Nutten und Koks sind, in wechselnder Reihenfolge, kein Gewerkschaftler gibt gern Schwarzgeldkonten zu, kein Vorsitzender der deutschen Industriellenvereinigung will seine Nacktbilder aus den Knabenpuffs in Phuket im Internet veröffentlicht sehen. Von Hausen hat sehr eifrig recherchiert. Das kommt uns zugute. Wir werden uns im präventiven Ermahnen üben.»
«Wie oft hab ich Ihnen schon gesagt, dass mir Ihre affektierte Ausdrucksweise grässlich auf die Nerven geht?!»
«Häufig, sehr häufig. Es ist mir geradezu ein Ansporn! Aber auch wenn Ihnen die Formulierung ‹präventives Ermahnen › nicht zusagt, so sind Sie doch mit dem Vorgehen an sich einverstanden, hoffe ich?»
«Wer soll als Erster auffliegen?»
«Aus politischem Kalkül wie aus persönlichem Empfinden heraus würde ich vorschlagen, dass wir zuallererst das Dossier über den Bürgermeister in Auszügen der Presse zuspielen. Mit einem sorgfältig kaschierten Adressvermerk sozusagen, der die Meute direkt auf die Spur von Hausens bringt. Das wird ihn nicht unschädlich machen, aber doch beschäftigen!»
«Gut, einverstanden.»
«Und nun, zuguterletzt …»
«Mein Liebling, wo ist sie? Ah ja, was für ein entzückendes Audrey-Hepburn-Hütchen! Die Lady hat einfach Geschmack!»
Er zoomte ihr Gesicht heran.
«Ayn, mein Schatz! Très chic wie immer, eine aparte Person. Schade, dass uns das Schicksal zu so unerbittlichen Feinden erklärt hat. Schade, schade!»
Klimt kicherte in sich hinein, was Wilson etwas unruhig auf seinem Sitz hin und her rutschen ließ. Er durchblickte die Beziehung zwischen Ayn Goldhouse und Klimt einfach nicht. Ein Außenstehender hätte denken können, sie wären vor langer Zeit tatsächlich einmal ein Paar gewesen, aber Ayn war gerade einmal Anfang fünfzig, während Klimt seinen siebzigsten Geburtstag nicht mehr erleben würde. Nicht zuletzt, weil Ayn Goldhouse es ihm nicht gönnte. Wilson erschrak ein wenig über die harmlose Formulierung. «Nicht gönnte» war eine lächerliche Verharmlosung. Diese Frau hasste Klimt mit einer Unbedingtheit, mit einer Tiefe des Gefühls, die unweigerlich an das Gegenteil denken ließ. Es war Liebe, nur auf teuflische Art.
Wilson erinnerte sich Wort für Wort an Klimts Erzählung über die erste gemeinsame Begegnung auf einem Charity-Dinner in Boston. Klimt stand in einer Traube aufmerksam lauschender Professoren und monologisierte wie immer über Gottes Tod und das nahende Ende der Welt, da erschien – kurz bevor zu Tisch gebeten wurde – eine Frau in Begleitung zweier mächtiger Leibwächter, die wie fallsüchtige Erzengel hinter ihr dreinstolperten, denn sie eilte mit kleinen festen Schrittchen direkt auf Klimt zu, blieb empört vor ihm stehen, ballte die Fäuste in ihre Hüften und zischte ihn an: «Feigling!»
Klimt blinzelte verwirrt. Er war Beleidigungen gewohnt, aber die waren meist von handfester Art, vor allem hatten sie meist einen guten Grund, aber als Feigling war er sich noch nie vorgekommen und anderen wohl auch nicht.
Die kleine schlanke Frau in dem dunkelroten Designerkostüm lächelte maliziös angesichts seiner Verwirrtheit, genoss sie einen ausgiebigen Augenblick lang, warf einen abschätzigen, aber keineswegs ungnädigen Blick auf Klimts jungen Sekretär und verschwand dann in der Obhut ihrer muskulösen Leibeigenen an den Tisch. Im Lauf des weiteren Abends würdigte sie Klimt keines weiteren Blicks mehr.
Der blieb, nachdem er so abgekanzelt worden war, einige Momente verwirrt stehen, dann fragte er bemüht ironisch: «Wer war das denn? Dschingis Khan in Frauenkleidern?»
«Keineswegs schlecht geraten!», applaudierte ein mageres Männchen mit schwerer Hornbrille, das sich als Soziologieprofessor zu erkennen gab. «Gestatten, mein Name ist Baumann, Norbert Baumann, und Schwerpunkt meines wissenschaftlichen Bemühens ist die neue Religiosität der verarmenden amerikanischen Mittelschicht.»
Klimts Blick gab ihm zu verstehen, dass er bitte schnell auf den Punkt kommen möge, weil er ihm sonst umstandslos den Rücken zudrehen würde. «Und Ayn Goldhouse ist ihr Prophet», setzte der aufgeschreckte kleine Professor eilends hinzu.
«Die Armee der Engel!» Klimts unfehlbares Gedächtnis lieferte ihm die passenden Stichworte, die er schnell zu einer ersten Personenbeschreibung zusammenfassen konnte. «Adoptivkind reicher Eltern, gab sich selbst ihren Vornamen in Bewunderung der Kapitalismuspriesterin Ayn Rand, schart seit Jahren eine Armee fanatisierter Feministinnen und Genderhysterikerinnen um sich, weil sie Gott für eine Frau und die Welt für ihren Fußabstreifer Richtung Himmelsthron hält …»
Klimt schnaufte, während Professor Baumann Hilfe suchend auf die anderen Anwesenden blickte, denn er hätte so gerne differenzierend eingegriffen, aber die warteten nur auf weitere polemische Kommentare – welche jedoch unterblieben.
Klimt schwieg, er schwieg für den Rest des Abends, dann, nach der Heimkehr in ihr gemeinsames Hotel, befahl er seinem damaligen Sekretär, alles, aber auch alles über diese Frau in Erfahrung zu bringen.
«Ich denke, dass ist der Beginn einer sehr intensiven … ja, warum nicht, nennen wir es Freundschaft!»
Wilson hatte den Report über sie sorgfältig studiert. Und er zermarterte sich seitdem das Hirn, was Ayn Goldhouse mit dem Vorwurf «Feigling» gemeint haben konnte. Aber es fiel ihm nichts ein, er konnte sich nicht einmal ruhig auf die Fragestellung konzentrieren, denn was ihn so fesselte, war das außergewöhnlich Anziehende ihrer Erscheinung. Ayn Goldhouse verzauberte ihr Gegenüber sofort, körperlich, weil sie einen mit einem so hellen durchdringenden Blick ansah, als könnte sie noch die dunkelsten Abgründe der Seele in einem neuen Licht erstrahlen lassen. Eine Menschenfängerin, das war sie!
Vor ziemlich genau drei Jahren hatte Wilson alles an Material gesammelt, was der Markt und die Detekteien an Informationen über Ayn Goldhouse hergaben. Es war viel, aber nicht genug, um das Rätsel um diese Frau zu klären. Das ging wohl auch Klimt so, denn er starrte noch immer wie gebannt auf die Leinwand, als befände er sich in einem stillen Dialog mit seiner Erzfeindin.
«Was mag sie wohl vorhaben?», flüsterte er, also könnte sie ihn und Wilson belauschen. «Was glauben Sie?»
«Sie wird alles tun, um Sie baldmöglichst zu eliminieren! Nicht eigenhändig, versteht sich, nicht auf körperliche Weise, vermute ich, das wäre zu billig. Sie will Sie lächerlich machen, so lächerlich, dass nie wieder ein Hahn nach Ihnen kräht, geschweige denn ein Journalist sich meldet!»
«Da vermuten Sie wohl richtig! Aber wie sollte es ihr gelingen, einen Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat, vollends und für immer der Lächerlichkeit preiszugeben?»
«Sie animiert ihn, nackt durchs Brandenburger Tor zu spazieren?»
«Ihrer Fantasie sind in jeglicher Hinsicht sehr pubertäre Grenzen gesetzt!»
«Sie enttarnt seine wissenschaftlichen Arbeiten als Plagiate?»
«Wie originell! Wer könnte sich heutzutage noch wissenschaftlich blamieren, vor welchem Publikum denn, ich bitte Sie?!»
«Tut mir leid, dann muss ich die Waffen strecken …»
Klimt sah ihn mit einem gleichermaßen herablassenden wie ermutigenden Blick an, als hätte er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass Wilson eines Tages doch den ersten Schritt in seinen Fußstapfen würde tun können.
«Bescheidenheit ist aller Neugier Anfang! Denken Sie nach, wann waren die Helden in der Geschichte unserer Menschheit am verletzlichsten? Hmm? Seit den Tagen Homers gilt für alle Helden eine eiserne Maxime: Verliebe dich nicht, niemals, nie! Sonst verlierst du den Halt und dein Königreich und die Macht über Gott und die Frauen.»
«Sie meinen, Ayn Goldhouse will eine ihrer jungen Novizinnen auf Sie ansetzen, auf dass Sie gleichsam die Hosen herunterlassen und äh …»
«Nackt durchs Brandenburger Tor spazieren? Wilson! Sie gelangen auf den seltsamsten Umwegen immer wieder auf das kleine Eiland ihrer Naivität! Überlegen Sie doch, würde Ayn Goldhouse einer Schülerin diese heikle Aufgabe anvertrauen?»
«Nein, wahrscheinlich nicht. Sie meinen …»
Er sah seinen Chef ein wenig verwundert an, denn diese Überlegung schien ihm so absurd, dass sogar in der verrückten Welt Klimts kein Platz dafür war.
«Sie meinen doch nicht etwa …»
«Doch, sehr wohl, dass meine ich. Ich vermute, dass mir in den nächsten vierundzwanzig Stunden eine sehr geschmackvoll gestaltete Einladungskarte zugestellt wird …»
«In der Ayn Goldhouse Sie …»
«In der sie mich zum romantischen Dinner bittet, sehr wohl. Es wird ein wunderbarer Abend werden, davon bin ich überzeugt. Aber ich muss gestehen, ich weiß noch nicht genau, wie sich Odysseus vor dem Gesang der Sirene wirklich in Schutz bringen kann. Es ist also, deswegen sehen Sie mich so vergnügt, ein Wettstreit auf Augenhöhe! Und ich schließe eine persönliche Niederlage zum Wohle aller keineswegs aus!»
«Also alles nach Plan!»
«Alles nach Plan, Wilson! Auf nach Golgatha!» Klimt erhob sich. Wilson bot ihm die Hand, was Klimt mit einem höhnischen Lachen kommentierte.
«Sosehr mir Ihr Mut imponiert, so gesundheitsschädigend scheint er mir. Ich würde Ihnen dringend raten, auch wenn Sie wie gewohnt meine Ratschläge nicht zur Kenntnis nehmen, auf keinen Fall ohne Begleitung außer Haus zu gehen!»
«Wollen Sie mir Befehle erteilen?»
«Bitten, ich formuliere Bitten, zu Ihrem eigenen Wohl.»
«Danke! Abgelehnt.»
Wilson hatte nichts anderes erwartet.
«Eine letzte Kleinigkeit noch, Herr Klimt: Der Verlag hat angerufen, soll heißen Ihre Lektorin Fräulein Austen. Sie lässt fragen, wann endlich das Manuskript Ihres Buches eintrifft?»
Beide mussten lachen. Sie hatten dieses Fragespiel schon zu oft gespielt.
«Niemals, wie Sie sehr gut wissen. Aber drücken Sie es höflicher aus.»
Donnerstag, 8. März, 13 Uhr
von Hausens Villa im Grunewald
Ludwig Müller von Hausen war es gewohnt, pünktlich zum Mittagessen daheim zu erscheinen. Von seinem Büro auf dem Kurfürstendamm bis zu seiner kleinen Villa im Grunewald waren es zwanzig Minuten Fahrzeit, die er – ganz gleich wie die Verkehrslage auch war – meist exakt einhielt, denn er kannte alle Schleichwege. Das war seine Art von Zuverlässigkeit. Seine Frau liebte seine festen Angewohnheiten, denn sie gaben ihr die Möglichkeit, ihn zielbewusst zu verletzen, wann immer ihr danach zumute war, und in letzter Zeit war ihr häufig danach zumute.
Als sie von Hausen kennenlernte, siebzehn Jahre war das nun her, da glaubte sie, das große Los gezogen zu haben. Als ob er sie je im Unklaren darüber gelassen hätte, wie er sie und ihresgleichen hasste. Aber sie fand das männlich, damals, diese ostentative Verachtung, die er ihr und ihrem Lebensstil entgegenbrachte. Ihr selbst ging es ja nicht anders. Sie stammte aus einer alten Westberliner Schauspielerfamilie und musste schon mit sechzehn ihre Abende in der Paris Bar verbringen. Ihre Mutter nutzte sie wie einen billigen Köder, um an die Regisseure und Produzenten heranzukommen. «Mein kleine süße Romy», so wurde sie angepriesen von ihr; «Ramona», korrigierte sie dann, «meine Name ist Ramona», aber den Fluch konnte sie damit nicht brechen. Sie hatte Romy Schneiders Lächeln – und eine ähnlich skrupellose Mutter, aber damit endeten auch schon die Gemeinsamkeiten. Sie wollte keine Karriere. Von der ersten Stunde an hasste sie die Film- und Fernsehleute, mit denen ihre Mutter sie bekannt machte. Sie hasste die Kokserei, sie hasste das hohle Lachen, die schlechten Manieren, den auftrumpfenden Narzissmus all dieser Ego-Darsteller. Nur – sie sah keinen Ausweg. Ihr Vater, Boulevardschauspieler der Art, die nicht mehr gebraucht wurde, deklamierte daheim vor dem Spiegel besoffen Monologe aus seiner Glanzzeit in den Achtzigern. Geld hatte er schon lange keins mehr verdient, und die wenigen Rollen der Mutter brachten gerade so viel ein, dass sie die Miete bezahlen konnten, meist jedenfalls. Für die Ernährung der Familie war seit dem sechzehnten Lebensjahr ganz allein sie zuständig. Was anfangs nicht schwerfiel. Die Rollen in den allabendlichen Soaps spielte sie mit einer Routine, die die Regisseure verblüffte, die aber für sie ganz selbstverständlich war. Sie hatte seit ihrer Kindheit eine Rolle gespielt, dagegen war der seifige Quatsch im Fernsehen ein Kinderspiel.
Mit siebzehn drehte sie den ersten abendfüllenden Spielfilm und wurde von einem der Hauptstadtredakteure zum Filmstar erklärt. Aus Dankbarkeit schlief sie mit ihm.
Das war ein Fehler, denn sie machte danach aus dem Abscheu vor seiner Person keinen Hehl. Er war nicht nur ein lausiger Liebhaber gewesen, er erwies sich vor allem als unglaublicher Dummkopf, und das nahm sie ihm persönlich übel, denn es entwertete jedes seiner Komplimente.
Ramona war sich ihrer Talente als Schauspielerin völlig sicher, nur wer sie als Mensch war, das wusste sie nicht. Nun kam dieser Zeitungsschreiber daher, erklärte sie zum Star und redete mit ihr, als wäre sie ein Kunstgeschöpf der Babelsberger Filmstudios.
Er wollte sie als Trophäe, nicht als Gegenüber. Er spürte ihre Verachtung und ließ fortan kein gutes Haar an ihr. Wer einmal zum Opfer der Regenbogenpresse gemacht wurde, erholte sich davon nur sehr schwer. Ihr war es gleichgültig, was die Blätter der Hauptstadt über sie titelten, sie wusste, er hatte die Gerüchte eingespeist in diesen Malstrom der Verleumdungen, in den sie nun geriet. Drogenkonsum war noch das Harmloseste, ein verleugnetes Kind, eine nicht zu therapierende Neigung zur Schizophrenie, pyromanische Attacken; dass sie nicht als Hauptverdächtige für die Autobrände in der Hauptstadt in Gewahrsam genommen wurde, erstaunte sie zuweilen selbst.
«Du musst aus der Schusslinie», befahl ihre Agentin und schickte sie damals vier Wochen nach Amerika, was ihr guttat. Das Elend dort machte sie zur Europäerin. Sie war plötzlich stolz auf ihre alten Heimat, auf das alte Europa. Sie empfand tatsächlich so etwas wie Patriotismus.
«So, und damit diese Journalistenkläffer dir nicht noch mal ans Bein pinkeln, besorgen wir dir einen guten Anwalt.»
So war sie mit Ludwig von Hausen bekannt geworden. Er brachte sie vom Koksen ab, das sie sich in Stresszeiten angewöhnt hatte, ohne dem verfallen zu sein, empfahl ihr eine Therapie, um das schlechte Gewissen ihren Eltern gegenüber zu lindern, und sprach mit ihr von Mensch zu Mensch. Ja, so altmodisch drückte er sich aus: «Mit Ihnen muss man von Mensch zu Mensch reden. Das hat vorher wohl noch niemand getan.» Sie diskutierten über Politik, ganz ernst und frei von Zynismus, er ging mit ihr spazieren, sie segelten auf dem Wannsee, spielten Tennis. Er war so bürgerlich, so erwachsen, sie hätte heulen können vor Glück. Er bot ihr seine Hand, lebenslang, sprach von den drei Kindern, die er sich von ihr wünschte, möglichst bald, und hielt bei ihrem Vater um ihre Hand an.
Es war ganz großes Theater, von allen Beteiligten. Sie glaubte, endlich im Leben angekommen zu sein. Sie wollte es glauben. Jetzt, im Nachhinein, war ihr klar, sie hatte sich vorsätzlich belogen, von Anfang an. Dennoch, dieser Aufbruch damals war so schön gewesen, selbst die Erinnerung daran hatte unter dem Alltag nicht gelitten.
Mit einer Energie, die durchaus mit Leidenschaft zu verwechseln war, wenn man von Menschen keine Ahnung hatte, entwarf von Hausen damals ihr gemeinsames Leben. Sie heirateten kirchlich, im Kloster Chorin, ein ganz kleiner Kreis von Menschen, die ihnen von Herzen alles Gute wünschten. So schien es ihr damals. Die Hochzeitsreise führte nach Siena, und er, der kühle Jurist, machte sie auf so leidenschaftliche Weise mit der Kunst der Toskana vertraut, mit den Bauwerken, den Plastiken, den Gemälden, dass ihr das Herz überging vor Gefühl.
Sie fühlte sich wie eine Prinzessin, die ihr neues Schloss bezog. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, dass er sie bewusst weich stimmte, auf dass sie schneller für Kinder bereit war. Er wollte ihre Liebe nicht für sich, es ging ihm um Kinder, drei an der Zahl, rasch geboren, deswegen tat er alles, sie romantisch zu stimmen, weich, aufnahmebereit. Er war berechnend auf eine Art, die sie nie für möglich gehalten hatte.
‹Du spinnst›, dachte sie, als ihr das erste Mal der Verdacht kam, dass er gar nicht sie meinte. ‹Du spinnst, er liebt dich, unglaublich aufrichtig altmodisch liebt er dich!›
Aber so war es nicht. Im ersten Jahr konnte sie es verdrängen. Sie wurde schwanger und die Freude über die Schwangerschaft verdrängte die Erinnerung an das körperliche Zusammensein mit ihm. Die zweite und dritte Schwangerschaft folgten rasch darauf. In den ersten fünf Jahren ihres Zusammenseins kam sie kaum einmal zum ruhigen Nachdenken.
Nach dem dritten Kind schlief er nicht mehr mit ihr. Es fiel ihr erst gar nicht auf, dann, als sie nachrechnete, wie lange er nicht mehr in ihr Schlafzimmer gekommen war, hielt sie es für normal. Väter sind zuerst Väter, dann Liebhaber. Aber er sah seine Kinder kaum an, und er sah sie nicht mehr an. Zugegeben, sie hatte keine sonderliche Freude daran gehabt, mit ihm zu schlafen. Es war nicht widerlich gewesen, wie mit dem Journalisten, es war seltsam, mit ihm intim zu sein.