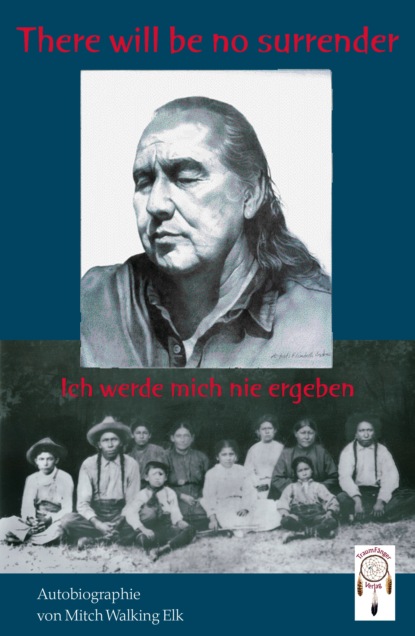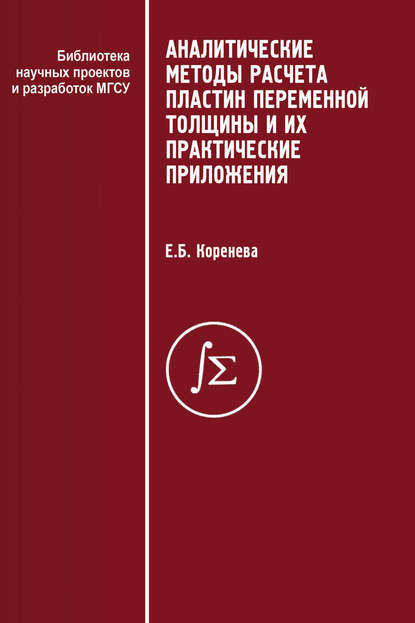- -
- 100%
- +
Ein anderes Mal nahm ich an einer Bildungskonferenz auf der Oneida Reservation, in Oneida, Wisconsin, teil. Ich hörte einem Vortrag von Brenda Child zu, die später das Buch „Boarding School Seasons” verfasste. Sie las alte Briefe von Internatsschülern vor, die sie in der Zeit von etwa 1900 bis in die 1940er an ihre Eltern geschrieben hatten. Ich war so berührt von dem, was sie vorgelesen hatte und war so dankbar, dass ein solches Thema endlich einmal angeschnitten wurde, dass ich mich nach ihrer Präsentation mit einem Handschlag bei ihr bedanken wollte. Als ich mich durch die Menge zu ihr hindurch gekämpft hatte, war ich von meinen Gefühlen so überwältigt, dass ich zu weinen begann. Es war mir ein bisschen peinlich vor den Anwesenden, die mich weinen sahen, aber ich konnte nichts dagegen tun. Aber sie kam mir zu Hilfe, indem sie mich voller Verständnis anschaute und mich einfach umarmte. Später erhielt ich einen Brief von ihr, in dem sie mich darum bat, ein paar Passagen aus dem Lied „Indians“ zitieren zu dürfen. Ich habe dieses Lied selbst geschrieben und aufgenommen und ein Teil davon behandelt das Thema der Boarding Schools. Natürlich war ich einverstanden und sie fügte die Textpassagen des Liedes am Ende des ersten Kapitels ihres Buches „Boarding School Season“ ein.
Ich werde mit den Erinnerungen an meine Zeit in der Boarding School fertig werden müssen, so wie ich inzwischen auch den Tod meiner Verwandten überwunden habe.
Meine Urgroßmutter Mary Louise North war übrigens in der ersten Boarding School der USA: Die Carlisle Industrial Indian School wurde 1879 eingerichtet und befand sich in Carlisle, Pennsylvania. Sie war sozusagen das Pilotprojekt des amerikanischen Internatssystems. Sie war eine Erfindung von Richard Henry Pratt, einem ehemaligen Militärangehörigen, der zum Beruf des Lehrers wechselte. Zuerst unterrichte er indianische Kriegsgefangene in Fort Marion, Florida, wo man die gefangenen Apachen, Cheyenne und Arapaho gebracht hatte. Später unterrichtete er die vielen Indianerkinder, die man von ihren Heimstätten weggeholt und gezwungen hatte, sich den Assimilationspraktiken der Schule zu unterwerfen.
In den Schulunterlagen meiner Urgroßmutter Mary North ist verzeichnet, dass sie Carlisle am 26. Februar 1884 verließ. Von dort aus ging sie nach Genua, Nebraska, um für den Indian Service zu arbeiten. Später erfuhr ich, dass Genua auch eine Boarding School für Indianer war. Sie arbeitete dort eineinhalb Jahre lang und kehrte dann wieder zur Cheyenne Arapaho Reservation nach Oklahoma zurück. Nachdem ich einige ihrer Briefe gelesen hatte, die sie nach ihrem Abschluss an verschiedene Leute geschrieben hatte, gewann ich den Eindruck, dass sie ziemlich dankbar für die Ausbildung gewesen war, die sie dort erhalten hatte. Das steht im vollen Gegensatz zu dem, wie ich über die ganze Sache denke. Auch meine Großmutter Nettie hat das Boarding School System miterlebt. Sie war Schülerin der Concho Indian School, die sich im östlichsten Gebiet der Stammesgrenzen der Cheyenne und Arapaho Reservierung befand. Heutzutage befindet sich dort unser Stammesbüro. Von dort ging sie zur Chilocco Indian School in Nord-Zentral-Oklahoma, direkt an der Grenze zwischen Oklahoma und Kansas. Nachdem beide, meine Urgroßmutter und meine Großmutter zu einem Produkt der Boarding Schools geworden waren, erschien es eine klare Sache, dass der Rest von uns auch dorthin gehen sollte, und da die örtlichen Sozialarbeiter darauf bestanden, hatten wir keine andere Wahl.
Die bitterste Pille, die wir in der Boarding School zu schlucken hatten, war die Behandlung durch die Angestellten. Viele von ihnen waren unsere eigenen Leute, Indianer meine ich. Sie waren teilweise schlimmer als die Weißen, die dort arbeiteten. Mir ist bis heute nicht ganz klar, ob sie nur versuchten, es ihren weißen Vorgesetzten recht zu machen, oder ob sie die Gehirnwäsche so erfolgreich durchlaufen hatten, dass sie sich mit den Unterdrückern bereits identifizierten, oder ob sie einfach nur geistig behindert waren. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, sie waren äußerst erfolgreich bei der Ausführung ihrer Mission und mit ihrer übertriebenen Durchsetzung der Internatsregeln. Ich bin sicher, dass sie von den Weißen gut indoktriniert worden waren, uns Kinder so gründlich zu misshandeln.
Die Seneca Indian School war auf dem Land einer der Stämme gebaut worden, die man in dieses Gebiet umgesiedelt hatte. Leiter der Schule war ein Indianer und die Mitarbeiter im Schülerwohnheim waren Indianer, aber die meisten der Lehrer waren Weiße. Ich glaube, es war in meinem ersten Jahr an dieser Schule, als einige von uns Schülern zu einem Ausflug nach Riverton in Kansas mitgenommen wurden, zu einem Ort namens Spring River Inn. Das war das erste Mal, soweit ich mich erinnere, dass ich die große weiße Frau sah, der dieser Platz gehörte. Das nächste Mal, als ich ihr wieder begegnete, war dann allerdings in unserer Schule, als sie sich nach mir erkundigte. Ich verbrachte den ganzen Tag mit ihr und sie fuhr mich in ihrem großen Cadillac herum. Sie lud mich zum Essen ein und war sehr nett zu mir, und ich hatte den Eindruck, dass sie wohl ziemlich wohlhabend war. Am Abend brachte sie mich wieder zur Schule zurück und plötzlich verspürte ich ein unangenehmes Gefühl ihr gegenüber. Ich kann mich nicht genau erinnern warum, aber schon während des ganzen Tages war dieses Gefühl ganz langsam in mir hochgekrochen. Aber ich erinnere mich noch gut daran, dass wir uns unterhielten. Wir waren gerade zurückgekehrt und hielten vor dem Haus mit dem Schlafsaal Nr. 5, in dem die kleineren Jungen untergebracht waren. Das letzte, was sie zu mir sagte, war: „Möchtest du nicht mit mir kommen und bei mir leben? Willst du nicht mein kleiner Junge sein?“ Ich wurde total wütend, sprang aus dem Auto und knallte die Tür zu. „Ich habe bereits eine Mutter“, schrie ich sie an.
Unnötig zu sagen, das war es dann. Ich weiß nicht, wer sie geschickt hatte und wer ihr von mir erzählt hatte, aber ich weiß, dass meine Teilnahme an diesem Ausflug zu ihr ein abgekartetes Spiel gewesen war. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, ein ahnungsloses kleines Indianerkind zu adoptieren. So etwas geschah mit vielen unserer Kinder. Wie dem auch sein, ich konnte zwar verhindern, dass sie mich adoptierte, aber einige Jahre später adoptierte sie meinen jüngeren Bruder. Ich sah ihn erst wieder, bis wir beide Teenager waren, und auch dann nur sporadisch bis wir in den Zwanzigern waren, und auch dann nur, wenn die Initiative von mir ausging. Gegen Ende seiner Jugendzeit haute er schließlich ab, er„floh“ sozusagen von ihr, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen. Danach lebte er eine Zeit lang bei einem älteren Ehepaar im Südosten von Kansas, aber er kam fast nie nach Hause, um unsere Mutter zu besuchen. Irgendwie ist das Band, das Mutter und Kind miteinander verbindet, durch diese Adoption kaputt gegangen. Es war etwas, das gegen den Willen unserer Mutter geschehen ist, aber wie ich schon erwähnt habe, hatte sie nicht die Kraft, „sie zu bekämpfen“. Es gibt noch viel mehr über dieses Thema zu sagen, worauf ich später noch einmal zu sprechen komme.
Zurück zu meiner Schulzeit: Goodlow Proctor gehörte zwar zum Stamm der Cherokee in Oklahoma, aber für mich sah er wie ein Weißer aus. Er war auch mit einer weißen Frau verheiratet. Er wohnte in einem der Häuser auf dem Schulgelände, die man für das Schulpersonal bereitgestellt hatte. Er hatte die Aufsicht über uns Jungen. Er war ein großer Mann mit einem lauten und einschüchternden Wesen. Er war der sadistischste Mann, den ich jemals gesehen habe, und ich hatte Angst vor ihm. Ich war nicht der Einzige, denn viele andere hatten auch Angst vor ihm. Ich bemerkte oft, wie er seine Schüler, seine Kollegen und sogar gegnerische Trainer anderer Schulen bei Basketballspielen einschüchterte. (Er war nämlich auch Basketballtrainer an unserer Schule). Seine Art, wie er mit uns umging, war, uns durch Angst und Einschüchterung unter Kontrolle zu halten. Und wir reagierten entsprechend darauf. Immer wenn unsere Zimmer nicht zu seiner Zufriedenheit aufgeräumt waren, wenn wir mit unseren Schuhen schwarze Flecken auf dem Fußboden hinterlassen hatten oder unsere Kleidung nicht ordentlich in den Schränken hing, oder zu seiner Zufriedenheit in den Schubkästen gefaltet lag, mussten wir das Problem nicht nur beseitigen, sondern erhielten auch eine Strafe in Form von Extraarbeit oder körperlicher Züchtigung.
Eine Art uns zu bestrafen war in Hockstellung zu gehen. Dazu brachte er uns in die unteren Etagen des Wohnheims und befahl uns in Hockstellung hin und her zu gehen, bis wir nicht länger hocken oder gehen konnten. Er nannte es den Entengang. Wenn wir vor Erschöpfung hinfielen, was irgendwann immer passierte, zwang er uns, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Solange, bis wir wirklich nicht mehr konnten. Der körperliche Schmerz und die Erniedrigung waren unerträglich und hielten tagelang an. Und dann waren da noch diese Liegestützen. Ich wette, dieser Mann muss lange Zeit beim Militär gewesen sein. Wahrscheinlich glaubte er, er wäre immer noch dort, und wir wären seine Rekruten. Noch ehe ich das Alter von elf Jahren erreicht hatte, muss ich Millionen von Liegestützen gemacht und Millionen von Tränen geweint haben, nur weil ich nicht mehr hocken und keinen Zentimeter mehr im Entengang gehen konnte. Soldaten beim Militär kann man auf eine solche Behandlung geistig und emotional vorbereiten, aber wir waren bloß Kinder und für uns war es Misshandlung. Wenn wir es nicht so machten, wie er es wollte, dann war als ultimative Strafe eine Tracht Prügel vorgesehen. Aber es war nicht etwa so, wie wenn die Mama einen den Hintern versohlt. Für das Auspeitschen hatte er ein ganz spezielles Brett zugeschnitten, um die Hände daran zu fesseln. Aber der gute Goodlow Proctor schlug nicht etwa auf den Po. Seine Spezialität war es, seinen „Opfern” auf das Hinterteil ihrer Schenkel zu schlagen. Ich erinnere mich, wie ich einmal nach einer solchen „Tracht Prügel“ meine Schenkel betrachtet habe. Er hatte Striemen und lauter geplatzte Äderchen auf meinen Schenkeln hinterlassen. Und das war nur eines der Male, wo ich von ihm gezüchtigt worden war. Dieser Mann war so brutal, dass ich Angst hatte, meinen eigenen Gedanken nachzuhängen, immer in Furcht, er könnte meine Gedanken lesen und mich bestrafen. Ich bin der Ansicht, dass er tief in mir eine emotionale Furcht vor Ablehnung eingepflanzt hat, die eine sehr lange Zeit mein Leben beeinflusst hat. Dies hat mit dazu beigetragen, dass ich oft vom Weg abgekommen bin, und nicht das getan habe, was vielleicht einfacher oder angemessen gewesen wäre. Zum Beispiel mich einfach zu melden, wenn ich eine Frage hätte beantworten können oder etwas zum meinem Wohl oder zum Wohle anderer zu tun. Aber ich tat es nicht, aus Angst Fehler zu machen und dafür bestraft zu werden. Ich mache ihn und das ganze Boarding School System für diese Ängste verantwortlich.
Einmal, ich muss ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein, versuchte ich einen Brief an eine Militärakademie zu schicken, deren Anschrift ich in einem Journal gefunden hatte. Ich hatte die Hoffnung, ich könne aus den Fängen des Internats entkommen und eine militärische Laufbahn in dieser Akademie beginnen. Ich hatte keine Ahnung, was eine Militärakademie war, ich wollte bloß raus aus dieser Indianerschule. In meinem Brief schrieb ich einen detaillierten Bericht über die Art, wie man uns in der Boarding School behandelte. Mein Brief wurde von Goodlow abgefangen. Ich hatte keine Ahnung, dass die Post zensiert wurde und er machte mir danach das Leben zur Hölle und erniedrigte mich in aller Öffentlichkeit.
Aber wenn ich so zurückblicke, dann erkenne ich, dass sich hier der Widerstand formte. Es war einfach nur eine Reaktion darauf, wie ich in der Schule behandelt wurde.
Bezüglich dieses Mannes gab ich mir selbst ein Versprechen. Ich gelobte, ihn auf die gleiche Art und Weise zu verletzen, wie er mich verletzt hatte, wenn ich erst ein Mann sei und ihn jemals wiedersehen sollte. Dieser Gedanke verfolgte mich eine lange Zeit, bis es tatsächlich zu dieser Begegnung kam: Ich ging Jahre später eine Straße in meiner Heimatstadt entlang und kam zufällig an einem Restaurant vorbei, wo die Tür offen stand. Ich schaute hinein und siehe da, da war dieser Goodlow. Er saß an einem Tisch und schob sich Essen ins Maul. Er hatte mich nicht bemerkt und ich stand eine Weile da und beobachtete ihn. Ich versuchte mich zu entscheiden, ob ich mein Versprechen, an das ich mich in diesem Moment natürlich erinnerte, einhalten sollte. Ich hatte mich gerade dafür entschieden, einfach weiterzugehen, als er plötzlich aufsah und bemerkte, dass ich ihn beobachtete. Ich sah an seinen Augen, dass er mich erkannte und es schien mir, als ob er nicht wirklich respektvoll gewesen wäre. Ich ging hin zu seinem Tisch und stand vor ihm, während er einfach weiteraß. Es kostete mich große Beherrschung, nicht das zu tun, was ich vor Jahren versprochen hatte. Ich erwiderte seinen abfälligen Blick, drehte mich um und verließ das Restaurant. Ich bin ihm seitdem nicht mehr begegnet. Ich hörte kürzlich, dass er gestorben sei. Woran weiß ich nicht. Es ist mir auch egal.
Eines aber ist sicher. Wenn Goodlow Proctor heute ein Kind auf die gleiche Weise bestrafen würde wie er uns damals bestraft hatte, dann würde er wegen Kindesmisshandlung ins Gefängnis kommen. Erst Jahre später wurde mir bewusst, dass die Art, wie er uns behandelt hat, nichts anderes als Folter war. Das Wort Misshandlung ist für das, was er uns angetan hat, einfach unzutreffend. Folter ist das richtige Wort dafür.
Ich war nicht dabei und habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber irgendwann in den 70ern protestierte das American Indian Movement vor einer Schule und versuchte die Behandlung der Schüler an die Öffentlichkeit zu bringen und die Schließung der Schule zu bewirken. Es könnte ein Erfolg gewesen sein, denn kurz danach schloss die Seneca Indian School ihre Pforten und später habe ich erfahren, dass das Militär einige der Gebäude für Artillerieübungen benutzte.
Simon Bush, auch ein Cherokee, war der Betreuer der anderen Jungen. Er war wesentlich freundlicher als Goodlow Proctor. Er sprach fließend Cherokee und redete mit jenen Schülern, die auch noch diese Sprache beherrschten, in ihrer Muttersprache. Das war gemäß den früheren Regeln des Boarding Schools Systems streng verboten. Simon war in Ordnung, aber er war trotz allem noch ein Regierungsindianer, der die schmutzige Arbeit der Weißen ausführte. Er war ein untersetzter, rundlicher Mann, aber nicht wirklich dick und lief immer mit einer Zigarre herum, die aus seinem Mund ragte. Auch ihm begegnete ich einige Jahre später wieder und er hatte sich überhaupt nicht verändert.
Mrs. Peters war eine der Hausdamen unserer Unterkunft und genau wie Mr. Bush wohnte auch sie in der Unterkunft. Sie war eine Choctaw, irgendwo aus Oklahoma, und mein Gott, sie war richtig gemein. Ein anderer mag sie als streng oder vielleicht auch nett in Erinnerung haben, aber ich fand sie richtig fies. Eine der Haupteigenschaften, die einer Institution wie der Boarding School fehlen, ist das Mitgefühl, und Mrs. Peters passte perfekt in das Umfeld dieser Schule, denn sie hatte keins.
Eines der Probleme, die mir in meiner Kindheit wirklich zu schaffen machten, war die Tatsache, dass ich Bettnässer war. Auf diejenigen von uns, die ins Bett machten, wartete eine besondere Strafe: Wir mussten früh am Morgen aufstehen, unser Bettzeug auswaschen und zum Trocknen aufhängen. Das war etwa um die gleiche Zeit, als die anderen Schüler zum Frühstück gingen. Das war die größte Erniedrigung meines Lebens. Bettnässer wurden auch mitten in der Nacht geweckt, damit sie zur Toilette gingen und nicht ins Bett pinkelten. Eines Nachts wurde ich von einer Ohrfeige geweckt, die mir Mrs. Peters verpasst hatte. Ich hatte es zwar geschafft aufzustehen und zur Toilette zu gehen, aber ich war immer noch nicht ganz wach und wusste gar nicht so recht, was ich dort eigentlich sollte. Sie hatte sehr fest zugeschlagen. Das war erniedrigend und demütigend für mich, aber ich hatte immerhin die Botschaft verstanden.
Eine andere Form der Misshandlung war das routinemäßige Haarschneiden jeden Samstagmorgen. Niemand konnte Simons oder Goodlows Haarschneidemaschine entkommen. Sie brauchten keine talentierten Friseure zu sein, um diese Aufgabe zu erfüllen, denn wir bekamen keinen persönlichen Haarschnitt, sondern wurden geschoren. Ich hasste es, meinen Kopf rasieren zu lassen und versteckte mich vor ihnen, aber dann holten sie mich eben Samstagnacht aus dem Bett und verpassten mir eine „Frisur“. Jahre später, als ich andere weiße Institutionen kennenlernte, fiel mir auf, dass sie die gleiche Haarschneidestrategie als Bestrafung bei denen anwandten, die sich nicht unterwerfen wollten.
Die Sache mit dem Haarschnitt spitzte sich in den späten 70ern erneut zu, als ich nach vier Jahren auf der Flucht in das staatliche Zuchthaus von Columbus, Ohio, eingeliefert wurde. Mit der Begründung, dass ich seit meinem sechsten Lebensjahr gezwungen worden war, mich den Regeln der Institutionen des weißen Mannes zu unterwerfen, weigerte ich mich aus spirituellen und kulturellen Gründen, mir die Haare schneiden zu lassen. Inzwischen hatte ich nämlich angefangen, an traditionellen indianischen Zeremonien teilzunehmen und lernte all die Dinge, die sie (die US-Regierung) so viele Jahre versucht hatte zu zerstören. Ein Mann, der traditionelle Heilmethoden praktizierte, ein Medizinmann, hatte mir gesagt, dass sie mir im Gefängnis die Haare nicht abschneiden könnten, solange ich stark sein würde. Daraufhin steckten sie mich ins „Loch“, das heißt, sie sperrten mich in Einzelhaft, weil ich mich den Regeln und Vorschriften der Anstalt widersetzt hätte.
Als Reaktion gegen diese Maßnahme reichte ich Klage ein. Ich wollte mein Haar lang tragen dürfen, wie es gemäß dem traditionellen Glauben meines Volkes der Brauch war. Von dem Moment an, wo ich mich entschieden hatte, Widerstand zu leisten, fastete ich und betete zu den Geistern und bat um Hilfe. Die Geister halfen mir und ich gewann den Prozess.
Sie haben verloren.
Als ich etwa neun oder zehn Jahre alt war, fing ich an, von der Schule wegzulaufen. Zuerst wollte ich immer nur nach Hause und weg von dem Ort, wo ich nicht sein wollte. Aber nach einer Weile wollte ich einfach nur von der Schule weg, egal wohin. Nach Hause zu gehen war nicht ratsam, weil Goodlow oder die Polizei immer wieder kamen und mich zurückbrachten. Zuerst steckte mich die Polizei ins Gefängnis, bis Goodlow mich dort abholte. Dann behielten sie mich über Nacht im Gefängnis, dann eine Nacht und einen Tag und manchmal noch eine Nacht länger und so weiter. Goodlow kam dann, wenn er sich gut auf die dann folgende körperliche und seelische Misshandlung vorbereitet hatte.
Nie fragte jemand, warum ich überhaupt weglief. Das Wohl der Kinder in diesen Einrichtungen lag niemandem am Herzen. Die Kinder waren diesem System vollkommen ausgeliefert. Kurze Zeit, bevor ich überhaupt anfing wegzulaufen, wurde ich in der Schule das zweite Mal in meinem Leben sexuell missbraucht. Erst viel später, als ich mich mit meinen Erlebnissen in der Boarding School und all den erlittenen Misshandlungen auseinandersetzte, fiel mir auf, dass es eigentlich gar kein Wunder war, dass ich aus der Schule weggelaufen bin. Damals war es einfach nur ein Überlebenstrieb, denn als Kind brachte ich den sexuellen Missbrauch nicht mit meinen Fluchtversuchen in Zusammenhang, nichtsdestotrotz geriet ich dadurch in alle nur möglichen gefährlichen Situationen.
Ich glaube, dass das, was mir in der Boarding School widerfahren ist, den Grundstein für ein Leben in Verbindung mit Verbrechen, Alkohol, Drogenmissbrauch, Gewalt, Gefängnissen und emotionaler Instabilität gelegt hat. Noch Jahre später war ich in diesem Netz gefangen. Dieses vorbildliche amerikanische System, das eigentlich das „Indianerproblem“ lösen wollte und mir als Ersatz anbot, mein Beschützer und Wohltäter zu sein, welches sogar vertraglich die Aufgabe übernommen hatte, mich zu kleiden, mir Unterkunft zu gewähren und mich zu bilden, hat mich buchstäblich fast umgebracht. Bei anderen um mich herum ist ihnen das auch gelungen.
Ich war einer der drei oder vier Jungs, die regelmäßig abhauten. Aber selbst wenn wir in der Nacht weggelaufen waren, hat man uns wieder eingefangen, und während einer von uns im Büro seine Strafe erhielt, saßen wir anderen draußen und warteten, bis wir an der Reihe waren. Was uns nicht daran hinderte, kurz darauf wieder davonzulaufen.
Einmal stahlen ich und ein anderer Schüler zwei Pferde, die der Schule gehörten. Wir ritten davon und erst nach drei Tagen wurden wir geschnappt. Man könnte meinen, wir hätten, ohne dass es uns bewusst war, eine alte Tradition unseres Volkes fortgesetzt, nämlich dem Feind Pferde zu stehlen und ihm zu entkommen. Sie machten noch mehrere Wochen danach Scherze, dass man uns aufhängen würde. Goodlow war so sauer auf uns, dass er uns noch nicht mal mehr im Klassenzimmer haben wollte. Nachdem er uns windelweich geprügelt hatte, ließ er uns Unkraut jäten und alle möglichen niederen Arbeiten verrichten, die ihm gerade so einfielen. Nach diesem Vorfall war er ständig hinter uns her. Er hatte uns buchstäblich auf dem Kieker. Seine Strafen wurden härter, aber mein Ärger wuchs ebenfalls, und ich rannte immer öfter weg. Das legte den Grundstock, dass ich über Jahre hinweg nicht damit aufhören konnte, vor mir selbst wegzurennen. Weglaufen wurde zur Überlebensstrategie.
Mein Zuhause war eigentlich nur etwa 18 Meilen von der Schule entfernt, aber für mich war es in etwa die gleiche Entfernung wie von der Erde bis zum Mond. Manchmal brauchte ich eine ganze Nacht, um die Strecke bis nach Hause zu laufen.
Als ich wieder einmal auf der Flucht war, befand ich mich ungefähr eine Meile außerhalb der Stadt. Die Sonne ging gerade auf und ich lief auf der Nordseite einer Straße entlang, die nach Westen führte. Plötzlich kam aus dem Maisfeld auf der südlichen Seite ein etwas seltsam aussehender Hund heraus. Ich befand mich am nördlichen Seitenstreifen, er auf dem südlichen, und er trottete sozusagen neben mir her. Seine Zunge hing heraus und er hatte einen wilden Blick. Eine knappe Minute liefen wir so nebeneinander her, bis der Hund kehrt machte und wieder im Maisfeld auf der Südseite verschwand. Später wurde mir klar, dass das Tier ein Kojote gewesen war. In vielen eingeborenen Kulturen, wie auch für mich selbst, hat der Kojote eine große spirituelle Bedeutung. Für einige dieser Kulturen ist er ein Schwindler, für andere ein spiritueller Helfer.
Eine der wichtigsten spirituellen Dinge, die wir von Kojoten lernen können, ist seine Fähigkeit zu überleben. Andere Gaben, die uns der Kojote geben kann, sind sein Heilwissen, sein Schutzinstinkt und der Gesang.
Der Kojote hat mir einige seiner Kräfte bereits im Kindesalter mitgegeben, vielleicht wurde ich auch schon damit geboren. Später, als ich zu den spirituellen Wegen unseres Volkes zurückkehrte, gaben sie mir Führung und Unterstützung, und ich spüre, dass sie das noch heute tun. Als ich auf dem Hügel stand, um für mein Volk zu fasten und zu beten, haben sie ihre „Medizin“ mit mir geteilt. In einem Traum erhielt ich eine Medizin, die mir beim Stehlen helfen würde, und kurz darauf bekam ich tatsächlich „Kojotemedizin“, die man zu diesem Zweck benutzen könnte. Ich habe die spirituelle Hilfe, die ich vom Kojoten erhalten habe, niemals benutzt, aber ich würde nicht zögern, es zu tun, wenn es ums Überleben ginge oder wenn mein Volk Hilfe bräuchte. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, die „Medizin“ zu benutzen, um der Regierung die Pläne zu stehlen, in denen steht, was sie eigentlich auf lange Sicht mit uns vorhaben. Ich bin mir sicher, sie haben nichts Gutes mit uns vor. Aus ihrer Sicht hin bin ich nun wohl ein Terrorist.
Einer unserer Medizinleute hat mir übrigens anvertraut, was die Regierung bzw. der Weiße Mann mit uns auf längere Sicht hin vorhat. Letzten Endes soll es darauf hinauslaufen, dass sie sich ihrer Verantwortung uns gegenüber entziehen wollen. Dies hat eine gute und eine weniger gute Seite. Immer mehr Einwanderer kommen hierher und entscheiden sich dafür, in Amerika zu leben und am Vermächtnis des Amerikanischen Traumes teilzuhaben. Dadurch wird unsere Existenz als Eingeborene Nationen dieses Land immer mehr bedroht. Einer der negativen Aspekte davon ist, dass jene Leute, die sich um die amerikanische Staatsbürgerschaft bemühen, keinen Geschichtsunterricht bezüglich der Ureinwohner Amerikas erhalten haben und viele von ihnen auf Grund von unerträglichen Schwierigkeiten in ihrem Heimatland flüchten wollen. Sie sind froh, dass sie nach Amerika kommen können, und ihr Bewusstsein oder ihr Interesse den Indianern gegenüber steht nicht gerade auf ihrer Prioritätenliste.