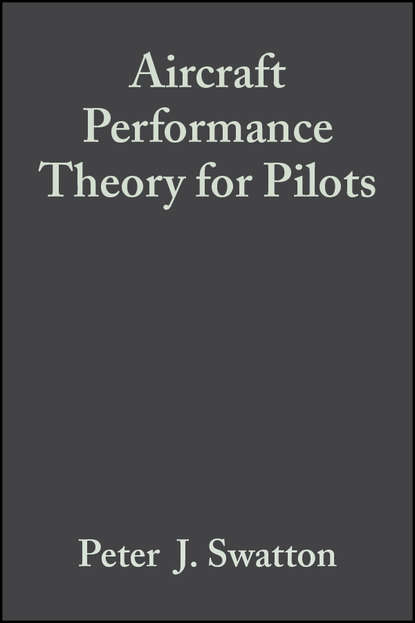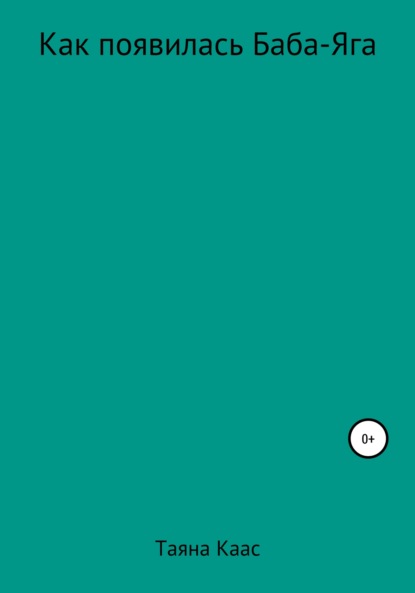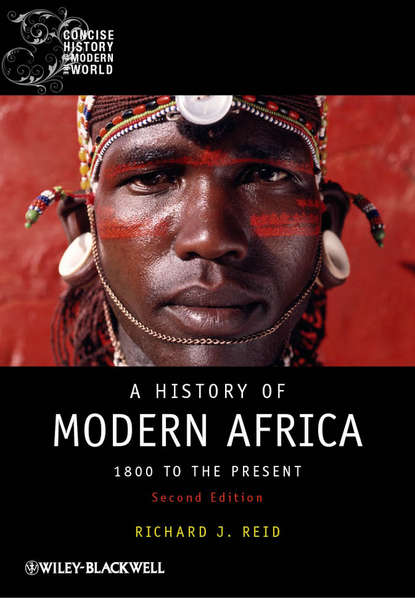- -
- 100%
- +
Wien
2.2.3 Das Taubstummen-Institut
Kaiser Joseph II.
Das Urteil Paul Schumanns, dass die Wirkung Michel de l’Epées nicht auf Frankreich begrenzt sei, sondern „alle Kulturnationen“ von ihm lernten (1940, 131f), trifft in ganz besonderem Maße für die Gründung der Wiener Taubstummenanstalt zu. Ihr Initiator und Förderer, der aufgeklärte Monarch Joseph II., Bruder der französischen Königin Marie Antoinette und damit Schwager Ludwig des XVI., hatte anlässlich seines Besuchs in Paris 1777 nicht nur von der Taubstummenschule de l’Epées erfahren, sondern diese auch selbst besucht (Schumann 1940, 196; Schott 1995, 54f).
Friedrich Stork Joseph May
Nach Wien zurückgekehrt, beauftragte Joseph II. Kardinal Migazzi mit der Benennung eines geeigneten Leiters für die zu gründende Anstalt. Dieser entschied sich für den Priester Friedrich Stork (1746–1823), dem er als Gehilfen den Lehrer Joseph May an die Seite stellte. Das von Kaiser Joseph II. 1779 eingerichtete k. k. Taubstummen-Institut, das zunächst für nur zwölf Zöglinge vorgesehen war, fiel – und hier sehen wir den Unterschied zu Frankreich – in die Zuständigkeit der für die Unterrichtsangelegenheiten in der Monarchie zuständigen Studienhofkommission. Die Finanzierung des Instituts teilten sich zwei Institutionen: für die Besoldung zeichnete die Hofkammer verantwortlich, während für den Unterrichtsraum die „Milde Stiftungs-Hof-Kommission“ aufkam. Die Kosten für den Unterricht der kaiserlich-königlichen Zöglinge wurden ebenfalls durch diese Behörde getragen.
staatliche Verantwortung
Die Anfänge der Institutionalisierung in Wien verdeutlichen, wie groß die Unterschiede zu Paris waren. Hier in Wien war es keine Privatperson, die die Initiative ergriff und stets um die finanzielle Absicherung der Einrichtung kämpfen musste, sondern die Spitze des Staates, die das Vorhaben ideell und auch materiell in ausreichender Weise unterstützte:
„Somit waren Stork und May die ersten staatlich angestellten Gehörlosenlehrer und das k. k. Taubstummen-Institut die erste staatliche Gehörlosenanstalt. Das Jahresgehalt von 800 fl (Gulden) für Stork entsprach der damaligen Norm für den etwas angehobenen Staatsdienst. Der ‚kaiserliche Compositeur‘ Wolfgang Amadeus Mozart erhielt bekanntlich ein ebenso hohes Jahresgehalt.“ (Schott 1995, 60)
Charakteristisch für die Wiener Gründung war auch, dass sie keineswegs nur auf den Großraum Wien beschränkt bleiben sollte. Sogenannte „Circulare“ wurden in allen Ämtern der Kronländer bekannt gegeben, um auf die neu errichtete Anstalt für Taubstumme in Wien aufmerksam zu machen. Schon bald war die Kapazität der zwölf Plätze überschritten.
Bereits im November 1779 erstattete Stork der Studienhofkommission einen Bericht über die von ihm „unterrichteten Tauben und Stummen“, in dem die folgenden Zöglinge mit den Angaben ihrer sozialen Herkunft und der Einschätzung ihrer Fähigkeiten aufgeführt sind (s. Tab. 2.1).
Tab 2.1: Storks Bericht an die Studienhofkommission8
„Allerunterthänigster Bericht Johann Friedrichs Stork des erzbischöflichen Kur Priester Über die von Ihm im Monathe November 1779 unterwiesenen Taubstummen Namen der Taubstummen Fähigkeiten und Fleiß Josepha Fräulein von Gudenus alt 25 Jahr Sehr gut Christoph Wachterk. k. Thürhüters Sohn, alt 19 Jahr Sehr guter thut sich unter allen Schülern am meisten hervor Veit Kreilitzk. k. Zögling, alt 38 Jahr Gut,er könnte aber seiner Fähigkeit nach fleißiger seyn Joseph Okowalskyk. k. Trabantens Sohn, alt 21 Jahr Sehr gut Bartholomäus Kramerin der Versorgung im Bürgerspitale, alt 24 Jahr Sehr gut Franz HeinrichTagwerkers Sohn, alt 13 Jahr, sehr arm Sehr gut Johann KramerBürgerl. Wollzeugmachers Sohn, alt 9 Jahr Sehr gut Franz ReithSchustermeisters Sohn, alt 9 Jahr Gut Anna FegerlSchneiders Wittib Tochter, alt 22 Jahr Gut besonders im Schreiben Aloysia Okowalskyeine Schwester des vorigen, alt 11 Jahr Sehr gut Theresia Fräulein von PrinaSchwester der Frau Hofrätin von Braun, alt 32 Jahr Gut auf ihre schwach Gedächtniß Aloysius WeinerTagswerkers Sohn, alt 10 Jahr Mittelmäßig Peter MollBedientens Wittib Sohn, alt 12 Jahr Sehr nachläßig in Schulgehen Thekla N.Ein Findling, alt bey 20 Jahr Etwas blöd, aber emsig Anton LinzMüllerknechts Sohn, alt 13 Jahr Etwas dumm Maria Anna Pöschl, alt 19 JahrUndMaria Anna Hörner, alt 17 Jahrbeyde k. k. ZöglingeSumma 17 GutFür den Anfang sehr gut J. Friedrich Storkk. k. Lehrer der Tauben und Stummen“öffentliche Prüfung
Nach Verlautbarung der „Wiener Zeitung“ vom 22. Dezember 1779 fand die erste genehmigte und öffentliche Prüfung der Zöglinge im Beisein „hochgestellter Persönlichkeiten“ der Wiener Gesellschaft statt. Stork hatte sogenannte „Prüfungszettel“ vorbereiten und drucken lassen, die den Lehrstoff der Prüfung enthielten und die jedem Besucher überreicht wurden.
Sowohl Stork als auch May kannten den Unterricht de l’Epées aus eigener Anschauung. Joseph May war mehrere Jahre als Deutschlehrer an der Pariser Militärakademie tätig gewesen und hospitierte nach seiner Nominierung für das Taubstummeninstitut in Wien gemeinsam mit Stork acht Monate lang in der Taubstummenanstalt de l’Epées. Aufgrund der engen Verbindung zu Frankreich war es nur naheliegend, dass die Wiener Anstalt die Methode de l’Epées übernahm – allerdings mit der Ausnahme, dass Lehrer May bereits frühzeitig mit einem Artikulationsunterricht begann. Diese Bemühungen und ihre offenbar günstigen Resultate wurden anlässlich einer weiteren öffentlichen Vorführung im Jahre 1780 dem erstaunten und begeisterten Publikum präsentiert. Die Reaktion des Kaisers bestand darin, May eine Gehaltserhöhung von 100 fl Gulden zu gewähren.
Mit dem Dekret vom 8. September 1784 legte Joseph II. fest, dass die Zahl der Zöglinge auf 30 zu erhöhen sei, allerdings mit dem Zusatz, dass diese bei Schülern mit besonderen Fähigkeiten auch überschritten werden dürfe. Schon nach kurzer Zeit befanden sich 31 männliche und 16 weibliche Zöglinge im Taubstummeninstitut von Wien.
Johann Strommer
Allerdings kam es schon bald zu Konflikten zwischen Stork und May, die vor allem auf unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich des Unterrichts Gehörloser beruhten. Die Kritik an der Unterrichtsmethode Storks verschärfte sich, als 1783 ein dritter Lehrer, Johann Strommer, eingestellt wurde. May und Strommer hatten der Studienhofkommission berichtet, dass Stork das ganze Jahr über nur die Fragen und Antworten unterrichtete, die er für die öffentlichen Prüfungen bestimmte. Die Schüler wüssten bereits vor der Prüfung die Antworten auswendig, und auf diese Weise würde Stork das Publikum täuschen.
Entlassung Storks und Methodenwechsel
Die Kritik an Stork zielte zugleich auf die Methode seines Vorbildes de l’Epée, dessen Verfahren nun grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Der Methode de l’Epées wurde der Vorwurf gemacht, dass sie weder das Sprachverständnis Gehörloser befördere noch die gesellschaftliche Kommunikation und damit die gesellschaftliche Eingliederung der Betroffenen bewirke. Am 28. September 1792 wurde Direktor Stork von seinem Amt entfernt und an seine Stelle der Lehrer Joseph May berufen;9 damit war zugleich ein Wechsel in der Methode des Unterrichts zugunsten einer stärkeren Beachtung der Lautsprache entschieden.
Ziel: bürgerliche Brauchbarkeit
Mit dem Wechsel in der Leitung der Wiener Taubstummenanstalt von Stork zu May war aber auch die erste Institutionalisierungsetappe des Wiener Taubstummeninstituts abgeschlossen. Die Wiener Anstalt verdankte ihre Entstehung und weitere Entwicklung großzügiger staatlicher Unterstützung, wobei ihr vorrangiges Ziel nicht in erster Linie eine zweckfreie Entfaltung der persönlichen Kräfte des einzelnen Zöglings, sondern die Vorbereitung auf ein späteres Erwerbsleben war. Die 1793 für das Taubstummeninstitut erlassenen Grundsätze belegen unmissverständlich, dass Auswahl der Zöglinge und Zweck der Anstalt dem übergeordneten Ziel der Erziehung zur bürgerlichen Brauchbarkeit dienten:

„1. Der Endzweck, den der Staat durch das k. k. Taubstummen-Institut zu erreichen sucht, ist gehör- und sprachlosen Kindern nach einer eigenen, ihren Organisations-Fehlern angemessenen Lehrart, Unterricht und Übungen in gemeinnützlichen, und zum bürgerlichen Leben unentbehrlichen Kenntnissen so lange zu verschaffen, bis sie imstande sind, sich selbst ihren Lebensunterhalt zu erwerben, und wieder anderen Unglücklichen dieser Art im Institute Platz zu machen.“
Hinsichtlich der weiblichen Taubstummen heißt es unter Punkt 10:
„Die weiblichen taubstummen Zöglinge müssen in allen weiblichen Arbeiten, als Nähen, Stricken, Märken, Spinnen, Kochen u. s.w. unterrichtet, und dadurch in Stand gesetzt werden, bey dem Austritte aus dem Institute sich selbst ihren Unterhalt bey ihren Ältern oder in Diensten auf die thunlichste Weise zu verschaffen.“10
Ausrichtung auf Erwerbsleben
Entsprechend der utilitaristischen Zielsetzung war auch der Unterricht nicht für alle Schüler gleich. Die Zöglinge wurden vielmehr in drei Klassen aufgeteilt: Die erste Klasse hatte täglich vier Unterrichtsstunden und sechs Handarbeitsstunden, die zweite Klasse drei Unterrichts- und acht Handarbeitsstunden, und die dritte erhielt schließlich nur zwei Unterrichtsstunden, arbeitete die übrige Zeit jedoch in- oder außerhalb des Instituts bei ihrem Lehrherren. Mit der Ausrichtung auf das Erwerbs- und Arbeitsleben in der Ära nach Joseph II. reihte sich auch das Wiener Taubstummeninstitut in ein Bildungswesen ein, das in der Folgezeit vor allem der Bekämpfung der Armut dienen sollte (Engelbrecht 1984, 240).
Leipzig
2.2.4 Die Taubstummenanstalt
Wie de l’Epée in seinem Werk „Die Unterweisung der Taubstummen durch die methodischen Zeichen“ von 1776 erwähnt hatte, wurde tatsächlich im Jahre 1778 durch den Kurfürsten Friedrich August von Sachsen in Leipzig das erste Taubstummeninstitut in einem deutschen Land eröffnet. Berufen zur Leitung wurde Samuel Heinicke (1727–1790), der bereits über eine mehrjährige Erfahrung in der Unterrichtung taubstummer Personen verfügte.

Samuel Heinicke
Heinicke war ein glühender Verfechter der Lautsprache und geriet damit in Widerspruch zu de l’Epée, mit dem er in den Jahren 1781/82 eine fünf Briefe umfassende kontroverse Korrespondenz führte. Die Differenz zwischen Lautsprachmethode und Gebärdensprache hat hier ihren Ursprung – und sie wirkte bis in das 20. Jahrhundert fort, nationalistisch überhöht, als Gegensatz von „deutscher“ und „französischer“ Methode (List 1991).
So veröffentlichte Paul Schumann aus Leipzig, zweifellos der beste deutschsprachige Kenner der historischen Gehörlosenpädagogik, die Früchte seiner langjährigen Forschungstätigkeit zu einer Zeit (1940), als erneut größter Wert auf die Hervorhebung des Deutschtums gelegt wurde. Die von der Reichsfachschaft V Sonderschulen im NS-Lehrerbund herausgegebene Schrift trug den Titel „Geschichte des Taubstummenwesens vom deutschen Standpunkt aus dargestellt“. Dieser kompromittierende Titel sowie die zeitgeschichtlichen Umstände hatten zur Folge, dass dieses kenntnisreiche und differenzierte wissenschaftliche Werk über lange Zeit nicht die Würdigung erhielt, die es verdient.
Kontrahenten: de l’Epée – Heinicke
Betrachtet man die Protagonisten und Kontrahenten de l’Epée und Heinicke, so lassen sich kaum größere Gegensätze vorstellen: auf der einen Seite der katholisch-aufklärerisch geprägte Priester de l’Epée, durch akademische Studien gebildet, gut situiert, der als alleinstehende Person über genügend Zeit verfügte, um seine selbstgewählte Aufgabe praktisch zu erproben und theoretisch zu begründen. Wir haben somit eine Person vor uns, die in großer Unabhängigkeit national und international agieren konnte. Auf der anderen Seite der vermögende Bauernsohn Samuel Heinicke aus Sachsen, pietistisch erzogen, Autodidakt, der, von großem Bildungshunger getrieben, der dörflichen Enge entfloh und als 23-Jähriger sich als Soldat bei der Leibgarde in Dresden verdingte. In seiner freien Zeit nahm er Privatunterricht in Latein, Französisch, Mathematik und Musik und begann schon während seiner Dresdner Zeit einen taubstummen Soldaten zu unterrichten und Literatur über die Erziehung und Bildung Gehörloser zu lesen.
Biografie Heinickes
Bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges floh Heinicke vor den Preußen, wurde Student in Jena (Philosophie, Mathematik, Naturlehre) und kam auf der Flucht vor den preußischen Häschern 1758 in das dänische Altona. Altona und Hamburg waren zur damaligen Zeit eine Hochburg der Aufklärung und des Philanthropismus (Overhoff 2004), und es muss angenommen werden, dass Heinicke, der sowohl in Altona als auch in Hamburg ab 1760 als Privatlehrer und Hofmeister tätig war, nicht nur Kontakt zu den Repräsentanten der aufklärerischen Reformpädagogik hatte, sondern auch wichtige Impulse von ihnen empfing. So berichten Georg und Paul Schumann (1912) in der biografischen Einleitung zu den von ihnen herausgegebenen Schriften Samuel Heinickes, dass der Druck seiner biblischen Geschichte für Taubstumme den Beifall von „angesehenen Gelehrten“ wie Reimarus fand, der neben Richey zu den wichtigsten Repräsentanten der hamburgischen Frühaufklärung zählte, und Schumann erwähnt, dass Heinicke in Altona „von 1763–1768 als Hofmeister in der vornehmen Familie des dänischen Residenten und Schatzmeisters Heinrich Carl Schimmelmann Verwendung fand“ (Schumann 1940, 146).
Heinicke war von 1768 bis 1777 Küster, Organist und Lehrer in Eppendorf bei Hamburg. Während dieser Zeit unterrichtete er mehrere taubstumme Schüler in der lautsprachlichen Methode und verfasste seine ersten Aufsätze. Heinicke bewarb sich beim sächsischen Kurfürsten um die Leitung der geplanten Gehörlosenschule, und er war erfolgreich. 1778 übersiedelte er mit seiner Familie sowie neun gehörlosen Zöglingen nach Leipzig.
Heinicke ein Kind der Aufklärung
Wie sehr Samuel Heinicke ein Kind der Aufklärung war, belegt der folgende Auszug aus seiner Schrift „Über die Denkart der Taubstummen, und die Mißhandlungen, welchen sie durch unsinnige Kuren und Lehrarten ausgesetzt sind. Ein Fragment“ von 1780, in der er gegen Vorurteile und Unwissenheit und für die Menschenrechte Gehörloser stritt:
„Noch vor Kurzem brachte ein Vater seinen taubstummen Sohn zu mir, und wollte ihn unterrichten lassen, den ich aber nicht annehmen konnte, so gern ich auch wollte, weil man ihm die Zunge gelähmt hatte. Ich will das Gespräch hersetzen, welches ich mit dem Vater dieses unglücklichen Knaben hielte. Nach vorhergegangenen Höflichkeiten sagte Er: Ich habe sehr viel an meinen Sohn gewandt; ich habe Vermögen, und gerne wendete ich noch einige tausend Thaler für ihn an, wenn er nur sprechen lernte; alle Arzneyen hat er schon gebraucht; und dreymal habe ich ihm die Zunge lösen lassen.
Ich: Das ist entsetzlich! Wer hat denn Ihrem Sohne die Zunge gelöst?
Er: Unser Physicus.
Ich: Euer Physicus? Wer?
Er: Ja Herr. Er ist ein studirter, sehr geschickter, und weit und breit berühmter Mann.
Ich: Gott erbarme sich der Kranken, die bey ihm Hülfe suchen!
Er: Ey warum aber das?
Ich: Aber auch eine Frage: Können Sie die spanische Sprache?
Er: Nein, davon habe ich in meinem Leben kein Wort gehört.
Ich: Nicht – Aber muss man denn eine Sprache hören, wenn man sie will reden lernen?
Er: Das dächt ich doch.
Ich: Auch ich denke es. Und kann denn Ihr Sohn hören?
Er: Nein, auch nicht einmal einen Kanonenschuss.
Ich: Und nun besinnen Sie sich einmal – Wie kann denn Ihr Sohn die deutsche Sprache reden lernen, wenn er von keinem Menschen jemals ein deutsches Wort sprechen gehört hat?
Er: Nun sehe ichs ein – erkenne meinen Irrtum. Gott! was hat mein Sohn vergebens ausstehen müssen! Der dumme Physicus! hätte ich ihn doch nie gesehen!
Ich: Beruhigen Sie sich: denn alles diess kann nun weder Ihnen noch Ihrem Sohne helfen. Dem Physicus aber möchte wohl durch die Obrigkeit bedeutet werden: dass er künftig in Fällen, wo er nichts versteht, vorsichtiger werde, verständigere Männer, als er ist, um Rath frage, und dem Henker nicht ins Handwerk falle.
Traurig und trostlos musste der bekümmerte Vater von mir gehen. Seinen unglücklichen Sohn aber, dem die Zungenbänder zerschnitten waren, und dessen Zunge daher dick und unbeweglich war, musste ich seinem Schicksale überlassen, und konnte dabey nichts thun, als – mitempfinden und bedauern.
Hier klagt das Unglück selbst die Unwissenheit an; und es ist sehr betrübt, einen Menschen, aus Irrthum, verstümmelt zu sehen, dem auf keine Weise wieder geholfen werden kann […]
Es fällt mir noch Etwas bey, nämlich die Leute, die über den unglücklichen Zustand der Stummen spotten, sie, als wenn sie nicht auch Menschen wären, übel behandeln und zum Narren brauchen, auch wohl gar ihre Aeltern darüber aufziehen und sie verunglimpfen, dass sich deswegen manche ihrer stummen Kinder schämen. Allein es ist sehr thöricht über Anderer Unglück zu spotten, das doch auf so mancherley Weise einem Jeden alle Tage begegnen kann. Aeltern aber haben gar nicht nöthig, sich ihrer taubstummen oder gebrechlichen Kinder wegen zu schämen. Auf die Frage wegen einem Blindgebornen an unsern Heiland: Wer hat gesündigt, dieser, oder seine Aeltern? war die Antwort von ihm: Weder dieser noch seine Aeltern haben gesündigt, sondern dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werde an ihm. Joh. 9, 3.“ (Heinicke 1912, 87f u. 103f)
Unterricht armer Landeskinder
Das Besondere an dem kurfürstlichen Taubstummeninstitut zu Leipzig war nicht nur sein staatlicher Charakter, sondern die Tatsache, dass, laut Berufungsurkunde, auch „arme Landeskinder“ unentgeltlich zu unterrichten seien. Heinicke, der in zweiter Ehe verheiratet war und selbst vier Kinder aus erster Ehe hatte, begann mit etwa zehn gehörlosen Kindern seine Tätigkeit in Leipzig. Rechtlich unterstand das Institut der Leipziger Universität; die Räumlichkeiten waren zunächst sehr beengt.
Heinicke hegte große Pläne zum Ausbau eines international anerkannten Taubstummeninstituts, doch die Verhältnisse waren anders. Samuel Heinicke konnte in dem international geführten Gelehrtendisput um die „richtige“ Methode als Autodidakt und zudem als impulsive, wenig diplomatische Person nicht gewinnen. Er unterlag in der akademischen Welt in seinem Streit mit de l’Epée vor der Züricher Akademie im Jahre 1783 (Ernst 1906). Heinicke befand sich stets in materieller Abhängigkeit und finanzieller Not, was ihn letztlich auch hinderte, seine ausgearbeitete Lehrmethode sowie sein „Berufsgeheimnis“ (genannt „Arkanum“) zu veröffentlichen. Paul Schumann urteilt:
„Es ist eine tiefe Tragik im Leben Heinickes: Überall klafft der Gegensatz zwischen Idee und Ausführung. Heinicke stellte das Prinzip des in der Lautsprache sprechenden und in dieser Sprache denkenden Taubstummen auf und konnte doch nur selten seine Verwirklichung in vollkommener Form zeigen.“ (Schumann 1940, 147)
Heinickes Gesundheit litt zunehmend; Geld-, Existenzsorgen und Rivalitäten nahmen kein Ende, und die großen Pläne erfüllten sich nicht. Nur 63-jährig verstarb Samuel Heinicke am 30. April 1790. „Verarmt und unversorgt hinterließ der Verstorbene die junge Witwe, denn ein 1782 beantragtes Witwengehalt war nicht bewilligt worden.“ (Winkler 1993, 326)
allgemeine Volksbildung
Heinicke war aber nicht nur ein Pionier der Gehörlosenpädagogik, sondern auch ein bedeutsamer Anreger der allgemeinen Volksbildung, insbesondere des Leseunterrichts in der Volksschule, für den er 1780 seine Fibel „Neues A, B, C, Sylben- und Lesebuch“ vorlegte. Darin geißelte er die herkömmliche Buchstabiermethode und forderte stattdessen, beim Leselehrgang bei den Lauten, also bei der Artikulation, anzusetzen:

Abb. 2.3: Heinickes Fibel 1780
„Die gewöhnliche Lesemethode beruhet auf einem alten Schlendrian, dieser aber auf einem Vorurtheile, das noch eine ganze Heerde Junge nach sich schleppt, wovon immer eins abscheulicher als das andre ist, und dieses Vorurtheil heisst Buchstabiren – vor der Lesekunst. Man hat bisher geglaubt, durch diese einzelne Tonleierei lesen zu lernen; allein das ist ganz unmöglich, und so lange die Welt steht, hat noch nie ein Mensch eine Sprache durch Buchstabiren lesen gelernt.“ (Heinicke 1912, 523)
Plan: Lehrerseminar
Schließlich unterbreitete Heinicke seinem Kurfürsten 1784 einen Plan zur Errichtung eines Lehrerseminars, das in räumlicher Nähe zu dem Taubstummeninstitut stehen sollte, so dass eine enge Verbindung zwischen Elementar- und Taubstummenpädagogik in der Lehrerausbildung erreicht würde (Heinicke 1912, 544ff).

Anna C. E. Heinicke
Das Leipziger Taubstummeninstitut hätte nach dem Tode Heinickes vermutlich über kurz oder lang seine Existenz eingebüßt – es gab viele Widersacher, nicht zuletzt in der Universität vor Ort –, wenn nicht eine Frau auf den Plan getreten wäre, die energisch, kompetent und mit viel psychologischem Geschick das Haus weiterführte: Anna Catharina Elisabeth Heinicke (1757–1840). Es war Heinickes Witwe, die 1790 noch eine junge Frau war und die bis zum 1. Januar 1829, also fast 50 Jahre lang, die Gehörlosenschule leitete. Anna C. E. Heinicke gelang es, die Zustimmung des Kurfürsten zur Weiterführung des Instituts unter ihrer Leitung zu erwirken, und sie organisierte erfolgreich die Neueinstellung von Personal sowie den Umzug in bessere Lokalitäten. Sie initiierte die Einführung einer jährlichen Landeskollekte zur Unterstützung der Schule, und sie wurde nicht müde, durch rege Öffentlichkeitsarbeit das Interesse des Publikums für die Leipziger Anstalt zu wecken. Sie legte für die zahlreichen Besucher ein Gästebuch an, in das sich Johann Wolfgang Goethe unter dem Datum vom 7. Mai 1800 eintrug.
Anna Heinicke als Pädagogin
Anna C. E. Heinicke war nicht nur eine glänzende und phantasievolle Organisatorin, sondern zugleich eine kompetente Fachfrau. Joachim Winkler, der ein eindrucksvolles Portrait ihrer Person gezeichnet hat, berichtet auch von ihren pädagogischen Aktivitäten. So regte sie an, eine Überprüfung der „Verstandes- und Unterrichtsfähigkeit“ zukünftiger Schüler vorzunehmen, wobei sie klare diagnostische Kriterien vorschlug:
„Man frage die Eltern, ob das Kind zu häuslichen, seinem Alter und Kräften angemessenen Verrichtungen zu gebrauchen ist – ob es mit anderen Kindern spielt – ob es sich wieder nach seiner Eltern Haus finden kann, wenn es so weit davon entfernt ist, daß das Kind es nicht mehr sieht – ob es Kleinigkeiten für kleine Münze holen […] ob er zählen kann, ob er bemerken kann wie viel Stühle, Tische, Personen in der Stube sind und wenn einiges davon wegenommen, wie viel noch übrig u wie viel fehlet […] Auch womit er sich beschäftiget, ob er Lust zur Arbeit zeiget oder ob er unbeschäftiget mehrere Stunden in Unthätigkeit bleibet.“ (Winkler 1993, 336)