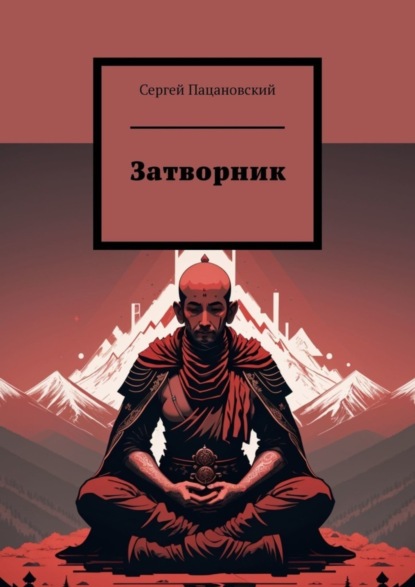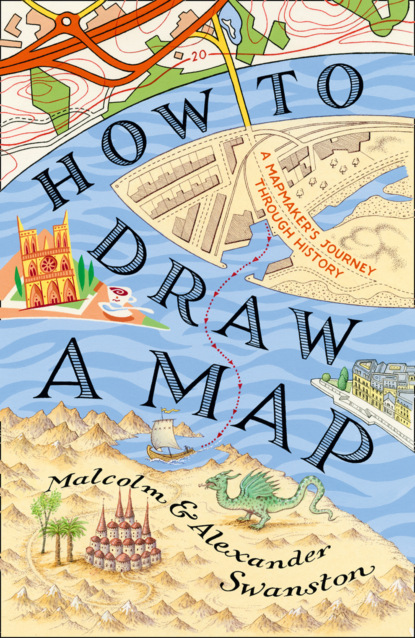- -
- 100%
- +
Ihr psychologisches Geschick und Einfühlungsvermögen zeigen sich, wenn sie Überlegungen anstellt, wie eine Überprüfung der Fähigkeiten vonstatten gehen solle:

Abb. 2.4: Goethes Eintrag in das Fremdenbuch der Taubstummenanstalt zu Leipzig am 7. Mai 1800

„Eine solche Prüfung muß freilich von solchen Personen, die dem Kinde bekannt sind angestellt und vielleicht öfter wiederholt werden bis das Kind erst Zutraun zu dem Fragenden bekömt. Es ist dabei die äußerste Behutsamkeit nöthig um nicht zu bald über ein solch unglückliches Wesen abzustimmen. Die hl. Prediger und Schullehrer eignen sich am besten zu dieser menschenfreundlichen Untersuchung, denn bei ihnen und in ihrer Behausung ist nichts was den unglücklichen Taubstummen zurück schreckt. Ein liebevolles Annähern wird ihnen sein Zutraun erwerben. Nicht so ist es, wenn sie in eine Amtstube treten, da wird das Gemüth eines solchen Kindes beängstiget, es weiß nicht was die Herren von ihm wollen, es tritt schon in sich zurück […]“ (Winkler 1993, 336; die alte Schreibweise wurde leicht verändert, E.-R.)
Ausgestattet mit den Geldern einer Stiftung kaufte Anna Heinicke 1821 ein Haus mit Grundstück und hatte endgültig die Existenz des Leipziger Taubstummeninstituts gesichert.
„So ging nach genau 44 Jahren des Bestehens der Leipziger Taubstummenanstalt ein langgehegter Traum in Erfüllung. Unabhängig von Hauseigentümern, finanziell gesichert, mit wesentlich erweiterter Aufnahmekapazität ausgestattet, beherbergte das neue Institut im Jahre 1823 bereits 38 Schülerinnen und Schüler. Sie lernten in vier Klassen und hatten pro Woche 40 Stunden Unterricht. Dieser verteilte sich auf die Wochentage Montag bis Sonnabend und wurde nachmittags von 14 bis 17 Uhr erteilt.“ (Winkler 1993, 338)
Schülerbiografien
Und was wissen wir über die Schüler des Leipziger Taubstummeninstituts? Wie sah ihr Alltag aus, und gelang es ihnen, sich in der Gesellschaft zu behaupten und ein eigenständiges Leben zu führen? Überlieferte Zeugnisse veranschaulichen Institutsalltag und Biografien einzelner Zöglinge und erfüllen so Ereignisse von vor mehr als 200 Jahren mit Leben.
Georg A. Hoffmann
Der spätere, hochgeehrte Kunstmaler Georg Andreas Hoffmann, der 1793 zum Mitglied der „Königlich-Preußischen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften“ gewählt wurde, war seit 1781 Schüler bei Samuel Heinicke. Er stammte aus der Nähe von Bayreuth und war das vierte von insgesamt 15 Kindern eines evangelisch-reformierten Pfarrers, wobei neun der 15 Kinder als taubstumm galten. Georg Andreas besuchte zunächst keine Schule und lebte bis zum 28. Lebensjahr im Elternhaus; in seiner Freizeit ging er seinem Hobby nach: Malen und Zeichnen. Initiiert und auch finanziert durch einen aufgeklärten Reformer, den Freiherr von Erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, kam G. A. Hoffmann in die Taubstummenschule von Leipzig. Über seine Schulzeit lesen wir:
„Der 28jährige Georg Andreas war der älteste ‚Zögling‘ in Heinickes kleiner Residenz am Roßplatz und – ab 1782 – in der Klostergasse beim Thomaskirchhof. In der Klostergasse lebte Hoffmann bis 1784 mit der Familie Heinicke und weiteren 11 Schülern unterschiedlichen Alters. Wie schon in Eppendorf, waren die ‚Lehrlinge‘ voll in den Familienalltag Heinickes integriert. In den Räumen einer Etage schlief, speiste und lernte man gemeinsam; Freiluftaufenthalte erfolgten zumeist gruppenweise unter Aufsicht Heinickes oder seiner Frau. Bei Heinicke fühlten sich nicht alle ‚Zöglinge‘, aber zweifellos der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Georg Andreas ‚besser aufgehoben, als in ihrer Aeltern Hause‘ […]
Vor allem war die Beköstigung bei Heinicke für die Zeitverhältnisse ausgesprochen üppig. Es gab vier Mahlzeiten am Tag, mehrmals in der Woche Fleisch sowie reichlich Gemüse. Zu den Getränken, die gereicht wurden, gehörten (auch für Kinder!) Bier, Wein und Kaffee. Auch übermäßige Strenge mußten die Schüler im allgemeinen nicht fürchten. Ultima ratio der Strafen für faule, unachtsame, nachlässige und unfolgsame Kinder war der Ausschluß von den Mahlzeiten und Gemeinschaftsspielen. Lediglich die beengten Verhältnisse im ‚Churfürstlich Sächsischen Institut‘ gaben den Revisoren der Universität Leipzig, der die Aufsicht oblag, immer wieder Anlaß zu Beanstandungen […]
Georg Andreas Hoffmann hat sicherlich nichts dabei gefunden, mit jüngeren Mitschülern in einer kleinen Kammer zusammen zu wohnen. Das war er von Haus aus gewohnt. In der Kommunikation mit seinen Mitschülern konnte er die natürlichen Gebärden ‚testen‘ und weiter ausbilden, die er mit seinen gehörlosen Geschwistern entwickelt hatte. Die Gebärde war und blieb sein wichtigstes Verständigungsmittel im Umgang mit der hörenden Umwelt. Auf die Aneignung der Lautsprache legte er keinen gesteigerten Wert. Entsprechend bescheinigte ihm Anna Catharina Elisabeth Heinicke ‚geringe Fortschritte‘ beim Sprechenlernen […] nach Heinickes Lautiermethode. Aber Schreiben und Lesen lernte er einigermaßen, auch wenn es ihm mit seinen 28 Lebensjahren nicht leichtgefallen sein dürfte.
Zusammen mit Hoffmann besuchte der spätere Meißner Porzellanmaler Johann Gottfried Posselt (Posselt, 1770–1809) das Heinicke-Institut. Es ist denkbar, daß das gemeinsame Interesse an der Malerei eine engere Verbindung zwischen dem 18 Jahre Jüngeren und Georg Andreas bewirkte. Zusammen immatrikulierten sich beide – auf Vermittlung Heinickes – als Studenten […] an der Leipziger Kunstakademie […]“ (Feige 1999, 33)
Christian A. Schlick
Einige seiner Zöglinge konnte Samuel Heinicke in dem sehr angesehenen Beruf des Porzellanmalers in Meißen unterbringen. Einer von ihnen war Christian August Schlick, der aus Leipzig stammte und der nach der Übersiedlung des Heinicke’schen Instituts von Hamburg-Eppendorf nach Leipzig 1778 als 30-Jähriger aufgenommen worden war. Schon nach zwei Jahren wurde C. A. Schlick mit der Konfirmation entlassen und trat als Lehrling in die Kurfürstliche Sächsische Porzellanmanufaktur in Meißen ein, wo er bis zu seinem Lebensende mit 70 Jahren tätig war. Hans-Uwe Feige schreibt über seinen Arbeitsalltag:
„Christian August Schlick war derjenige von Heinickes ‚Lehrlingen‘, der am längsten an der Porzellanmanufaktur Meißen arbeitete. Er erlebte, wie der erblindete Zeichenschüler Johann Adam Ernst Backmann ins Armenhaus Waldheim geschickt wurde (1799). Er überlebte den wesentlich jüngeren Johann Gottfried Posselt, der 1809 an Wassersucht verstarb. Gehörte er – nun mit seinen bald 30 Dienstjahren ein Senior unter den Manufakturisten – zu den Porzellanarbeitern, die am 3. April 1810 mit zwei Wagen nach Dresden fuhren, um die drohende Schließung der Fabrik zu verhindern? Sicherlich nahm er an dem Volksfest teil, mit dem im gleichen Jahr das 100. Gründungsjubiläum der ältesten europäischen Porzellanmanufaktur in Meißen begangen wurde: reich geschmückte Straßen und eine festliche Illumination prägten die Stadt, Turmblasen und ein gemeinsamer Gottesdienst im Dom vereinten Bürger und Porzellanarbeiter; 412 Arbeiter, Angestellte und Künstler, 22 ‚angestellte Frauenzimmer‘, 28 Pensionäre, 331 Ehefrauen und 154 Witwen waren in die Festzelte auf der Schützenwiese geladen […]
Christian August Schlick erlebte die zweimalige Besetzung Meißens durch Napoleon (1806 und 1812/1813). Im September/Oktober 1813 stand Meißen im Zentrum der Kampfhandlungen. Nach der ‚Beschlagnahme‘ unentbehrlicher Arbeitsmittel, Werkzeuge, Brennstoffe und Feuerlöschgeräte durch preußische und russische Offiziere mußte die Arbeit in der Manufaktur im September 1813 völlig eingestellt werden […] Der in Dresden residierende russische General-Gouverneur Fürst Repin reformierte die Meißner Manufaktur radikal. Ihre Belegschaft wurde auf 328 Mitarbeiter reduziert. Christian August behielt seinen Job in der Brennerei. Aber in die neu eingeführte vier-klassige Rangordnung der Porzellanmaler […] fand er keinen Eingang […] Christian August Schlick blieb trotz angegriffener Gesundheit bis ins hohe Alter berufstätig. Im Alter von 70 Jahren […] verstarb der gehörlose Porzellanmaler ohne den Pinsel aus der Hand gelegt zu haben. Die Sterbe-Caße der Porzellanmanufaktur Meißen stellte für seine Beerdigung 70 Taler und 6 Groschen bereit.“ (Feige 1999, 51f)
Als nach dem Tode Samuel Heinickes 1790 dessen Witwe für die weitere Existenz der Schule kämpfte, überprüfte eine Kommission, bestehend aus 30 Professoren der Leipziger Universität, die Leistungen der Schüler. Das Gutachten fiel insgesamt positiv aus, und damit war die Voraussetzung für das Fortbestehen des Instituts gegeben; nur eine Sache wurde negativ vermerkt: Die Schüler zeigten ungenügende Leistungen im Schreiben mit Feder und Tinte auf Papier.
Tagebuch-aufzeichnungen
Die erfindungsreiche Anna C. E. Heinicke ersann ein didaktisches Mittel, um diese Fertigkeit bei den Schülern zu üben: Sie regte zum Schreiben von Tagebüchern an. Aus den Tagebuchaufzeichnungen des Schülers Adam Ernst G. Backmann erfahren wir nicht nur etwas über den Alltag innerhalb des Taubstummeninstituts, sondern auch über die Kontakte zur Außenwelt, die sich recht liberal gestalteten.
„Sehr beliebt war bei den Heinike’schen Pensionären das Bad in der Pleiße während der Sommermonate. Ein bevorzugter Spielplatz war der Boden des fünfstöckigen Miethauses am Neuen Kirchhof, in dem Heinicke sein Institut 1785 auf einer ganzen Etage untergebracht hatte. In Backmanns Aufzeichnungen finden sich Schilderungen von Spielen der Schüler und der Töchter Heinickes […] auf dem Boden. Außerdem diente er als ‚Ausguck‘. Von seinen Fenstern aus beobachteten Adam Ernst und seine Mitschüler die vorbeiziehenden Passanten, zumeist Handwerker oder Bauern auf dem Weg zum Markt. Seine bevorzugte Freizeitbeschäftigung waren allerdings ausgedehnte Spaziergänge in der Allee […]
Alle seinerzeit berühmten Leipziger Gärten kannte Adam Ernst. Als ‚vorzüglich verständiger‘ Lehrling durfte er ‚ohne sichere Begleitung‘ ausgehen […] den Tagebucheintragungen nach zu schließen, nutzte er dieses Privileg ausgiebig. Überall beobachtete er die Mitbürger genau bei ihren Verrichtungen. ‚Ich habe gestern viel nackende Menschen gesehen‘, notierte er unter dem 18. Juni 1790, ‚sie hatten Hemde, Schuhschnallen, Hoth, Strümpfe, Halstuch und alle Kleider ausgezogen, badeten sich im Wasser und gingen hernach spazieren, wenn sie sich wieder angezogen hatten‘ […] Wichtig war ihm, wie ihm bekannte Personen gegenübertraten: ob sie grüßten zum Beispiel. Lobend erwähnt wurde ein Bauer namens Rudolph aus dem Heimatdorf Grethen, den Adam Ernst eines Sonntagmorgens 5 Uhr in der Grimmaischen Gasse traf: ‚Er hat den Hut vor mir abgenommen‘ […]
Als ältester ‚Lehrling‘ im Heinicke-Institut genoss Adam Ernst Backmann gewisse Vorrechte. So durfte er den Lehrer Petschke begleiten, wenn dieser für das Institut einkaufen ging. Ihm war der Schlüssel für die Speisekammer der Pension anvertraut. Zuweilen ließ er sich von der Mitschülerin Anna Dorothea Richter oder dem Mitschüler Johann Christoph Hofmann dazu verleiten, den begehrten (Kandis-)Zucker zu verteilen, wenn Madame Heinicke schlief […] Zusammen mit Christian Friedrich Irmscher wurde Adam Ernst zur Erledigung kleinerer handwerklicher Tätigkeiten in den Räumlichkeiten des Instituts herangezogen.
Adam Ernst Gottlieb Backmanns Schulzeit in Leipzig endete am 27. Januar 1792. Er mußte das Institut A. C. E. Heinickes ohne förmlichen Abschluß und ohne Konfirmationsexamen verlassen, ‚weil ihm sein Vater, ehe dieses geschehen konnte, eine Stelle in Meißen bei der dasigen Porzellanfabrike … ausbedungen hatte‘ […] wie in der Matrikel nachzulesen ist. Frau Heinicke hat das bedauert. Ihrem ehemaligen Schüler bescheinigte sie abschließend, ‚seine Gedanken ziemlich correct zu Papier bringen, auch sonst fleißig und ein guter Kopf‘ zu sein […] Den Ausbildungsplatz in Meißen hat der Vater vermutlich unter Vorlage der Blumenzeichnungen seines Sohnes erwirkt.“ (Feige 1999, 68ff)
Diese durch Selbstzeugnisse beschriebene familiäre und zugleich bildungsorientierte Lebenssituation der Leipziger Zöglinge beeindruckt als ein positives Beispiel für die ersten Bildungsanstrengungen mit behinderten Kindern und Jugendlichen – vielleicht war es sogar eine Ausnahme.
Gefährdung von Menschen mit Behinderung in Notzeiten
Zu einem Zeitpunkt, zu dem noch längst nicht für alle Kinder und Jugendliche Bildungsangebote bereitgestellt wurden, verwundert es nicht, dass die ersten planmäßigen Unterrichtsversuche für Schüler mit Behinderung zunächst in eher bescheidenen Bahnen verliefen. Die beiden Pariser Anstalten, wir erinnern uns, sind hierfür beispielhaft; denn sie waren fortwährend durch materiellen Mangel und immer weiteres Zurückdrängen des Bildungsanspruchs bestimmt. Aber auch in anderen Ländern zeigte sich das Phänomen, dass in Not- und Mangelsituationen jene am weitesten an den Rand gedrängt werden, die am bedürftigsten sind.
Gehörlosenschule Madrid
Als Napoleon Spanien besetzte und die Bevölkerung unter Entbehrung und Hunger litt, traf dies besonders stark jene junge Institution, die 1805 als staatlich unterstützte Taubstummenschule in Madrid ihre Tore geöffnet hatte. In nahezu aussichtsloser Situation siedelte der gehörlose Kunstlehrer Roberto Francisco Prádez 1811 mit sechs gehörlosen Schülern an die städtische Schule von San Ildefonso über, und der Bericht hierüber lautet:
„Dort erwartete sie ein kühler Empfang. Da die gehörlosen Jugendlichen deutlich älter waren als die Kinder an der städtischen Schule, befürchtete man, daß sie einen schlechten Einfluß ausüben könnten. Deshalb wurde rigoros die totale Trennung der beiden Gruppen durchgesetzt. Die Verbindungstür vom Zimmer der gehörlosen Schüler zum Rest der Schule wurde von außen verschlossen, der Schlüssel wurde fortgenommen und obendrein wurde noch ein Riegel über die Außenseite genagelt […] Obwohl sich auf dem Schulgrundstück ein Brunnen befand, wurde Prádez und seinen Schülern der Zugang zu diesem verweigert, und sie mußten Wasser aus einem öffentlichen Brunnen in der Nachbarschaft holen […] Sie durften nicht im Speisesaal der Schule essen, und ihre Verpflegung, zwei magere Mahlzeiten pro Tag, wurde in einem öffentlichen Gasthaus zubereitet […] Die Kinder waren barfuß, ihre ungewaschenen Kleider zu Lumpen heruntergekommen […] In einen einzigen Raum eingesperrt waren sie wie Gefangene in San Ildefonso. In derartigen Umständen fand ein Beobachter, es sei nicht […] verwunderlich, daß sie sich damit unterhalten, ihr Quartier zu ruinieren, indem sie alles in den Abort werfen, was ihnen in die Finger kommt, nachdem sie ihn vollkommen zerschlagen und den Abfluß mit Knochen, Steinen und Schutt verstopft haben.“ (Plann 1993, 75)
Dennoch, nachdem die ersten Schulgründungen für Gehörlose und Blinde erfolgt waren, war die Idee der Bildsamkeit behinderter Menschen international nicht mehr aufzuhalten:
erste Schulgründungen
Schulen für Gehörlose
1763: Paris, Edinburgh
1778: Leipzig, Wien
1784: Rom
1786: Prag
1787: Bordeaux
1788: Berlin
1790: Groningen
1800: Waitzen (Vác/Ungarn), Barcelona
1805: Madrid
1806: Pawlowsk, St. Petersburg
1807: Kopenhagen
1808: Gent
1809: Stockholm
1824: Trondheim
1846: Porvoo/Bargo/Helsinki
Schulen für Blinde
1791: Liverpool
1792: Edinburgh
1793: Bristol
1799: London
1804: Wien
1806: Berlin, Glasgow
1807: Mailand, St. Petersburg (Leiter Haüy)
1808: Prag, Amsterdam, Stockholm
1809: Dresden, Zürich
1811: Kopenhagen
1861: Christiania (Oslo)
1865: Helsinki
Anstalten für Taubblinde
1832: Boston/USA
1860: Larnay bei Poitiers/Frankreich
1874: New York/USA
1886: Venersborg /Schweden
1901: Edinburgh/Schottland
1906: Nowawes bei Potsdam/Deutschland
internationale Kommunikation
Dieser europäische Siegeszug einer Idee war nur möglich durch die Existenz einer internationalen Kommunikationsstruktur. Frankreich war im 18. Jahrhundert die tonangebende Kulturnation, und für gebildete Menschen in Europa war es eine Selbstverständlichkeit, in der französischen Sprache zu kommunizieren – ein berühmtes Beispiel ist der intensive Dialog zwischen Voltaire und dem Preußenkönig Friedrich dem Großen. De l’Epée und Heinicke wussten nicht nur voneinander, sondern sie führten eine europaweit beachtete, kontroverse Diskussion über die „richtige“ Methode. De l’Epée, aber auch Haüy empfingen zahlreiche ausländische Gäste in ihren Schulen, und es waren wiederum Einzelpersonen, die, angeregt durch diese Begegnungen, Institute wie etwa in Berlin (Zeune), in Wien (Stork) oder in Rom (Tommaso Silvestri) ins Leben riefen. Auch außerhalb des europäischen Festlandes, im Lande John Lockes, entwickelten sich parallel zu Paris, Leipzig und Wien erste Bildungseinrichtungen für Gehörlose und Blinde:
„Two years before Rousseau wrote Emile, and in the same year as the first Parisian deaf entered de l’Epée’s school, nine-year-old Charles Shirref became a pupil of Thomas Braidwood […] so […] began the first school for the deaf in Britain.“ (Pritchard 1963, 11)
Trotz dieses imposanten Aufschwungs könnte das Bild täuschen. Es war lange Zeit nur eine kleine Minderheit behinderter Menschen, die in den Genuss von Bildung und Erziehung kam, denn die Ideen der europäischen Aufklärung, die die Bildungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung mit einschloss, entfalteten ihre Wirksamkeit nur langsam:
„Unverkennbar, man muß einen Bruch zwischen pädagogischen Programmen und gesellschaftlicher Wirklichkeit, zwischen dem umfassenden Erziehungsanspruch und den bescheidenen Grenzen der realisierten Erziehungsreformen konstatieren. Man muß aber zugleich berücksichtigen […] dass erst mit der Aufklärung selbst dieser Bruch, die Differenz zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit systematisch als […] Problem formulierbar wird.“ (Tenorth 2008, 117)
Recht auf Bildung
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Recht auf Bildung in den entwickelten Staaten in größerem Umfang in die Praxis umgesetzt, und blicken wir auf die Gegenwart, so müssen wir feststellen, dass nicht einmal alle europäischen Länder den Bildungsanspruch für jedes behinderte Kind bislang eingelöst haben. So wird in Frankreich, dem Land der ersten Pioniere einer Pädagogik für Menschen mit Behinderung, mit zunehmender Empörung registriert, dass die Schulpflicht noch nicht für alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung realisiert ist (Ellger-Rüttgardt 2016, 125ff). Geht man gar von einer globalen Sichtweise aus, so müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die verheißungsvollen Anfänge noch im 21. Jahrhundert weit davon entfernt sind, im weltweiten Maßstab gesellschaftliche Realität zu werden.
2.3 Die Erfindung neuer Methoden
Ohne die Entwicklung angepasster Methoden an die besonderen Bildungsbedürfnisse gehörloser, blinder und wenig später auch geistig behinderter Menschen hätte sich die pädagogische Spezialdisziplin der Heilpädagogik nicht etablieren können, denn nur mit Hilfe spezifischer Methoden konnte die in der Theorie anerkannte Bildungsfähigkeit jedes Menschen in der Praxis tatsächlich entwickelt werden, und somit kann zu Recht die Erfindung neuer Methoden als die „Geburtsstunde der Behindertenpädagogik“ (Drewek/Tenorth 2001, 63) gelten.
Kompensation fehlender Sinne
Methoden bei Gehörlosigkeit: Angeregt durch die Philosophie der Sensualisten und ihrer Erkenntnistheorie richtete sich das Augenmerk der „Erfinder“ auf die Frage, wie ein fehlender Sinn durch den Einsatz eines anderen kompensiert werden könne. Im Falle von Gehörlosigkeit lag ein gravierendes Problem vor, da der fehlende Gehörsinn zugleich Sprachlosigkeit nach sich zog. Somit stand zur Debatte, ob der Gehörlose in seiner „eigenen“ Sprache, also der Gebärde, kommunizieren solle – allerdings damit weitgehend isoliert von der übrigen menschlichen Gesellschaft – oder aber befähigt werden solle, die menschliche Lautsprache zu erlernen – möglicherweise um den Preis eines Verlustes von Identität.
Wie die historische Entwicklung zeigt, spitzten sich die beiden unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu wahren Gegensätzen zu, als „deutsche“ Lautspracherziehung und „französische“ Gebärdensprache zu unversöhnlichen Gegensätzen konstruiert wurden. Die Realität sah meist anders aus, nämlich sehr viel bunter. Weder Heinicke noch de l’Epée schlossen das jeweils andere methodische Verfahren aus. Wie berichtet, benutzten Heinickes Zöglinge selbstverständlich Gebärden, und ebenso versuchte de l’Epée seine Schüler auch zur Lautsprache zu erziehen. Aber – und das ist bedeutsam – die Schwerpunkte beider Verfahren unterschieden sich im Kern, und das belegt auch der kontroverse Briefwechsel zwischen den beiden Protagonisten (Heinicke 1912, 104ff).
Methode de l’Epée
Während Heinicke vor allem aus wirtschaftlichen Gründen keine präzise Darstellung seiner lautsprachlichen Methode veröffentlichte – er wollte seine Methode gewinnbringend veräußern –, hat de l’Epée ganz im Gegenteil den öffentlichen Diskurs gesucht, um seiner Methode national und international den erhofften Einfluss zu sichern. In seinem Werk „Die Unterweisung der Taubstummen durch die methodischen Zeichen“ räumte er der Darstellung seines praktischen Vorgehens breiten Raum ein. Es folgt ein Beispiel für das methodische Vorgehen de l’Epées, das sich bewusst von der Methode des Handalphabets absetzte:
„Das Handalphabet bezeichnet am Anfange den Taubstummen, die keine Sprache verstehen, nichts; es vermittelt ihnen aus sich selbst nicht das geringste Verständnis. Wenn wir, nachdem wir uns seiner bedient haben, um einen Taubstummen die Buchstaben unterscheiden zu lehren, die beiden Wörter nous portons [wir tragen] an die Tafel schreiben, wird er große Augen machen und nichts davon verstehen. Es wird ihm auch nichts nützen, wenn wir über diese beiden Wörter die drei Personen der Einzahl und unter sie die beiden andern der Mehrzahl setzen; er wird nur noch größere Augen machen und uns mit trauriger Miene ansehen. Die meisten führen ihre Hand oder ihren Finger an die Stirn und begleiten diese Geste mit dem gewöhnlichen Zeichen der Verneinung, um uns begreiflich zu machen, daß sie nichts davon verstehen. Aber nur einen Augenblick Geduld, und unserm neuen Schüler wird bald mit Hilfe unserer methodischen Zeichen das Verständnis erschlossen werden.
Ein Folioband, den wir auf den Tisch legen lassen, beginnt seine Aufmerksamkeit anzuziehen. Alle anderen Taubstummen versammeln sich um uns, und ich stelle den Neuling neben mich, zu meiner Rechten. Dann setze ich den Zeigefinger meiner linken Hand auf das Wort je [ich] und zeige gleichzeitig mit dem der rechten mich selbst, indem ich mich damit auf die Brust klopfe; sodann stelle ich den Finger meiner linken Hand auf das Wort porte [trage], nehme den Folioband und trage ihn nacheinander auf der Schulter, auf dem Arm, in den Zipfeln meines Rockes; auf dem Rücken und auf dem Kopf; alles das im Gehen und mit der Haltung eines Menschen, der sich schwer beladen fühlt. Keine meiner Bewegungen entgeht der Aufmerksamkeit des Taubstummen. Ich gehe nun zum Tische zurück und setze, um die zweite Person zu erklären, den Zeigefinger der linken Hand auf das Wort, tu [du]; gleichzeitig richte ich den der rechten Hand gegen die Brust des Taubstummen und klopfe einige mal sanft darauf, wobei ich ihn darauf aufmerksam mache, daß ich ihn ansehe; und daß er mich auch ansehen muß. Sodann setze ich den Finger auf das Wort portes [trägst] und gebe ihm den Folioband, indem ich ihm ein Zeichen mache, nun seinerseits dasselbe zu tun, was er mich zuerst hat ausführen sehen. Er fängt an zu lachen, nimmt das Buch und richtet den Auftrag sehr gut aus.“ (de l’Epée 1910, 46f)
Methodenstreit
Wie schon dargelegt, obsiegte im internationalen akademischen Streit um die adäquate Unterrichtsmethode Gehörloser zunächst de l’Epée. Spätestens jedoch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wendete sich das Blatt, und mit den Beschlüssen des Mailänder Kongresses der Taubstummenlehrer von 1880 erfolgte wiederum eine einseitige Entscheidung, nun zugunsten der Lautsprache.