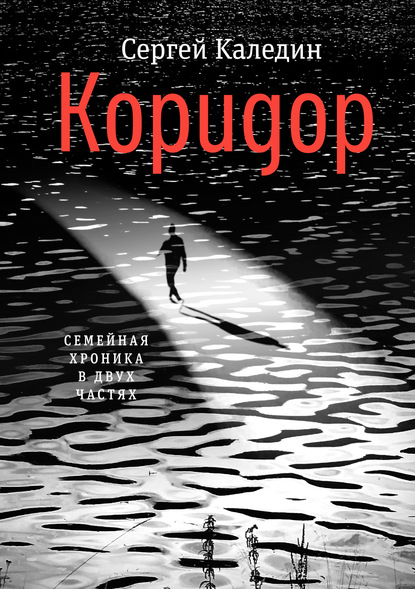- -
- 100%
- +
Urteil der Züricher Akademie
Ein schweizerisches Dokument, ein Artikel aus dem Feuilleton der Neuen Züricher Zeitung von 1906, erinnert an das Urteil der Züricher Akademie über den Methodenstreit zwischen Heinicke und de l’Epée von 1783 und wirft rückblickend ein differenziertes Bild auf die scheinbar so unversöhnlichen Positionen:

„Zu der Eigenart des großen Abbé de l’Epée gehört, daß er wenig Widerspruch ertrug und seine Lehrweise zwar als verbesserungsfähig, aber doch als die beste der bestehenden betrachtete. Er glaubte, der Taubstumme sei vorzugsweise nur durch den Gesichtssinn zu unterrichten, daher entspreche das geschriebene und nicht das gesprochene Wort seinen Bedürfnissen; seine Muttersprache sei die Gebärdensprache, die durch methodische Zeichen so vervollkommnet werden könne, daß sie allein es ermögliche, seine geistigen Kräfte allseitig auszubilden. Nicht dass de l’Epée die Fingersprache oder das laute Sprechen vernachlässigt hätte. Von der ersten Stunde an übte er beide nach bekannter Methode; denn jene war notwendig, um das Handalphabet zu lehren, diese wegen des Verkehrs mit den Vollsinnigen […] Allein die Fingersprache und das laute Sprechen schienen ihm so einfach und für die Erfassung der übersinnlichen Begriffe so beschränkt zu sein, daß er die größte Arbeit auf die Anwendung und Ausbildung seiner methodischen Zeichen verwandte. Es waren dies teils natürliche, teils künstlich kombinierte pantomimische Beschreibungen der zu erklärenden sinnlichen oder übersinnlichen Begriffe […]
In der Großartigkeit des Systems lag aber gerade seine Schwäche; die Fingersprache wie das eigentliche Sprechen mußten zu kurz kommen. Indem de l’Epée das Grösste wollte, die vollständige, geistige Ausbildung der Taubstummen, die ihm nur bei wenigen gelingen konnte, unterschätzte er das Nächstliegende und Einfachste, was alle Taubstummen in erster Linie nötig haben, die tägliche Umgangssprache. Abbé de l’Epée war nicht nur in seiner uneigennützigen Hingabe für die Armen, sondern auch in der groß angelegten Unterrichtsmethode Idealist.
Einen entgegengesetzten Standpunkt nahm der Zeitgenosse Epées, der Deutsche Samuel Heinicke ein, der, ein ausgezeichneter, praktischer Schulmann, dem gesprochenen Wort die erste Stelle im Taubstummenunterricht anwies […]
Leider hielt er, teils aus Spekulation, teils aus Furcht vor Mißbrauch, seine Methode geheim. Er ging von der richtigen Annahme aus, daß die Gedanken erst durch die Sprache gebildet werden und man somit auch im Unterricht der Taubstummen so schnell als möglich zum artikulierten Sprechen übergehen müsse. Die Lernfähigkeit der Taubstummen gründe sich auf Gesicht, Gefühl und Geschmack […] Auch er erreichte überraschende Resultate; geschickte Schüler vermochten die Worte von den Lippen abzulesen und mit Vollsinnigen zu reden. Natürlich erregten seine Tätigkeiten und Erfolge großes Aufsehen; weckten aber ebenso sehr Neugier, Mißtrauen und Verleumdung, in seiner Anstalt in Leipzig hatte er selten gleichzeitig mehr als 9 Zöglinge, die er kaum 4 Jahre behalten konnte. Auch fehlte es ihm nicht an ökonomischen Schwierigkeiten; er war und blieb arm. Dazu kam seine Reizbarkeit; denn Heinicke war eine streitbare Natur und griff Uebelstände und Personen schonungslos an, wenn sie ihm hindernd in den Weg traten. Besonders hatte er für die Mängel der Volksschule einen offenen Sinn, für die Klagen der Lehrer ein williges Ohr und auf die Anmaßungen der Geistlichen ein scharfes Auge. Er verstand es aber, nicht nur zu tadeln, sondern auch besser zu machen und darf füglich ein Vorläufer der modernen Pädagogik und Schule genannt werden […]
Auch Heinicke überschätzte seine Lehrart und fällte deswegen über die anderen Methoden, ohne sie zu kennen, ein scharfes und ungerechtes Urteil […]
Es wäre eine müßige Frage, zu untersuchen, wer von den beiden Taubstummenlehrern Epée und Heinicke der größere wäre: beide haben ihr ganzes Können und ihre ganze Persönlichkeit für eine erhabene Aufgabe eingesetzt. Ihre Ziele und ihre Erfolge waren nahezu die gleichen, nicht aber ihre Wege, die sie betraten. Der Streit um den Vorzug ihrer Methode konnte nicht ausgetragen werden, weil der Wert einer Methode weniger von ihr selbst abhängt, als vielmehr von der Art und Weise, wie sie ausgeübt wird. Der Buchstabe tötet, der Geist ist’s der lebendig macht. Was aber dieser literarischen Fehde besondere Bedeutung verleiht, ist, daß sie in allen Ländern zum erstenmal die öffentliche Meinung für die Bildung der Taubstummen interessierte.“ (Ernst 1906)
In den ersten praktischen Unterrichtsversuchen, ich hatte bereits darauf hingewiesen, überwog ein pragmatisches Ausprobieren, das zwangsläufig verschiedene methodische Elemente berücksichtigte.
Beispiel Rom
So ging der Italiener Silvestri in der römischen Gehörlosenschule zwar von der Gebärdensprache de l’Epées aus, ergänzte sie aber um lautsprachliche Anteile. Er schrieb 1785:
„Unser Ziel in Rom ist nicht allein, diesen armen Menschen die Sprache wiederzugeben, sondern auch, ihre wichtigste Qualität, ihren Verstand zu fördern. Zu diesem Zwecke bediene ich mich eines einfachen, natürlichen Mittels, welches der natürlichen Stärke des Taubstummen keine Gewalt antut, sondern im Gegenteil gerade die Kommunikationsform bevorzugt, mit der er […] so wohlvertraut ist, und die ihm zu Gewandtheit und Schnelligkeit verhilft. Mittels Gebärden drückt ein jeder Taubstumme seine Wünsche und Bedürfnisse vollends aus. Aus diesem Grunde hat die Schule sich die Gebärden für seine Bildung zunutze gemacht, dabei aber gewisse Korrekturen vorgenommen […] Doch um den Taubstummen wieder ganz der Gesellschaft zuzuführen, versäumt die Schule es auch nicht, ihn das Verstehen von Lippenbewegungen und die ihnen zu Grunde liegenden Gedanken zu lehren. Dies gestattet es ihm, unverzüglich und ohne andere Hilfsmittel als die lebendige Stimme zu antworten.“ (Pinna et al. 1993, 417f)
Wiener Methode
Die Verbindung unterschiedlicher Elemente wurde nach dem Ausscheiden Storks auch in dem Wiener Taubstummeninstitut unter der Leitung seines Nachfolgers May praktiziert. Walter Schott spricht von einer „Wiener Methode“, über die er Folgendes schreibt:
„Die ersten Lehrer des k. k. Taubstummen-Instituts hatten […] die Gebärdenmethode des de l’Epée in Paris erlernt und in Wien zur Anwendung gebracht. Die Pariser Gebärdensprache war aber in ihrem Gebrauch so umständlich (infolge der vielen grammatikalischen Endungen, Ableitungen usw.), daß sie als Kommunikationsmittel für den alltäglichen Gebrauch der Gehörlosen untereinander sehr unpraktisch und zeitraubend war. Daher war es nur natürlich, wenn neben der im Unterricht verwendeten Gebärdensprache eine andere, abgekürzte, sich entwickelte und die Schrift als sicheres Mittel zur Verständigung gegenüber der hörenden Umwelt besondere Bedeutung erlangte […] Während Stork ein entschiedener Gegner Heinickes war, verschloß sich May nicht dessen Gedanken. Besonders den sozialen Ideen stimmte May durchaus bei […] May löste sich von der französischen Methode auch insofern, als er die komplizierten Zeichen durch Vereinfachungen ersetzte und diese mit […] Handalphabetszeichen ergänzte. Damit gelang ihm die Konstruktion eines ‚gemischten Systems‘, das Gebärde und Lautsprache verband. Offenbar versuchte May die Vorteile beider Methoden zu vereinen.“ (Schott 1995, 112f)
Musikerin M. Paradis
Methoden bei Blindheit: Was die Methode zur Unterrichtung Blinder betraf, so lagen die Dinge hier wesentlich einfacher. Als Haüy mit seinen Überlegungen begann, hatte er nicht nur wesentliche Anregungen durch Diderots Brief über die Blinden erfahren, sondern aus eigener Anschauung miterlebt, in welch erstaunlichem Maße eine blinde Person über intellektuelle und musische Fähigkeiten verfügte.

Maria Theresia Paradis
Am 1. April 1784 trat die blinde Pianistin und Komponistin Maria Theresia Paradis aus Wien zu öffentlichen Konzerten in Paris auf, und ihre Präsentationen wurden umgehend zum Stadtgespräch. In Alexander Mells Handbuch des Blindenwesens von 1900 lesen wir über sie:
„Sie wurde in allen Städten, wo sie auftrat, Mittelpunkt der Gesellschaft; die berühmtesten Personen der Zeit, Gelehrte, Musiker, Dichter, Staatsmänner suchten ihren Umgang, um sich an ihrem geistreichen Gespräche, an ihren feinen gesellschaftlichen Formen zu erfreuen. Nichts erinnerte, wenn sie saß, an ihr Unglück.“ (Mell 1900, 577)
Paradis’ Hilfsmittel
Maria Paradis, ein Patenkind der österreichischen Kaiserin Maria Theresia und „Mozarts berühmte Zeitgenossin“ (Fürst 2005) war nicht nur eine exzellente Musikerin und Komponistin, sondern zugleich eine allseits gebildete Persönlichkeit. Sie vermochte sich mit Hilfe einer kleinen Handpresse schriftlich mitzuteilen, verfügte über geografische Karten, konnte Karten und Schach spielen sowie mit Hilfe besonderer Tafeln rechnen. Die dafür notwendigen Hilfsmittel hatte sie, wir erwähnten es bereits, durch ihre Kontakte zu dem Blinden Johann Ludwig Weissenburg, Sohn eines Kammerdieners aus Mannheim, erhalten, der aufgrund seiner Begabung insbesondere in Mathematik ausgebildet worden war.
Grundlegend für die Unterrichtung blinder Menschen war die Erkenntnis, dass der fehlende Gesichtssinn durch den des Tastens zu ersetzen sei, und alle Kunst bestand darin, Hilfsmittel zu erfinden, die den Tastsinn für die Anbahnung von Lernprozessen nutzbar machten.
Leselernprozess
Haüy hat in seinem 1786 erschienenen Werk „Essai sur l’éducation des aveugles“ (Abhandlung über die Erziehung Blinder) beschrieben, welche Mittel er für den Leselernprozess seiner blinden Schüler einsetzte, wobei er ausdrücklich auf die Hilfsmittel der Maria Paradis sowie J. L. Weissenburgs verwies:
„Durch das Lesen wird das Gedächtniss leicht, rasch und methodisch ausgebildet. Es ist der Canal, durch welchen wir verschiedene Kenntnisse erlangen. Unsere hauptsächlichste Sorgfalt muss daher darauf gerichtet sein, die Blinden lesen zu lehren und für ihren Gebrauch eine Bibliothek herzustellen. Früher hat man in dieser Hinsicht verschiedene vergebliche Versuche gemacht. Man lehrte den Blinden lesen durch Buchstaben, die erhaben und beweglich auf einer Platte waren, oder indem man Buchstaben anwandte, die auf eine Karte durch Nadelstiche gebildet waren. Schon erschlossen sich ihnen die Wunder der Schreibkunst […] Aber diese rohen Hülfsmittel gaben dem Blinden nur die Möglichkeit, den Reiz der Lectüre empfinden zu lassen, ohne ihm die Mittel derselben zu gewähren. Wir fanden dieselben ohne Mühe, ihr Princip existirte schon lange, und täglich machte es sich vor unsern Augen geltend.
Wir beobachteten, dass ein bedrucktes Blatt beim Verlassen der Presse auf der Rückseite alle Buchstaben in relief zeigte, aber verkehrt. Wir liessen Buchstaben giessen, die so beschaffen waren, dass ihr Abdruck auf Papier von den Augen wahrgenommen werden kann, und mit Hülfe eines nach Art der Buchdrucker angefeuchteten Papiers gelang es uns, das erste Exemplar abzuziehen, das bisher mit erhabenen Buchstaben erschienen war, welche durch das Gefühl unterschieden werden konnten. Das war der Ursprung der Bibliothek für die Blinden […]
Vom Lesen des Gedruckten bis zu dem des Geschriebenen hat der Blinde nur einen Schritt zu thun. Wir sprechen hier nicht von der Schrift der Sehenden; wir haben bis zu diesem Tage vergebens den Gebrauch von Relieftinten versucht, und wir haben dieselben durch Schriftzüge ersetzt, die auf einem dicken Papiere vemittelst einer eisernen Feder, deren Schnabel nicht gespalten ist, erzeugt werden. Es ist unnütz zu bemerken, dass man, wenn man an einen Blinden schreibt, sich keiner Tinte bedient; dass die Buchstaben gerade, von einander getrennt und etwas dick sind, und dass man nur die eine von den zwei Seiten eines Blattes beschreibt. Wird dies beobachtet, werden die Blinden leidlich fliessend die Cursivschrift der Sehenden, ihre eigene und die anderer Blinden lesen. Ausserdem werden sie auf dem Papiere ebenso die Musiknoten und andere Figuren unterscheiden, welche durch unser Verfahren fühlbar gemacht worden sind.“ (Haüy 1883, 2ff)
Haüys Auftritt mit blindem Schüler
Der 17-jährige François Le Sueur war Haüys erster Schüler, mit dem er bald den Beweis seiner Unterrichtserfolge öffentlich machte. Alexander Mell hat uns in Dokumenten die Entstehungsgeschichte der Pariser Blindenanstalt übermittelt und dabei auch den Auftritt Haüys mit seinem Schüler im „Bureau Académique d’Ecriture“ wiedergegeben:

„Herr Haüy ließ sodann seinen Schüler Uebungen ausführen. Der Herr Generalleutnant der Polizei hatte ein Buch aufgeschlagen und gab daraus einige Wörter an, die sofort auf die Tafel gebracht wurden; und der junge Le Sueur las, nachdem er die Fingerspitzen über die Buchstaben hatte gleiten lassen, mit lauter Stimme: ‚Tableau de la Maison du Roi‘. Er führte mit demselben Verfahren die Addition mehrerer Zahlensummen, die man auf die Tafel eingetragen hatte, aus. Man nahm auch aufs Geratewohl einige Lettern, Buchstaben and Ziffern gemischt; man druckte sie auf ein Papier ab und der junge Mann brachte es zuwege, sie zu nennen, wenngleich mit etwas Mühe; was nicht überraschen darf, weil man, abgesehen davon, daß diese Lettern keinerlei Sinn bildeten, es darauf angelegt hatte, sie ohne Ordnung vorzulegen und einige davon sogar umzukehren. Er bewegte sich ebenso auf mehreren geographischen Karten, die man ihm gab und auf denen die Grenzen der verschiedenen Länder durch eine Menge von Nadelstichen, die den Konturen folgten, tastbar gemacht worden waren. Le Sueur erkannte die einzelnen Provinzen, auf die man seine Hand legte, und nannte gleichzeitig die Hauptstädte dieser Provinzen. Er unterschied ebenfalls die Musikzeichen, indem er der Reihe nach sowohl die Stufe, die sie in der Tonleiter einnahmen, als auch die Ausdrücke, die ihre verhältnismäßigen Werte angaben, benannte […]
Man vergegenwärtige sich, daß dieser junge Mann noch vor sechs Monaten in tiefer Unwissenheit steckte; daß er, geboren ohne Vermögen und genötigt, um die Unterstützungen betteln zu gehen, die er mit seiner Familie teilt, täglich nur ein paar Augenblicke dem Studium widmen kann; man vergleiche mit seinen Fortschritten selbst jene, die in einem gleichen Zeitraum ein junger Mann macht, der sich aller seiner Sinne und der Muße, die Wohlhabenheit gewährt, erfreut, und man wird ermessen, wie berechtigt sowohl die Befriedigung der hochgebildeten Beamten, die sich an der Spitze der Versammlung befanden, als auch die Beifallsbezeugungen waren, die die Zuseher den Erfolgen der erfinderischen und wohltätigen Bemühungen des Herrn Haüy verschwenderisch spendeten. Man wird schließlich folgern, wie interessant eine Anstalt wäre, die die des Gesichtssinnes beraubten Individuen in die Lage versetzen würde, aus den für ihren Gebrauch gedruckten Büchern Kenntnisse, geeignet ihren Geist zu bilden und zu schmücken, und Reize zu schöpfen, fähig, in ihrem Herzen das Bewußtsein ihres Unglücks zu mindern oder selbst aufzuheben.“ (Mell 1952, 34f)
Louis Braille
Auch wenn es mit der Entwicklung dieser neuen Methoden zum ersten Mal gelungen war, blinden Menschen in systematischer Weise Bildungsprozesse zu vermitteln, so ist doch einschränkend anzumerken, dass diese ersten Methoden aus der Sicht der Sehenden entwickelt worden waren und letztlich nur begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten eröffneten. Erst als Louis Braille (1809–1852), der 1819 als Zehnjähriger in der Pariser Blindenanstalt Aufnahme gefunden hatte, ein aus der Kombination von sechs Punkten bestehendes Schriftsystem erfand, war der entscheidende Schritt zur Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten blinder Menschen getan.
Punktschrift
Erfunden hatte die Punktschrift Charles Barbier de La Serre, ein ehemaliger Artillerieoffizier, der während der Revolution in die USA emigriert und Anfang des 19. Jahrhunderts nach Frankreich zurückgekehrt war. Barbier bot seine Methode dem Pariser Königlichen Blindeninstitut an, das sich unter der Leitung von Pignier 1821 zur Einführung der Punktschrift entschloss. In der praktischen Erprobung durch die blinden Schüler selbst, unter ihnen Louis Braille, der 1821 erst zwölf Jahre alt war, stießen diese aber auf eine Reihe von Nachteilen der Methode Barbiers. Sie bemängelten, dass sich Barbiers Methode an den Lauten, nicht aber am Alphabet orientierte, keine Möglichkeiten für Rechenoperationen und Notensetzung vorsah und schließlich auf zwölf Punkten basierte, wodurch die Ertastbarkeit erschwert wurde. Es war Louis Braille, der als 20-Jähriger schließlich die entscheidende Lösung fand: ein System aus nur sechs Punkten, das die Zeichen das Alphabets sowie musikalische und mathematische Zeichen umfasste (Weygand 2003, 327ff).

Abb. 2.5: Blindenpunktschrift nach Louis Braille
Erfindung einer Schreibmaschine
Braille arbeitete in den Folgejahren an der Optimierung seines Systems, das er in zweiter Auflage 1837 veröffentlichte und dessen Version von Direktor Pignier an zahlreiche Blindenanstalten des Auslandes verschickt wurde. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten blinder Menschen war schließlich die Erfindung einer Schreibmaschine 1842, erdacht und hergestellt von dem Mechaniker Pierre-François de Foucault, einem ehemaligen Zögling der Blindenanstalt, in Zusammenarbeit mit Louis Braille.
Der Siegeszug der Braille-Schrift ließ allerdings noch einige Zeit auf sich warten, denn der Nachfolger Pigniers, Pierre-Armand Dufau, beeilte sich (1840), zum alten Schriftsystem zurückzukehren. Die Weltausstellung in Paris 1878, die mit einem Weltkongress der Blinden und Gehörlosen verbunden war, brachte letztendlich den nationalen und internationalen Durchbruch. Wie in allen anderen europäischen Ländern entschieden sich auch die deutschen Blindenpädagogen 1879 für die Einführung der Punktschrift nach Louis Braille. Er selbst war bereits 1852 in der Pariser Blindenanstalt verstorben. Nur ein Jahr später weihte das nun Kaiserliche Blindeninstitut eine Braille-Büste ein, mit „le Jean Guttemberg des aveugles“, der Johannes Gutenberg der Blinden, geehrt wurde. Bedenkt man, wie dürftig das Bildungsangebot für die große Mehrheit der Insassen der Pariser Blindenanstalt war, so ist die hohe Bedeutung und Wertschätzung dieser Methode zu verstehen, die den in der Isolation lebenden Blinden trotz aller Hindernisse plötzlich ungeahnte Wege zur Welt der Kultur, zur Kommunikation untereinander und zur intellektuellen Emanzipation eröffnete (Weygand 2003, 358).
Laura Bridgman
Unterricht Taubblinder: Der methodische Erfindungsreichtum der Anfangsphase führte schließlich auch dazu, dass bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, fünf Jahrzehnte vor der berühmten Helen Keller, die erfolgreiche Unterrichtung eines taubblinden Mädchens in der Blindenanstalt von Boston geschah: Laura Bridgman (1829–1889). Es war der Leiter der Blindenanstalt von Boston, Dr. Samuel Gridley Howe, der sich dieser Herausforderung stellte und mit großer Phantasie und Methodengeschick die Lernfortschritte des Mädchens über viele Jahre begleitete (Jerusalem 1890).
S. G. Howes Methode
Die taubblinde Laura Bridgman wurde 1837 in der Bostoner Blindenanstalt aufgenommen, und im „Encyklopädischen Handbuch des Blindenwesens“ von Alexander Mell findet sich eine minutiöse Beschreibung der von Howe entwickelten Methode:

„Dr. Howe ließ auf kleine Papierstreifen die Namen häufig vorkommender Gegenstände, wie Messer, Gabel, Löffel, Schüssel, Stuhl, Buch u. dgl. in erhabenen, tastbaren Lettern drucken. Er befestigte dann einen solchen Streifen z. B. den mit knife (Messer) bedruckten auf ein Messer und ließ einen andern solchen Streifen lose. Darauf gab er nun Laura das Messer mit dem darauf geklebten Streifen in die Hand, ließ sie das Object und die Lettern betasten. Dann gab er ihr den losen Streifen mit dem Worte knife (Messer) und machte ihr das Zeichen der Gleichheit, indem er ihre beiden Zeigefinger genau nebeneinander legte. Laura schien leicht zu begreifen, dass die Zeichen auch bei den Streifen gleich seien; mehr aber wusste sie noch nicht. Man versuchte es nun ebenso mit anderen Objecten und setzte die Lection am dritten Tage fort. Am dritten Tage erst begriff Laura, dass die Lettern auf den Streifen Zeichen für die Dinge seien, an denen sie befestigt waren. Dies zeigte sich dadurch, dass sie den Streifen mit dem Worte „chair“ (Stuhl), auf einen Stuhl, dann auf einen andern legte, wobei ein verständnisinniges Lächeln ihr bis dahin verdutztes Antlitz erhellte und ihre sichtbare Befriedigung ihrem Lehrmeister zeigte, dass sie ihre erste Lection begriffen hatte.
Damit hatte nun Laura die wichtige Erkenntnis gewonnen, dass die Dinge mit Namen bezeichnet werden. Diese Namen hatte sie aber bisher nur als einheitliche Complexe von Tastempfindungen kennen gelernt. Durch Zerschneiden der Streifen und mit Hilfe eines Typenkastens lehrte man sie nun, die Worte aus den einzelnen Buchstaben zusammensetzen, was sie mit großem Eifer und ziemlich schnell erlernte. Auch die Ordnung des Alphabets merkte sie sich bald und wusste ihre Typen nach beendeter Lection in richtiger Weise in den Kasten einzuordnen, was ihr die rasche Auffindung sehr erleichterte. Das Manipulieren mit den Typen war jedoch immerhin langwierig und nicht immer anwendbar. Dr. Howe sorgte deshalb dafür, dass Laura die Fingersprache der Taubstummen erlernte. Damit erst war für Laura die Einsamkeit, in die sie der Verlust der beiden vornehmsten Sinnesorgane gebannt hatte, durchbrochen, indem ihr jetzt erst die Sprache und der Verkehr durch dieselbe erschlossen war. Sie lernte die Fingersprache mit großem Eifer und brachte es darin im Sprechen sowohl, als auch im Verkehr zu großer Geläufigkeit.“ (Mell 1900, 135f)
Es sollte übrigens nur noch ein gutes Jahrzehnt dauern, bis ein Franzose den Boden der neuen Welt betrat und in den USA als Pionier der Geistigbehindertenpädagogik seine Erfolgsgeschichte begann: Edouard Séguin.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.