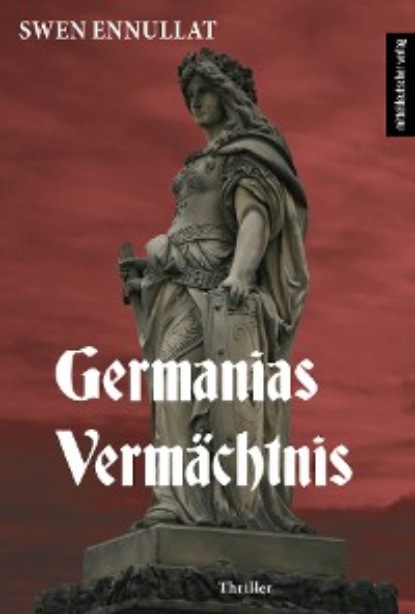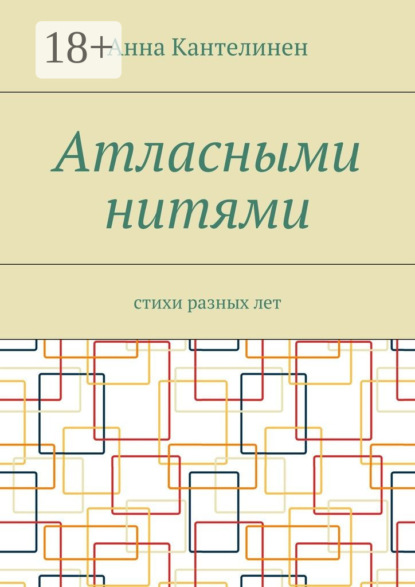- -
- 100%
- +
Sehr schnell wurde allerdings klar, dass nur diejenigen Frauen mit offenen Armen aufgenommen wurden, bei denen die Väter der ungeborenen Kinder und sie selbst den „rassenhygienischen“ Ansprüchen der Nazis entsprachen.
So mussten sie den „großen Abstammungsnachweis“, im Volksmund „Ariernachweis“ genannt, vorlegen. Hier hatte man seine direkten Vorfahren rückblickend bis zum 1. Januar 1800 nachzuweisen. Außerdem wurde bereits im Vorfeld darauf geachtet, dass die Gefahr von Erbkrankheiten weitgehend ausgeschlossen war.
Himmler selbst ging bei der angestrebten Steigerung der Geburtenrate sogar soweit, dass er seine SS-Männer mit Verweis auf ihre „völkische Verpflichtung“ explizit dazu aufforderte, mit ledigen Frauen, die den nötigen Abstammungskriterien entsprachen, sexuelle Beziehungen einzugehen und Kinder zu zeugen.
Mit dem einsetzenden Krieg und weil die Anzahl der Geburten noch immer nicht seiner Vorstellung entsprach, erließ er die Order, in den besetzten Gebieten jedes „arisch“ aussehende Kind, sprich blond und blauäugig, von seiner Familie zu trennen und den Lebensborn-Vereinen zuzuführen. Dort erhielten sie einen neuen Namen und mussten die deutsche Sprache lernen, bevor sie weitervermittelt wurden. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Arisierung, obwohl es nichts anderes als ein verabscheuungswürdiger Menschenraub war.
Besonders erwähnenswert ist hierbei auch die Besetzung Norwegens durch die deutschen Truppen. Da die Frauen des Landes in besonderem Maße den Vorstellungen Himmlers von der nordischen Rasse entsprachen, wurden dort etliche neue Lebensborn-Heime eingerichtet und die deutschen Soldaten erneut ermutigt, Liebesbeziehungen – diesmal zu den Einheimischen – einzugehen. Insgesamt spricht man allein in Norwegen von etwa zwölftausend Kindern, die in der Folge geboren wurden.“
„Und wie viele waren es insgesamt?“, fragte Julia wieder nach.
„Schwer zu sagen … In allen Heimen? Etliche Zehntausend vielleicht. Exakte Aufzeichnungen gibt es nicht.“
„Und was geschah mit Kindern, die mit einer Behinderung geboren wurden? Sie entsprachen doch bestimmt nicht Himmlers Vorstellung von der Herrenrasse.“ Ihre Stimme stockte kurz bei dieser Frage.
„Diese Kinder wurden als lebensunwert betrachtet, als Laune der Natur, und …“, jetzt zögerte selbst Professor Meinert bei der Antwort, „ … getötet.“
„O mein Gott …“, schluchzte Julia, und Torben nahm sie tröstend in den Arm.
„Nun gut“, führte der Professor weiter aus, „wenn Margot tatsächlich die Wahrheit gesprochen hat, wäre das nicht einfach eine Sensation, es wäre ein folgenschweres, politisches Erdbeben, das können Sie mir glauben!“
„Übertreiben Sie da nicht etwas?“ Torben zweifelte.
„Nicht im Geringsten mein Freund! Überlegen Sie nur einmal, es gibt wahrscheinlich nicht nur direkte Nachfahren Adolf Hitlers, sie wurden offenbar regelrecht gezüchtet. Im Rückschluss vereinen sie nun in den Augen ihrer Anhänger in sich die besten Eigenschaften unseres germanischen Erbes.
Für nationalsozialistische Kreise wären Sie die Übermenschen, die Begründer einer neuen Herrenrasse.
Können Sie sich auch nur ansatzweise vorstellen, was das für ein Brandbeschleuniger in ganz Europa wäre? – Rechte Organisationen existieren nicht nur in Deutschland. Denken Sie an Frankreich, Belgien, Holland, Polen, Österreich oder Italien. In den letzten Jahren haben die Ressentiments gegen Ausländer und Juden überall in der EU zugenommen. Ich sage nur Islamophobie und Organisationen wie PEGIDA. Erzkonservative Gruppen haben ausnahmslos Zulauf. Und eines haben alle gemein: Sie sehnen sich nach einem starken Führer.
Dieser Führer, würde er über eine natürliche Legitimation, wie einen entsprechen Stammbaum verfügen, hätte die Macht, unzählige aus- und inländische Organisationen sicher zu einer einzigen gewaltigen Streitmacht zu vereinen.“
Der Professor hatte sich regelrecht in Rage geredet und musste erst einmal eine Pause machen, um Luft zu holen. Das nutzte Levitt und sagte: „Meisterin Margot sprach vor ihrem Tod von einem politischen Umsturz und davon, dass der Orden erneut die Macht in Deutschland übernehmen würde? Was muss ich mir konkret darunter vorstellen?“
„Tut mir leid, das weiß ich nicht genau“, antwortete Professor Meinert kopfschüttelnd und noch immer etwas atemlos. „Die Mitgliederzahlen der größten rechtsextremistischen Partei in Deutschland gehen nicht nur zurück, weil man mit den Funktionären an der Spitze unzufrieden ist, derzeit wird sogar von staatlicher Seite mal wieder über ein Verbot diskutiert. Was die Arbeit sicherlich erschweren würde.
Anderen konservativen Vereinigungen wird auch kein Vertrauen mehr geschenkt und das Ansehen der politischen Führung schwindet in der Gesamtbevölkerung mehr und mehr. Allein dadurch wäre das Bevölkerungspotential sicher enorm, das man mit seinen eigenen radikalen Ideen für sich gewinnen könnte. Aber ich habe Zweifel, dass die Priesterinnen einen demokratischen Weg beschreiten und sich mit ihrer neuen Bewegung den regulären Wahlterminen stellen werden. Sie werden eine andere Möglichkeit suchen oder haben sie bereits gefunden.“
„Nun gut“, Levitts Stimme klang trotz allem entspannt, „wir sollten unsere nächsten Schritte planen. – Ich denke, wir haben zwei erfolgversprechende Spuren, denen wir folgen können: die Firma PRAETORIUS in Bern und Margots Hinweis auf die Stadt Quedlinburg. Vielleicht ist sie eine Hochburg des Ordens.“
„Das glaube ich kaum!“ Der Professor nahm dem Agenten schnell diese Hoffnung. „Unseren Priesterinnen ging es immer um Macht und Profit, beides Dinge, die sie im Arbeiter- und Bauernstaat nicht wirklich erreichen konnten. Die permanente Gefahr der Entdeckung durch die Staatssicherheit brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass sie – zumindest organisiert – in der DDR lebten und agierten.“
„Also sollen wir unsere Suche nicht in Quedlinburg fortsetzen, George?“, fragte Torben nach.
„Doch, natürlich! Die Stadt befindet sich nicht einmal zwei Fahrstunden entfernt. Wir können sie heute noch erreichen. Sie ist ein hervorragender Ort, um mit unseren Nachforschungen zu beginnen. Ich vermute eben nur, dass die Hinweise auf die Priesterinnen nicht sehr aktuell sind.“
Die Antwort schien Torben nicht zu stören und er erklärte: „Wir sind es doch mittlerweile gewohnt, im Kaffeesatz der Geschichte zu lesen. Also, was machen wir noch hier, lasst uns endlich aufbrechen!“
VIII
Der Professor und seine Tochter brauchten dann doch noch fast zwei Stunden, um auf der Baustelle die wichtigsten Dinge zu regeln. Als Entscheidungsträger während ihrer Abwesenheit und als Hundesitter für Gertrud benannten sie einen schmalen, blassen Studenten, der bei jeder ihrer Erklärungen, was er denn in den nächsten Tagen zu tun hätte, immer weiter in sich zusammensank. Als auch noch das Wort „Wochen“ fiel, bekam es selbst Torben langsam mit der Angst zu tun, dass er gleich in Ohnmacht fallen würde. Aber mit ihrer sympathischen Art schaffte es Anna zum Schluss dann doch, das Selbstbewusstsein des armen Kerls soweit wieder aufzubauen, dass er sich der Aufgabe gewachsen fühlte und stolz und erhobenen Hauptes tapfer seinen neuen Untergebenen entgegentrat.
Annabell präsentierte ihnen danach sichtlich stolz einen bullig wirkenden schwarzen Pkw MINI mit roten Rallyestreifen. Dabei handelte es sich allerdings um das neue Modell von BMW, das rein gar nichts von dem Charme der älteren Version des englischen Kleinwagens besaß. Torben vermutete, dass Anna ihre Begeisterung für ungewöhnliche Autos von ihrem Vater geerbt hatte. Wenigstens würden sie alle in nunmehr zwei Autos genügend Platz haben.
Mosche kümmerte sich derweil um eine Übernachtungsmöglichkeit in Quedlinburg und Levitt hielt mit Tel Aviv oder sonst wem Rücksprache. Julia war offenbar froh, nicht mehr die einzige Frau in ihrer Gruppe zu sein und suchte den Kontakt zur fast zehn Jahre jüngeren Anna. Ihr gemeinsames Gekicher zeigte Torben wenig später, dass sich die beiden trotz des Altersunterschiedes wohl auf Anhieb sympathisch fanden.
Er dagegen passte den Professor ab, als dieser gerade beabsichtigte, noch eine letzte Runde über die Ausgrabungsstätte zu machen und schloss sich ihm kurzerhand an. Froh, endlich von den anderen etwas abgesetzt zu sein, sagte er zu ihm: „George, ich brauche Ihren Rat!“
„Nur zu, mein Junge! Also, wenn Sie mich fragen, müssen Sie dieses Mal den ersten Schritt wagen. Sie kam Ihnen schon bei der Beerdigung Ihrer Mutter entgegen, obwohl Sie ihr nicht bei Michaels Beisetzung beigestanden haben, hat sie Ihnen verziehen und …“
„Nein, nein“, unterbrach ihn Torben, „es geht nicht um Julia und mich.“
„Nicht? Ich dachte!“ Der Professor schien verblüfft.
„Es ist etwas völlig anderes.“ Torben zögerte. „Es geht um die Jagd nach dem Orden. Levitt sprach von zwei Spuren, denen wir folgen können. Ich denke, es sind sogar drei!“
„Drei? Wie kommen Sie darauf?“ Professor Meinert blieb stehen und blickte ihm direkt in die Augen.
„Nun ja, wir haben PRAETORIUS und Quedlinburg. Das stimmt schon. Aber ich kenne vielleicht noch einen weiteren Hinweis, dem wir folgen sollten.“ Er dämpfte seine Stimme. „Können Sie sich erinnern, als wir im Deutschritterschloß in Bad Mergentheim von den Handlangern des Ordens gefangengenommen wurden?“
Der Professor nickte.
„Damals bin ich ja aus Versehen in eine Versammlung der Priesterinnen geplatzt. Das geschah alles nur, weil ich in einem Flur eine Frau gesehen habe, die mich an eine bekannte Politikerin erinnerte. Aus Neugier folgte ich ihr, traf auf Nicole, wurde niedergeschlagen und den Rest kennen Sie.“
„Soll das heißen, Sie wissen mittlerweile, wer sie ist?“ Die Überraschung in seiner Stimme war echt.
„Nicht so laut George!“ Torben vergewisserte sich, dass niemand in ihrer Nähe war, bevor er weitersprach: „Ich glaube, ja! In Vietnam und Thailand habe ich alle Ereignisse wieder und wieder in Gedanken durchlebt, versucht, mir alle Einzelheiten ins Gedächtnis zu rufen. Irgendwann sah ich auch ihr Gesicht wieder vor mir und ich kam nicht mehr aus dem Grübeln heraus, woher ich es kennen könnte.“
„Und, ist es Ihnen mittlerweile eingefallen?“
„Ganz recht! Wahrscheinlich habe ich die Person bereits einige Male unbewusst wahrgenommen. Ich kann mich außerdem ziemlich genau an einen Fernsehbeitrag erinnern, der noch nicht einmal sehr lange zurückliegt. Es ging darin um die Festlegung gesetzlicher Frauenquoten in deutschen Führungsetagen. Unsere – nennen wir sie einfach einmal – mögliche Verdächtige kam darin mehrmals zu Wort. Ihren Namen hatte ich mir natürlich nicht gemerkt. Also bin ich in ein schäbiges Internetcafé eingekehrt und habe recherchiert. – Um die Geschichte abzukürzen, ich glaube, es könnte sich um eine Europaabgeordnete einer konservativen Partei handeln. Anfang Fünfzig, geschieden, kein Name, den man kennen müsste, Hinterbänklerin, wie man so schön sagt. Mäßiges Engagement für die politische Bühne, aber auch niemand, dessen Karriere man leichtfertig mit einer Behauptung, er gehöre einer uralten germanischen Kaste von größenwahnsinnigen Priesterinnen an, zerstören sollte, erst recht nicht, wenn man mit dem Mossad im Bunde ist.“
Der Professor stimmte ihm zu: „Das versteht sich von selbst! Wie sicher sind Sie sich?“
„Vielleicht zu achtzig Prozent! Mehr aber definitiv nicht, zu wenig, um jemanden an den Pranger zu stellen oder verhaften zu lassen.“ „Torben, da Sie mich fragen, mein Vorschlag wäre, wir schauen erst einmal, ob wir in Quedlinburg weiterkommen. Falls ja, brauchen wir Ihre Spur vorerst nicht weiter zu verfolgen. Falls nicht, können Sie sich immer noch Levitt offenbaren. Okay?“
Torben nickte: „So machen wir es!“
„Ach, noch etwas, mein junger Freund“, der Professor zögerte mit dem Weitergehen, „vielleicht sollten Sie mir trotzdem den Namen der Unbekannten sagen. Nur für alle Fälle!“
„Ingrid Schulte! Die Dame heißt Ingrid Schulte!“
IX
Ob man es nun wollte oder nicht, Quedlinburgs Schönheit beeindruckte einfach jeden. Fast konnte man glauben, man sei in der Zeit zurückgereist. Mit dem historischen Straßenpflaster und den engen Gassen, in denen sich an die eintausenddreihundert Fachwerkhäuser eng aneinander schmiegten, glich der Stadtkern einem riesigen, mittelalterlichen Denkmal.
Der Professor schien wohl, wie man seinen Äußerungen bei ihrer Ankunft entnehmen konnte, sonst sehr kritisch zu den Entscheidungen der UNESCO, dem wissenschaftlichen und kulturellen Arm der Vereinten Nationen, eingestellt zu sein. In diesem konkreten Fall erläuterte er allerdings, dass sie recht daran getan hatten, die Stadt zum Weltkulturerbe zu erklären.
Das Hotel, das Mosche gebucht hatte, trug den Namen „Zum Bär“ und befand sich – entsprechend ihrer vermutlich historischen Mission – seit dem Jahre 1748 direkt am zentralen Marktplatz, schräg gegenüber dem eindrucksvollen Rathaus im Renaissance-Stil und der davor befindlichen Roland-Statue, einem der Wahrzeichen der Stadt. Für Torben war es mehr als ein Symbol, für ihn war es die Bestätigung, dass sie sich auf dem richtigen Weg befanden, denn schon früher hatten ihm die Roland-Figuren, egal ob aus Holz oder Stein, den Weg zu den Geheimnissen des Ordens gewiesen.
Jedem von ihnen stand ein komfortables Einzelzimmer im Landhausstil zu Verfügung, das keine Wünsche offen ließ. Die Betten waren sogar groß genug, notfalls zwei Menschen aufzunehmen. Torben schloss es fürs Erste aber eher aus, dass Julia den Weg zu ihm finden würde. Eine Vermutung, mit der er Recht behalten sollte.
Zumindest aßen die Mitglieder ihrer kleinen Reisegruppe später im hoteleigenen Restaurant gemeinsam zu Abend, um gleich danach wieder auseinander zu gehen.
Von der Reise ermüdet, zogen die Frauen nämlich prompt ihre Betten vor, wobei Anna sich zuvor in einem Schaumbad entspannen wollte, da ihr dieser Luxus auf der Ausgrabungsstätte gefehlt hatte. Die Mossad-Agenten mussten noch in Erfahrung bringen, zu welchen Ergebnissen die Beratungen in Berlin geführt hatten, sowie Tagesreport bei ihren Vorgesetzten ablegen, sodass Torben und der Professor allein zurückblieben und sich die Möglichkeit ergab, dem Weingeist ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
Julia legte Torben allerdings im Weggehen zumindest für einen kurzen Moment behutsam ihre Hand auf die Schulter und lächelte ihn an, für ihn ein Zeichen, dass er ihr nicht böse sein sollte, und er nickte ihr daher verständnisvoll zu. Nachdem sie verschwunden war, wandte er sich seinem alten Freund zu und berichtete ihm von den Erlebnissen der vergangenen Wochen in Südostasien. Professor Meinert ließ ihn gewähren und lauschte andächtig. Erst Tage später sollte Torben auffallen, dass es für den Professor eher ungewöhnlich war, andere Menschen längere Zeit ausreden zu lassen, ohne sie zu unterbrechen sowie eigene Bemerkungen und Anekdoten zum Besten zu geben. An diesem Abend bemerkte er es freilich nicht, wohl auch, weil seine Gedanken eigentlich Julia galten.
Von der Schweigsamkeit des Professors, sollte es sie tatsächlich gegeben haben, war am nächsten Morgen nichts mehr zu bemerken.
Als Erster bekam das ein Fremdenführer zu spüren, der sie auf eine Entdeckungstour durch die Stadt begleitete.
Professor Meinert und seine Tochter verfügten zwar über ein profundes geschichtliches Fachwissen, gleichwohl hatte Torbens Vorschlag einer einführenden Stadtführung von allen Zustimmung erfahren. Sich auf der Suche nach einem neuen Rätsel oder alten Geheimnis des Ordens eine erste, grobe Orientierung in Quedlinburg zu verschaffen, konnte zumindest nicht schaden.
Ursprünglich hatten sie bei ihrem Rundgang vor, sich allen bedeutenden und in erster Linie sakralen Baudenkmälern der Stadt zu widmen. Zu den gotischen und neugotischen Kirchen kamen sie aber gar nicht mehr, weil sie die Führung bereits in der romanischen Stiftskirche St. Servatius abbrachen.
St. Servatius wurde – obwohl nie Bischofskirche – auch als der Dom Quedlinburgs bezeichnet und war lediglich zehn Gehminuten von ihrem Hotel entfernt. Er thronte weithin sichtbar fünfundzwanzig Meter über der Stadt auf dem Schlossberg, einem steilen Sandsteinfelsen, wo er gemeinsam mit den Wohngebäuden des ehemaligen Frauenstiftes ein eindrucksvolles Bauensemble bildete. Ihr Führer, ein Mann von Mitte fünfzig mit graumeliertem, schon lichtem Haar, Nickelbrille und nach oben gerichteter Nase, was ihm – wie Torben fand – einen leicht arroganten Ausdruck gab, hatte sich ihnen als Herr Semmler vorgestellt und mit stolz geschwellter Brust erklärt, ein Kind Quedlinburgs zu sein und die Stadt noch nie länger als drei Monate verlassen zu haben.
Anerkennend musste Torben zugeben, dass er seine Sache recht gut machte. Semmler war keine dieser Aushilfen, die aus Geldmangel oder Selbstüberschätzung jeden nur denkbaren Job annahmen. Er liebte seine Stadt, kannte jede noch so verwinkelte Ecke und war in der Geschichte des Ortes ziemlich bewandert.
Auf dem Burgberg, im Schatten der beiden riesigen quadratischen Türme der Kirche erzählte ihnen Semmler, dass Quedlinburg im 8. Jahrhundert Sitz der Liudolfinger, auch Ottonen genannt, einem sächsischen Adelsgeschlecht war, aus dem unter anderem König Heinrich der Erste hervorging. Dieser war es auch, der die Stadt Anfang des 10. Jahrhunderts zur einflussreichsten Pfalz des Reiches ausbaute, nicht zuletzt, weil er sie regelmäßig zum bedeutenden Osterfest besuchte.
Torben und seine Freunde erfuhren, dass der König nach seinem Tod im Jahre 936 sogar hier beigesetzt wurde. Zu seinen Ehren gründeten seine Witwe Mathilde und sein Sohn, der später zum Kaiser gekrönte Otto der Große, an der Grabstätte noch im gleichen Jahr das Damenstift St. Servatius.
Aus seinen früheren Abenteuern wusste Torben, dass Mathilde nicht nur Nachkommin eines alten germanischen Fürstengeschlechts, sondern wahrscheinlich auch Angehörige des ihnen feindlich gesinnten Ordens war, und dass sie Heinrich dem Ersten bewusst zugespielt wurde, um ihn mit der jugendlichen Unschuld eines dreizehnjährigen Mädchens zu verführen, ein Vorhaben, was letztendlich gelang. Der wesentlich ältere König ließ die Ehe zu seiner ersten Ehefrau annullieren und wandte sich Mathilde zu.
Semmler sprach derweil weiter und berichtete, dass es in den folgenden Jahrhunderten Brauch wurde, dass die ottonischen Herrscher das Osterfest in St. Servatius begingen und dort ihrer Vorfahren gedachten. Die eigentliche Stiftskirche entstand aus der Burgkapelle der Königspfalz. Nach einer Bauzeit von vierundzwanzig Jahren wurde dieses Kleinod – wie ihr Führer sich ausdrückte – hochromanischer Baukunst 1021 fertiggestellt und im Beisein des Urenkels Heinrich des Ersten, des Kaisers Heinrich des Zweiten, geweiht.
Spätestens ab hier wurde es für Semmler zunehmend anstrengend, wenn nicht gar unangenehm, denn die Einwürfe des Professors und seiner teilweise noch besser in dieser Zeitepoche bewanderten Tochter Annabel ließen ihn schnell die Grenzen seines Wissens erkennen und so führte er seine Kunden zügig in das Innere der Kirche, um weitere Nachfragen zu umgehen.
Torben hatte sich indes, schon als sie vor dem Sakralbau standen, vielmehr für die Architektur der Kirche als für die Ausführungen des Guide interessiert und ihre schlichte und doch erhabene Form bestaunt. Jetzt im Mittelschiff stehend, erkannte er, dass zu beiden Seiten jeweils noch ein Seitenschiff angrenzte. Als trennende Stütze folgte jeweils auf zwei Säulen immer ein Pfeiler. Torben hörte Semmler gerade noch so viel zu, dass er erfuhr, dass diese regelmäßige Abfolge niedersächsischer Stützenwechsel genannt werde.
Da der Professor ausnahmsweise bei diesen Ausführungen nicht protestierte, fasste ihr Führer neuen Mut und kam noch einmal auf die Geschichte des Bauwerks zurück. Zwar konnte er bis zu der Ära der französischen Besatzung Quedlinburgs überzeugen, die exakte Geschichte St. Servatius’ im Dritten Reich oder genauer die diesbezüglichen Fragen des Professors überforderten ihn dann aber doch, wie sein mittlerweile hochrotes Gesicht verriet.
Daraufhin erläuterte Professor Meinert ihrer Gruppe: „Heinrich Himmler, Reichsführer-SS und in den letzten Kriegsjahren Reichsinnenminister, der sich als Wiedergeburt von Heinrich dem Ersten betrachtete, erkannte sehr schnell, wie sehr er die Figur des deutschen Königs im politischen Alltag des Dritten Reichs vermarkten konnte. Heinrich der Erste hatte nicht nur das fränkische Reich geeint und die Ungarn zurückgeschlagen, er hatte auch mit der Osterweiterung seines Reiches begonnen, eine Expansion, die den Nazis sehr zupasskam.
1938 funktionierte Himmler nicht nur die Stiftskirche kurzerhand zur „Weihestätte“ der SS um, sondern machte bereits drei Jahre zuvor die Stadt Quedlinburg anlässlich des tausendsten Todestages des großen deutschen Königs zur alleinigen Trägerin der Feierlichkeiten. Das ihm unterstellte Ahnenerbe beauftragte er zeitgleich damit, Nachforschungen zum Leben Heinrich des Ersten anzustellen und Grabungen mit dem Ziel aufzunehmen, die verschollenen Gebeine des Königs wieder aufzufinden. Dies gelang angeblich tatsächlich und so ließ er im Jahre 1937 diverse Knochenreste, die am Schlossberg gefunden wurden, neben Heinrichs Frau Mathilde beisetzen.“
Plötzlich lächelte Semmler wissend und sagte mit offenbar tiefer Genugtuung betont langsam zum Professor: „Was Sie da erzählen, ist falsch. So hat es sich nicht zugetragen.“
Professor Meinert zögerte: „Wie meinen Sie das? Ich verstehe nicht?“ Seine Verblüffung war nicht gespielt.
„Was Sie über Himmler erzählen, stimmt nicht.“ Semmler blickte in die Runde und wurde konkreter: „Na ja, die meisten Sachen sind schon richtig. Die Begebenheiten im Zusammenhang mit St. Servatius als nationalsozialistischer Weihestätte – von denen Sie sprachen – sind hinreichend belegbar, da haben Sie Recht. Altar, Kanzel und Gestühl ließ man beispielsweise aus der Kirche entfernen und den gotischen Chor“, er zeigte hinter sich, „mauerte man einfach zu. – Soweit scheint alles klar zu sein. Aber Heinrich den Ersten hat man höchstwahrscheinlich nie hier begraben!“
„Woher wollen Sie das so genau wissen?“, der Professor war skeptisch. „Die Unterlagen, die ich kenne, werfen diesbezüglich lediglich einige Fragen auf.“
„Vielleicht haben Sie die falschen Dokumente eingesehen. Denn nur von ‚Fragen aufwerfen‘ kann keine Rede mehr sein.“
„Hören Sie zu, guter Mann“, Professor Meinert war trotz der Kritik, die an ihm geübt wurde, erstaunlich verträglich, „wenn Sie etwas wissen, erzählen Sie es uns. Ich bin bei Weitem kein Laie, aber wenn ich in meinem Alter noch etwas lernen kann, bin ich immer darüber erfreut.“
Semmler bemerkte anscheinend, dass er nicht näher an eine Entschuldigung des Professors für das permanente Unterbrechen seiner Führung herankam und fing daher an, zu berichten: „Es ist offensichtlich, dass vor allem Sie beide“, er blickte Professor Meinert und seine Tochter an, „ausgesprochen gut in geschichtlichen Fragen bewandert sind. Ich für meinen Teil bin gelernter Stellmacher und habe erst vor wenigen Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Mein Wissen ziehe ich also – gerade für den neueren Teil der deutschen Geschichte – aus eigenem Erleben oder den Gesprächen mit Zeitzeugen. Wussten Sie zum Beispiel, dass in Quedlinburg im Verhältnis zur Einwohnerzahl nirgendwo sonst in der DDR in der Wendezeit des Jahres 1989 mehr Menschen auf die Straße gegangen sind und für ihre Rechte demonstriert haben? – Nein? Interessant, nicht wahr? Ich sollte aber nicht abschweifen, zurück zu Heinrich dem Ersten.
Natürlich hat Himmler das angebliche Auffinden der verlorenen sterblichen Überreste des deutschen Königs propagandistisch verwertet. Warum auch nicht, allein schon der tausendste Todestag Heinrich des Ersten war quasi ein Glücksfall für das „Tausendjährige Reich“. Man widmete dem König prompt Sonderhefte, Postkarten und eine SS-Gedenkplakette. Die Entdeckung seines Leichnams machte die Geschichte quasi perfekt, zu perfekt, wie ich Ihnen jetzt berichten werde.“
Selbst die Mossad-Agenten hörten Semmler nun aufmerksam zu und Torben bemerkte, dass Julia regelrecht an seinen Lippen hing. „Die Nazis waren nicht die Ersten, die nach den sterblichen Überresten gegraben haben“, fuhr Semmler in ihrer Mitte stehend fort. „Bereits bei einer Grabung im Jahre 1756 hat man in der Ruhestätte von Königin Mathilde überzählige Knochen gefunden. Schon damals wurde vermutet, dass es die ihres Gemahls sein könnten. Himmler ließ den Sarg 1936 daher erneut öffnen und eben diese Gebeine anthropologisch untersuchen. Das Ergebnis fiel jedoch nicht wie gewünscht aus, und so wurden sie fortan lediglich als Reliquienknochen bezeichnet.