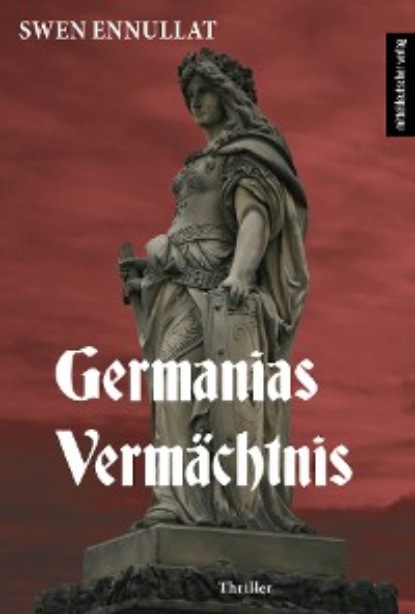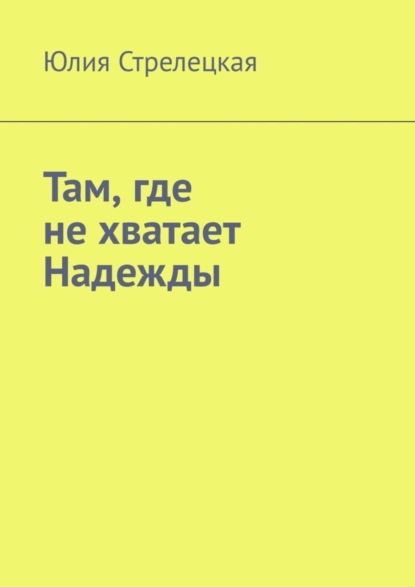- -
- 100%
- +
Die Suche ging also weiter und die vom Reichsinnenminister beauftragten Mitarbeiter der Abteilung Vorgeschichte standen von Anfang an bei ihrer Arbeit unter enormem Erfolgsdruck. Ein Scheitern wäre von Himmler sicherlich nicht ohne Konsequenzen für sie und ihre Karrieren, schlimmstenfalls sogar für ihre Familien hingenommen worden. Glücklicherweise und zu ihrem eigenen Erstaunen konnten sie aber alsbald verkünden, bei Grabungen im Untergrund der bislang leeren Grabstätte des Königs ein weiteres Skelett und verschiedene Grabbeigaben gefunden zu haben, die die berechtigte Vermutung zuließen, dass es Heinrich der Erste sein könnte.“
Der Professor unterbrach Semmler daraufhin: „Das sage ich doch die ganze Zeit! – Bislang erzählen Sie nichts Neues! – Ich weiß, dass jeder Wissenschaftler, der das Ergebnis damals anzweifelte und so die Nazi-Propaganda störte, mundtot gemacht wurde. Ich will Ihnen aber zu Gute halten, dass nach dem Krieg ein DDR-Forscher herausbekommen haben will, dass die Knochen viel zu jung sein sollen. Man müsste sie heute erneut und gründlich untersuchen. Vielleicht meinten Sie das vorhin mit Ihrer Bemerkung.“ Er winkte gönnerhaft ab.
Derweil schien Annabells weibliche Intuition anzuschlagen und sie sah Semmler durchdringend an. Irgendetwas schien sie misstrauisch zu machen und sie sagte: „Moment, George“, sie sprach ihren Vater bewusst mit seinem Vornamen an, um sich seiner Aufmerksamkeit sicher zu sein, „nicht so schnell! Unser Stadtführer weiß noch mehr über die Sache. Stimmt’s?“
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht nickte Semmler kurz und erklärte in Richtung des Professors: „Ihre Tochter hört genauer hin als Sie.“ Er räusperte sich kurz. „Normalerweise erzähle ich den Touristen die offizielle Version, weil alles andere zu phantastisch klingt. Für Sie mache ich aber heute eine Ausnahme. – Sie hatten Recht mit den Untersuchungen zu DDR-Zeiten. Genaugenommen war es bereits Ende der Fünfzigerjahre! Und Sie werden nie glauben, zu welchen Ergebnissen diverse anthropologische Untersuchungen und Nachforschungen in dutzenden Heimatarchiven und Kirchenbüchern kamen.“
Er machte eine bedeutungsschwangere Pause, bevor er leicht theatralisch fortsetzte: „Die Gebeine, die Himmler unter großen Pomp beisetzen ließ, sind nicht nur mehrere hundert Jahre zu jung, sie stammen auch von einer … Frau.“
Torben spürte plötzlich Julias Hand auf seinem Arm.
„Und es kommt noch besser“, Semmler genoss es, endlich die ihm zustehende Wertschätzung zu erfahren, „es sind die Gebeine einer Hexe!“
Julias Händedruck wurde stärker und Torbens Blick traf sich mit dem des Professors. Beim Nicken Professor Meinerts wurde ihm klar, dass vor ihnen die Spur lag, die zu finden sie gehofft hatten. Er versuchte daher schnell, Semmler noch weitere Informationen zu entlocken: „Woher wissen Sie das mit der Hexe?“
Ihr Stadtführer zuckte mit den Schultern „Ein paar alte Aufsätze verschiedener Wissenschaftler, ein kaum bekanntes Buch eines regionalen Heimatforschers aus dem 18. Jahrhundert und diverse vergilbte Urkunden und Aufzeichnungen in den Stadtarchiven. Wenn man die Zeit hätte, alle Quellen ausführlich zu prüfen, könnte man es sicherlich mit ausreichenden Beweisen belegen. So aber müssen Sie mir im Moment in dieser Hinsicht vertrauen.“
„Aber Sie wissen, wer die Frau war?“, fragte Annabell trotzdem nach.
„Bei ihrem Namen müsste ich nochmal nachschauen. Der ist mir entfallen. Aber es war auf jeden Fall eine neunzehnjährige Magd, die unter dem Einfluss der Folter gestanden hat, eine Priesterin der schwarzen Magie zu sein, und dafür erdrosselt wurde. Weil sie vor ihrer Hinrichtung glaubhaft bereute und ihren Irrglauben widerrief, machte man sozusagen eine Ausnahme und bestattete sie trotz ihrer Verfehlungen auf heiligem Boden, allerdings möglichst nah an den Reliquien der Kirche, die eine göttliche und reinigende Macht ausstrahlen sollten. – Wahrscheinlich wurden ihre Gebeine nur deshalb zufällig bei den Ausgrabungen gefunden.
Himmler pochte derweil vehement auf einen Erfolg. Was also lag näher, als ihm ein gut erhaltenes Skelett als deutschen König zu präsentieren?“
Semmler schien für den Professor plötzlich nicht mehr interessant.
Er wandte sich Torben zu und sagte: „Es passt alles zusammen. Können Sie sich an Nordhausen erinnern, wo uns ebenfalls eine Rolandsstatue den Weg wies? Auch dort hatte Mathilde ein Stift gegründet, als ihr Heinrich der Erste die Stadt schenkte. Jetzt ist es also Quedlinburg in dem aller Voraussicht nach die Hexen im Geheimen die Geschicke der Stadt geführt haben.“
Semmler, verblüfft, dass er schon wieder nicht mehr beachtet wurde, räusperte sich hörbar und meldete sich nochmals zu Wort: „Was meinen Sie mit ‚Hexen‘ und ‚die Geschicke der Stadt führen‘? Dass die Reste einer Hexe in Heinrichs Grab liegen, heißt doch nicht, dass sie die Stadt regiert hat. Man hat die Gebeine lediglich verwechselt. Eigentlich müsste man jetzt weiter nach dem Grab des deutschen Königs suchen.“
„Wie Sie meinen.“ Der Professor wirkte nun doch leicht überheblich. Der Stadtführer war ihm ab jetzt offensichtlich egal.
Torben versuchte zu vermitteln und gleichzeitig vom Thema abzulenken: „Herr Semmler, manchmal hat Professor Meinert eben verrückte Ideen.“ Er lachte gekünstelt. „Was mich vielmehr interessieren würde – wo Sie doch so gut in der Geschichte Quedlinburgs bewandert sind – fällt Ihnen etwas Besonderes im Zusammenhang mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dieser Kirche hier oder der Stadt ein? Irgendetwas, was vielleicht – sagen wir einmal – ungewöhnlich ist?“
„Ich weiß nicht.“ Der Stadtführer war anscheinend für Torbens Schmeichelei anfällig und überlegte. „Quedlinburg wurde fast kampflos von den US-Amerikanern eingenommen. – Gott sei Dank muss man an dieser Stelle sagen, nur dadurch wurde die Altstadt, die Sie heute noch bewundern können, nicht zerstört.“
„Wieso kampflos?“ Levitt schaltete sich ins Gespräch ein. Alles Militärische schien ihn besonders zu interessieren.
„Ganz einfach, Quedlinburg war quasi eine Lazarettstadt. In dutzenden Villen, Sporthallen und Kirchen wurden in Notlazaretten seit 1943 Verwundete versorgt. Zeitweilig waren es an die achttausend Personen. Schon mit Hinblick auf das Schicksal der Verletzten war ein verbissener Verteidigungskampf nicht möglich.“
„Sie sprechen von Tausenden Menschen. Für so viele Patienten war doch auch zusätzliches Pflegepersonal notwendig, nicht wahr?“, fragte Julia.
„Natürlich“, antwortete Semmler, „die Ärzte und vor allem Krankenschwestern kamen aus ganz Deutschland.“
Torben blickte wieder zum Professor und sagte nur „Bad Mergentheim“. Sein Freund nickte.
„Bitte, was meinten Sie?“ Semmler schaute Torben an.
„Ach, nichts Besonderes. – Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Reden Sie ruhig weiter.“
Der Stadtführer versuchte, den letzten Gedanken wieder aufzunehmen und erzählte: „Das Aufregendste am Kriegsende war der Verlust unseres Domschatzes und Jahrzehnte später seine glückliche Rückkehr!“
„Ich kenne die Geschichte. Sie ging schon vor zwanzig Jahren durch die Medien und wird regelmäßig aufgewärmt. Jeder Archäologe träumt von solch einem Fund“, bemerkte Annabell.
Leicht flapsig erwiderte Torben darauf: „Okay, kann mich trotzdem mal jemand aufklären?“
„St. Servatius verfügt über einen der bekanntesten und kostbarsten Kirchenschätze des Mittelalters, Reliquien gefertigt aus Gold, Edelsteinen und Elfenbein, Geschenke an das mächtige Damenstift“, erklärte Semmler und behielt bei seinen Ausführungen den Professor im Auge. „Bereits 1943 hatte man den Domschatz in einen unterirdischen Stollen unter der Altenburg ausgelagert, nicht sehr weit von hier entfernt. Als die US-Amerikaner die Höhle fanden, entwendete einer ihrer Soldaten zwölf der wichtigsten Stücke und schickte sie seiner Familie per Feldpost nach Hause. Nach dem Tod des GI versuchten seine Erben Anfang der Neunzigerjahre, die Stücke auf dem internationalen Kunstmarkt zu verkaufen. Nachdem deutsche Millionen flossen und nach einem langen juristischen Tauziehen kehrte der Schatz oder zumindest der größte Teil davon, zwei Stücke blieben nämlich unauffindbar, 1993 auf seinen angestammten Platz zurück. Sie können ihn gerne in der Domschatzkammer wenige Meter von hier bewundern.“ Er streckte seinen rechten Arm nach hinten aus und wies damit in Richtung einer Ausstellung.
„Eine wirklich interessante Geschichte.“ Torbens Bemerkung war ernst gemeint. „Aber Sie erzählen sie doch sicherlich nicht ohne Grund. Ich hatte nach etwas Ungewöhnlichem gefragt, nach etwas, was die wenigsten Menschen wissen können! Wieso gerade diese Geschichte, wenn alle Medien bereits darüber berichtet haben?“
Sein Nachbohren war erfolgreich, denn Semmler nickte geheimnisvoll und sagte: „Dass der Schatz wieder auftauchte, war eine Sensation, gewiss. Das Ungewöhnliche ist jedoch, dass gerade zwei Gegenstände verschwunden blieben, von denen ich glaube, dass sie eine besondere Bedeutung haben müssen.“
„Ich versteh nicht recht, was Sie uns damit sagen wollen?“ Professor Meinert war skeptisch.
Ihr Führer jedoch blieb rätselhaft und erwiderte: „Ich kenne jemanden, dem es eher zusteht, diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Zwar könnte ich es auch, weil ich sie schon etliche Male gehört habe, noch kann sie es aber selbst.“
„Sie?“, fragte Julia.
„Ja, meine Tante. Ihr Name ist Frieda Kern. Ich kann Sie miteinander bekannt machen, wenn Sie möchten. Allerdings“, Semmler blickte reihum, „sollten wir Ihre Gruppe wohl etwas verkleinern. Ich will nicht, dass sie sich zu sehr aufregt.“
X
Wie die gekreuzten blauen Schwerter belegten, war die Teetasse aus echtem Meissener Porzellan und Torben stellte sie vorsichtig – darauf bedacht, sie nicht zu zerbrechen – neben seinem aufgeschlagenen Notizbuch ab.
Obwohl er schwarzen Tee nicht mochte, hatte er es nicht übers Herz gebracht, das Angebot der alten Dame, die ihm und dem Professor gegenüber saß, auszuschlagen. Während sie Milch bevorzugte, hatte Torben das heiße Getränk mit viel Zucker für sich genießbar gemacht.
Natürlich hatten sie Semmlers Angebot sofort angenommen, seine Tante und offensichtliche Zeitzeugin der Kriegsjahre kennenzulernen. Spätestens als er erfahren hatte, dass Mathildes Quedlinburg im Zweiten Weltkrieg auch nichts anderes als ein riesiges Krankenhaus gewesen war, wusste Torben, dass die Priesterinnen die Stadt – wie Bad Mergentheim – ebenfalls dazu genutzt hatten, um erneut in einer Menge medizinischen Personals unterzutauchen. Schließlich musste es ihr innerer Antrieb gewesen sein, das Wissen anzuwenden, das sie über Jahrhunderte über das Heilen von Krankheiten und Verletzungen gesammelt und von Generation zu Generation weitergegeben hatten.
Schon der Hinweis der sterbenden Margot hatte in ihm den Verdacht aufkommen lassen, dass das Geheimnis, dem sie nachspürten, auch mit den letzten Kriegstagen in Verbindung stehen könnte. Insoweit gab es nichts Besseres, als mit jemandem zu sprechen, der diese Zeit noch selbst hautnah erlebt hatte. Semmlers Hinweis aufnehmend, hatte Torben vorgeschlagen, lediglich gemeinsam mit dem Professor dessen Tante aufzusuchen. Auch wenn zumindest Levitt sie augenscheinlich gerne begleitet hätte, kam von niemandem Widerspruch. Offenbar hatten beide in ihrer Gruppe noch immer so etwas wie ein Exklusivrecht, einen Bonus, weil sie es waren, die vor einigen Monaten zuerst die Tore zur Geschichte weit aufgestoßen hatten.
Frieda Kern erwies sich als zähe, kleingewachsene Frau, deren Lederhaut verriet, dass sie ihr ganzes Leben im Freien verbracht hatte. Das Fehlen jeglicher Fettpolster und ihr sehniger Körperbau zeigten, dass dieses Leben vermutlich mit harter körperlicher Arbeit verbunden gewesen war.
Nun lebte sie am Rande Quedlinburgs allein in einer kleinen Zweiraumwohnung, welche die Masse der Andenken an die verschiedenen Stationen ihres Lebens kaum fassen konnte. Umrahmt von Fotografien, kleinen Schnitzereien, Figuren, Muscheln und einer Vielzahl anderer billiger Souvenirs stand dabei die Schwarzweißaufnahme eines Mannes im reiferen Alter quasi im Zentrum der Erinnerungsstücke. Frieda Kern hatte ihnen bereits erzählt, dass es sich dabei um ein Foto ihres vor einigen Jahren verstorbenen Ehemannes handelte. Sie erklärte ihnen auch ihr genaues Verwandtschaftsverhältnis zu Semmler, dem Fremdenführer und Neffen der alten Dame, der sie einander vorgestellt hatte, jetzt aber wieder anderen Geschäften nachging.
Torben hörte an dieser Stelle möglicherweise nicht mit der gebotenen Aufmerksamkeit zu, beobachtete aber umso genauer.
Er schätzte Frieda Kerns Alter auf circa achtzig Jahre, ihre verkrümmten Finger schienen ein sicheres Anzeichen von Arthrose und mit der getrübten Linse des rechten Auges sah sie sicherlich nicht mehr viel. Dennoch wirkte sie agil und besaß noch immer einen wachen Verstand. Schon allein aufgrund ihres Alters erinnerte sie ihn an seine Großmutter. Er mochte sie auf Anhieb, fühlte sich auf der eigentlich viel zu weichen Couch inmitten ihres Plunders ausgesprochen wohl und war gespannt, was sie zu berichten hatte. „Sie wollen also etwas über den Domschatz und sein Verschwinden hören“, begann Frieda Kern kurz darauf.
„Das Verschwinden, das Wiederauftauchen, alles was nicht in irgendwelchen Zeitungen stand.“ Torbens offenes Lachen war ehrlich gemeint und öffnete das Herz der alten Dame. Sie seufzte. Mit Blick auf das Foto ihres verstorbenen Mannes begann sie zu erzählen.
„Mein lieber Willi, Gott hab ihn selig, war ein ausgesprochen treuer und liebevoller Mann. Aber manchmal“, sie lächelte verschmitzt, „mögen Frauen eben auch das blanke Gegenteil. Schroffheit und Desinteresse können auch sehr anziehend sein.
Zum Kriegsende im Frühjahr 1945 war ich gerade einmal dreizehn Jahre alt und unsterblich in einen zwei Jahre älteren Jungen verliebt, der natürlich nichts von seinem Glück wusste. Natürlich war Krieg, aber wir waren auch Kinder. Wir sprühten vor Energie und Lebensfreude trotz all dem Leid um uns herum.
Ich versuchte natürlich, die Aufmerksamkeit des Jungen zu erregen. Aber was ich auch machte, nichts wollte klappen. Rückblickend ist das auch nicht verwunderlich, denn meine Mutter verhalf mir jeden Morgen zu schrecklich bieder aussehenden Zöpfen, und von weiblichen Rundungen war bei mir noch nichts zu sehen. Vermutlich sah ich eher wie eine Elfjährige aus, ein Umstand, der wenig später bei der Vielzahl stationierter amerikanischer und danach russischer Soldaten gar nicht schlecht war. Als junges Mädchen nicht aufzufallen, war damals eindeutig ein großer Vorteil, denn es gab immer wieder Fälle, wo sich die ausgehungerten Männer gewaltsam nahmen, was sie begehrten.
Kurzum, es gab also diesen Jungen. Sein Name war Carl, und ich suchte auf plumpe Art und Weise ständig seine Nähe. Wenn er mit seinen Freunden auf der Straße Fußball spielte, schaute ich – natürlich betont desinteressiert – zu. Wenn er mit seinen Eltern sonntags in der Kirche war, drängte ich in seine Richtung. Jeden Abend vor dem Schlafengehen galten meine letzten Gedanken ihm und unserer gemeinsamen Zukunft. Alles andere war mir egal.
Carl besaß ein gewisses zeichnerisches Talent. Es kam dabei schon einmal vor, dass er jemanden für einen Groschen mittels Bleistift porträtierte. Obwohl ich wochenlang ein solches Geldstück bei mir trug, habe ich ihn natürlich nicht gefragt, ob er mich auch einmal malen könnte. Zu groß war meine Angst, dass er mich auslachen oder abweisen würde.
Plötzlich erreichte der Krieg aber auch unsere Stadt und das Leben änderte sich über Nacht. Die Amerikaner rückten ein, durchsuchten jedes Haus, jeden Schuppen, jede Scheune und jeden Keller. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Gesichter der beiden Soldaten, die das Haus meiner Eltern kontrolliert haben, noch immer vor mir, solche Angst hatten wir damals, dass sie uns ausrauben und erschlagen würden. Im Großen und Ganzen verhielten sie sich aber den Umständen entsprechend höflich, wohl auch, weil meine Mutter ihnen ein paar Gläser eingemachtes Obst schenkte.
Wer den Alliierten allerdings suspekt vorkam, allen voran Männer im wehrfähigen Alter, in denen man Wehrmachtssoldaten oder SS-Angehörige vermutete, wurde in Gewahrsam genommen und verhört. So erging es dann auch dem Ehemann von Carls Schwester, der eigentlich nur wegen einer in Russland erlittenen Handverletzung nicht mehr an die Front zurückkehren musste. Er wurde sofort in das Gemeindehaus gebracht, das kurzerhand zum Gefängnis umfunktioniert worden war.
Carl suchte natürlich einen Weg, seinen Schwager zu befreien und trieb sich deshalb in der Nähe der GIs herum. Er muss sehr schnell bemerkt haben, dass einige höherrangige Soldaten im Besitz von sogenannten Entlassungsscheinen waren, in denen lediglich der Name der freizulassenden Person eingetragen werden musste. Um an ein solches Dokument zu gelangen, wählte er sich auf dem Marktplatz einen jungen Offizier mit weichen Gesichtszügen aus, und über sein zeichnerisches Talent – er bot ihm an, ihn zu porträtieren – konnte er mit ihm in Kontakt treten.“
„Ich vermute, das war Joe Thomas Meador, nicht wahr, mein Liebe?“, dem Professor fiel es wieder einmal schwer, stillschweigend zu lauschen.
„Ja, sein Name war Meador. Sie haben also von ihm gelesen?“
Professor Meinert nickte, und Torben, der sich nebenbei die eine oder andere Notiz gemacht hatte, schloss die Frage an: „Muss mir dieser Name etwas sagen?“
Der Professor blickte in Frieda Kerns Richtung, als wolle er sich die Erlaubnis für seine Antwort holen. Ihren angedeuteten Lidschlag verstand er als Einwilligung und erklärte Torben: „Wir sagten Ihnen doch bereits, dass jeder Historiker die Odyssee des Domschatzes kennt. Meador war für sie verantwortlich!
Er war Oberleutnant des 87. US-Artillerie Bataillons. Er war knapp dreißig Jahre alt, als er ab 1944 in Europa gegen die Nazis kämpfte. Von Bedeutung ist, dass er vor dem Krieg Kunstgeschichte studiert hatte und dadurch, im Gegensatz zu seinen Kameraden, – sagen wir einmal – besonderes Augenmerk auf historische Gebäude und Artefakte legte. Oder, um es anders auszudrücken, er brachte alles, was von Wert sein könnte, in seinen Besitz und schickte es gut gepolstert und sorgfältig verpackt per Feldpost an seine Familie nach Texas, egal ob nun Silberbestecke, Porzellan oder Ölgemälde. Nicht nur einmal wurde er deshalb von seinen Vorgesetzten gerügt. Ich erinnere mich dunkel, dass er deshalb auch vor einem Kriegsgericht gestanden hat. Das hielt ihn natürlich nicht von seinen Beutezügen ab, vielmehr wurde er nur vorsichtiger, darauf bedacht, künftig nicht mehr ertappt zu werden. Und er war selbstverständlich kein Einzelfall. Viele andere alliierte Soldaten taten es ihm überall in Europa gleich. Das ist ganz typisch für Kriege, erinnern Sie sich bitte nur einmal an die US-Invasion im Irak des Sadam Hussein und die Kunstgegenstände, die dort abhandenkamen.
Aber genug davon und zurück zu dem Jungen, von dem Frau Kern gerade sprach. Ihm ist es jedenfalls tatsächlich gelungen, eben diesem Meador einen Entlassungsschein zu entwenden. Der hat es nicht einmal bemerkt. Für ihn war nur wichtig, dass er endlich jemanden gefunden hatte, der sein künstlerisches Interesse teilte oder zumindest ein gewisses Talent für Malerei besaß. Also freundete er sich mit Carl an. Vielleicht war er es sogar, der Meador einen geheimen Zugang zu den Altenburger Höhlen gezeigt hat, in denen der Domschatz einige Jahre zuvor eingelagert worden war. Selbstverständlich hatten die Amerikaner das Versteck schon gefunden, allerdings bewachten sie nur den Haupteingang, weil sie dachten, es gebe nur einen Weg ins Innere.
Meador gelangte aber trotzdem unbemerkt hinein und stahl die wertvollsten zwölf Artefakte der Stiftskirche aus dem Bergstollen. Auch diese schickte er wieder zu seiner Mutter in die Staaten. Als er Monate später selbst nach Hause zurückkehrte, verkaufte er die Stücke jedoch nicht, sondern behielt sie selbst. Erst Jahrzehnte später, Jahre nach seinem Tod, versuchten seine Erben in den Achtzigerjahren, die Relikte nach und nach auf dem internationalen Kunstmarkt zu veräußern. Natürlich erregten sie Aufsehen, deutsche Behörden schalteten sich ein, anfangs flossen Millionen in Richtung der Verkäufer, es gab Prozesse und man überschüttete sich gegenseitig mit Vorwürfen.“
„Letztendlich kehrten aber zehn Reliquien auf ihren angestammten Platz zurück, nicht wahr?“, fragte Torben nach.
„Ganz richtig, mein Sohn“, meldete sich auch Frau Kern nun wieder zu Wort. „Das sogenannte Bergkristall-Reliquiar und ein Umhängekreuz fehlen allerdings bis heute.“ Sie lächelte geheimnisvoll. Torben spürte förmlich, dass sie genau wegen dieses Umstandes hier waren. Er fragte sie ganz direkt: „Spannen Sie mich bitte nicht weiter auf die Folter. Was wissen Sie darüber?“
„Über die Umstände des letztendlichen Verschwindens in den Vereinigten Staaten weiß ich gar nichts. In den Zeitungen stand nur, dass beide Gegenstände in Dallas abhandengekommen sein sollen. Mehrere Zeugen berichteten, sie weit nach Kriegsende noch im Besitz von Meador gesehen zu haben. – Allerdings“, ihr spitzbubenhaftes Lächeln kehrte zurück, „habe ich als junges Mädchen eine Beobachtung gemacht, die mit eben diesen beiden Gegenständen in Verbindung stehen könnte.“
Bedeutungsvoll nahm Frieda Kern noch einen Schluck aus der Teetasse und begann danach zu erzählen: „Natürlich sprach es sich sehr schnell herum, dass Carl viel Zeit mit einem US-amerikanischen Offizier verbrachte. Während einige ihn für diesen Umgang mit dem Feind verachteten oder wieder andere ihn um seine neuen, guten Beziehungen beneideten, überwältigte mich ein völlig anderes Gefühl, nämlich Eifersucht! Was treibt wohl ein erwachsener Mann mit einem zarten Jungen, der halb so alt wie er selbst ist? Wieso verbringt er seine Freizeit mit ihm? Auch wenn es Carl nicht gemerkt hat, ich habe gespürt, welche Neigungen Meador hatte.
Es machte mich zu dieser Zeit jedenfalls völlig verrückt, mir vorstellen zu müssen, was Meador mit meinem Carl jeden Nachmittag, wenn sie verschwanden, anstellte. Also passte ich sie eines Morgens ab und verfolgte ihren Jeep mit meinem alten und viel zu großen Damenrad. Glücklicherweise schien es Meador nicht eilig zu haben und mir gelang es dadurch, an ihnen dranzubleiben. Natürlich wurde der Abstand zwischen uns immer größer und irgendwann verlor ich sie gänzlich aus den Augen.
Außer Atem wie ich war und völlig betäubt von dem Gedanken an meine Jugendliebe, kam mir aber Aufgeben nicht einmal ansatzweise in den Sinn. Ich folgte der Straße, einem ungepflasterten Feldweg, immer weiter. An Kreuzungen versuchte ich anhand von frischen Fahrspuren, die richtige Richtung zu erahnen und drang dabei in den Wald über den Altenburger Höhlen vor, viel weiter, als jemals zuvor. Ich wusste, dass es Gerüchte gab, dass sich hier noch versprengte deutsche Soldaten aufhalten sollten, die unter anderem Waffendepots bewachten. Mein Sinn für Gefahr kehrte allmählich zurück, und ich begann langsam, wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Gerade als ich umkehren wollte, erblickte ich jedoch in einiger Entfernung Meadors Wagen und schöpfte wieder neuen Mut. Er stand, abwärts des Weges geparkt, nur einhundert Meter von mir entfernt. Meador war außerhalb des Autos, und Carl konnte ich hinter der Frontscheibe im Inneren entdecken. Es schien, als wäre er in ein Buch vertieft. Er nahm nichts von seiner Umgebung wahr.
Zu meiner völligen Überraschung lief aber Meador plötzlich und scheinbar zielgerichtet los. Über der Schulter hing ihm lose ein Rucksack, der offensichtlich leer war. Ich konnte erkennen, wie er langsam den kleinen Hang des Hügels hinaufkletterte. Ab und an stützte er sich dabei an einem Baum ab. Bei diesen Gelegenheiten blickte er sich regelmäßig um, als ob er sicher gehen wollte, nicht verfolgt zu werden.
Ich war damals völlig verwirrt, weil ich mich wohl getäuscht hatte und gleichzeitig doch unendlich erleichtert, dass Meador mit meinem geliebten Carl gar kein geheimes Schäferstündchen verbrachte. Aber was machte er dann mitten in dieser Einöde?
Um der Frage nachzugehen, versteckte ich schnell mein Fahrrad in einem Graben hinter einem Gebüsch und folgte Meador vorsichtig. Das war übrigens nicht so einfach, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Ich nutzte dafür umgestürzte Baumstämme, Gestrüpp und Bodensenken, immer darauf bedacht, dass er mich nicht sah oder hörte. Plötzlich – ich war vielleicht sechzig Meter von ihm entfernt – blieb er in einer kleinen Vertiefung, ähnlich einem Trichter, stehen. Er hantierte kurz an irgendetwas herum und war einen Moment später wie vom Erdboden verschluckt.