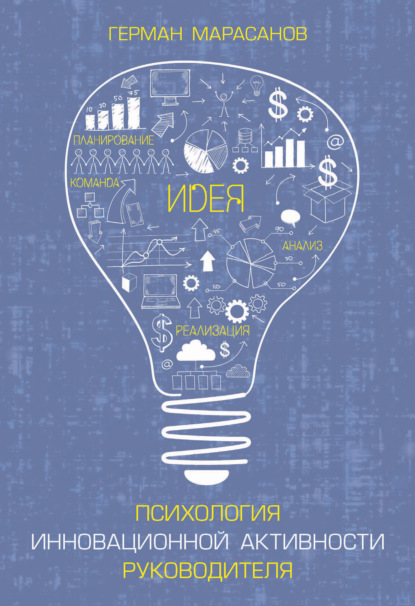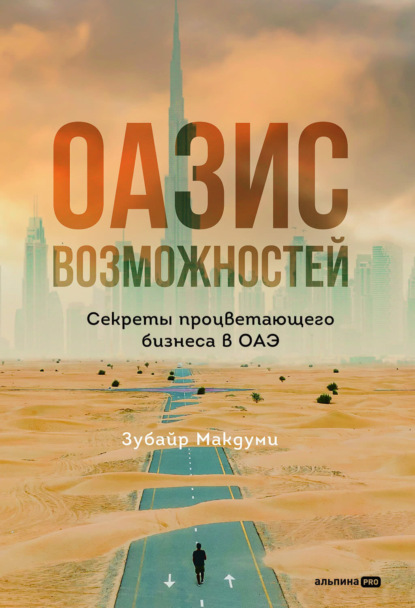- -
- 100%
- +
Sehr schmerzlich fehlte eine Ideologie, die ebenso dynamisch, aber innerlich ganz anders als damals die Französische Revolution, hoch und niedrig ergriffen und begeistert hätte, eine Ideologie, die gleichzeitig zum Herzen, zum Verstand und zu den Sinnen sprechen sollte. Das aber muß man gestehen, ist ein Problem, das das restliche, freie Europa bis auf den heutigen Tag noch immer nicht gelöst hat.
Was sich also im „Vormärz“ wiederum ankündigte, war Ortegas „Rebellion der Massen“,25 die mit dem Bürgertum-Kleinbürgertum schon eine große Schlacht gewonnen hatte, dann die Hefe des Volkes mobilisierte und erst später auf das rasch entstehende industrielle Proletariat übergriff. Die Metastasen entwickelten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in richtige Krebsgeschwüre. Die Militärinterventionen der Heiligen Allianz, die Miguelitenkriege und Karlistenkriege in Portugal und Spanien, die Erhebung der Griechen, die belgische, die polnische und vor allem die Juli-Revolution in Frankreich waren unheilverkündende Wetterleuchten. Die Juli-Revolution rief den Bürgerkönig Louis Philippe auf den Thron; er war aber nicht mehr König von Frankreich, sondern König der Franzosen, also nicht mehr Vater des Vaterlandes, sondern eine Art Anführer der Nation. Er war bezeichnenderweise ein Sohn des infamen Philippe Égalité, des verkommenen Königsmörders aus der Revolutionszeit, Chef des Orléans-Zweiges des Hauses Bourbon. Er und sein reformierter, liberaler Kabinettschef Guizot „langweilten“ jedoch die Franzosen, und beide mußten 1848 nach der Errichtung einer Zweiten Republik nach England flüchten.26)
Schon 1840 war es zu einer gefährlichen Spannung zwischen der liberalen Monarchie und den deutschen Ländern gekommen. Damals wurde die Wacht am Rhein von Schneckenburger gedichtet, die allerdings erst im Kriege 1870–71 dank ihrer Vertonung durch K. Wilhelm größte Popularität erlangte und auch im Ersten Weltkrieg neben dem Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ die beliebteste Kampfmelodie wurde. Mit der napoleonischen Herrschaft war das deutsche Nationalgefühl zusätzlich aufgerüttelt worden.27) Gerade die Krise von 1840, die auch in Frankreich die nationale Begeisterung anfachte, zeigte deutlich, daß die Kriege von nun an wirkliche Volkskriege zu werden drohten. In den Revolutionen des Jahres 1848, sowohl in Frankreich als auch in Österreich, Ungarn und Italien war es offenbar geworden, daß der Aufbruch, der damals stattfand, zugleich politisch, national und nicht zuletzt auch „sozial“ war. Es regten sich alle kollektiven Kräfte. Diese Revolutionen und Rebellionen waren alle linksdrallig und nährten sich offensichtlich von den Ideen der Französischen Revolution.
Was ist aber im Gegensatz zu ‚rechts’ nun wirklich ‚links’? Hier müssen wir zuerst einmal ein wenig Etymologie betreiben. Erinnern wir uns daran, daß in fast allen Sprachen der Begriff ‚links’ eine pejorative und ‚rechts’ eine positive Bedeutung hat. Im Deutschen ist ‚rechts’ mit dem Recht, rechtlich, gerecht, richtig und redlich verwandt, während linkisch so viel wie ungeschickt bedeutet. Ähnlich ist es im Englischen und in den romanischen Sprachen. Im Italienischen ist sogar il sinistro (der Unglücksfall) dem Wort sinistro (links) entnommen. (Das französische gauche kommt vielleicht aus dem deutschen ‚wanken’.) In den slawischen Sprachen ist prav nicht nur die Wurzel von ‚rechts’ und dem Recht, sondern auch von ‚Wahrheit’, im Ungarischen ist jobb ‚besser’ sowohl auch als ‚rechts’, balsors hingegen ist das ‚linke Schicksal’, also das Unglück. Im Japanischen ist hidarimae, das ‚vor dem Linken Seiende’, das Ungemach, und im Sanskrit haben ‚rechts’ und ‚links’ jeweilig einen positiven und negativen Sinn.28) Auch die Bibel spricht dieselbe Sprache. So sagt uns Ecclesiastes 10,2 gegen alle Anatomie, daß das Herz des Weisen auf der rechten, das des Narren aber auf der linken Seite schlägt. Beim Jüngsten Gericht sind die Geretteten auf der rechten, die Verdammten aber auf der linken Seite des Herrn. Es ist also völlig legitim, diese beiden Begriffe wertend zu verwenden, und zwar links für den animalisch-kollektivistischen, rechts für den human-personalistischen Aspekt der menschlichen Psyche. Im parlamentarischen Leben gab es jedoch andere Regeln: So saßen die Vertreter der Regierung oft rechts und jene der Opposition links, oder auch waren die ‚Konservativen’ rechts und die ‚Progressisten’ links. Es war sicherlich ein verhängnisvoller Fehler in den Tagen der Weimarer Republik, die Nationalsozialisten auf die äußerste Rechte des Reichstags zu setzen. Als Nationalisten und Sozialisten gehörten sie auf die extreme Linke!29)
Was ist aber nun praktisch und politisch links? Die linke Vision, die linke Utopie ist eine monolithisch-kollektivistische – das Reich mit einer Partei, einem Führer, einer Ideologie, einer zentralistischen Regierung, einer Sprache, einer Rasse, einer Klasse, einer Einkommensstufe, einem Schultyp, einer Flagge, einer religiösen oder atheistischen Konfession (die auch Staatsreligion ist), einer Behandlung für beide Geschlechter, einem Gesetz für alle und eben nicht Ulpians Prinzip des suum cuique: „Jedermann das Seine.“ Die rechte und daher auch richtige Stellungnahme ist jener der linken entgegengesetzt: sie steht für die Vielfalt und die Person und nicht für die Einfalt und Kollektivität. Sie erinnert an die Botschaft des Heiligen Stefan, König von Ungarn, an seinen Erben, den Heiligen Emmerich: „Mein Sohn, ein Land von nur einer Sprache und einer Sitte ist ein schwaches und dummes Ding.“30) Für den Menschen von heute, der in seiner Mehrheit linksdrallig ist, muß diese Feststellung völlig unverständlich sein. Er steht unbedingt (auch in liberalen Demokratien) für die Uniformität, die Gleichschaltung aller ursprünglichen Verschiedenheiten, und zwar schon deswegen, weil er in ihr nicht nur eine Garantie der Stärke, sondern auch eine Forderung der Gerechtigkeit sieht. (Auch ist die Uniformität der Bürger für die Verwaltung geldsparend!) Nun wird man vielleicht einwenden, daß zumindestens die Gleichheit vor dem Gesetz gerecht sei, aber auch das ist eine fausse idée claire, eine klare, aber falsche Idee. Denn der Volljährige und der Minderjährige, der Gebildete und der Ungebildete, der Betrunkene und der seiner Sinne Mächtige, der Hungernde, der seine Familie nicht ernähren kann,31) und der Playboy, der stiehlt, um Spielschulden zu begleichen, können natürlich nicht mit den gleichen Maßstäben gemessen werden…, ebensowenig wie der Totschläger und der raffiniert planende Mörder.
Es ist also natürlich, daß der Linke ein Nationalist oder ein Rassist, der Rechte aber ein Patriot ist. Der Linke ist ein Materialist und Determinist, der im Menschen ein immanentes Wesen sieht, für den Mann der Rechten ist der Mensch transzendent, sein eigener Schwerpunkt ist anderswo. Für ihn ist die Beziehung „hinauf“ zu Gott etwas Primäres, Staat und Gesellschaft gehört er keineswegs unmittelbar an; die Familie – Ahnen, Frau, Eltern, die Verwandten seiner Frau, Geschwister, Kinder und Enkel – hat den Vortritt. Für den Linken ist das ganze Dasein voller Zwänge, sodaß der Raum des freien Willens kaum vorhanden ist – weder ideell, noch faktisch. Wie wir später sehen werden, ist der Mann der Rechten ein Liberaler, denn die Persönlichkeit braucht Freiheit für ihr Wachstum und ihre Vollendung.32) Der Mann der Rechten neigt dazu, in der Einzahl zu sprechen – ich, du, er und sie zu sagen. Der Mann der Linken ist ein Mann der Plurale, aber beileibe kein Pluralist: seine Rede – zumindestens im Politischen – ist stets in Pluralen. Wir, ihr und sie sind seine Schlüsselworte. Wir – die Proletarier, die Deutschen, die Arier, die Aufgeklärten, die Frauen, die Anhänger der Regierungspartei oder ihr, die Bourgeois, die Romanen, die Unterdrücker, die Männer der Oppositionspartei.33) Da allerdings darf man nicht vergessen, daß das moderne politische Leben ohne diese Plurale kaum denkbar ist, zumindestens aber nicht das parlamentarische Parteienleben, dessen Essenz die Auseinandersetzung nicht so sehr zwischen den Parteiführern wie zwischen den Wählermassen ist, die wiederum völkisch, klassenmässig, religiös, sozial umrissen sein können. Geleitet von Einzelpersönlichkeiten besteht das Parlamentgetriebe aus Gruppenkämpfen, die dann besonders fanatisch geführt werden, wenn weltliche Religionen, also Weltanschauungen und Ideologien, das treibende Element sind. Deren Existenz ist allerdings unausweichlich. Das Übel besteht eben darin, daß sie – ein so explosives Material! – politisch gegeneinander ausgespielt werden.
Der Zenit des Übels wird erreicht, wenn dann fanatische Mehrheiten sich der Regierung bemächtigen. Dazu haben sie im parlamentarischen Rahmen eine prachtvolle Gelegenheit, nicht aber noch in der konstitutionellen im Unterschied zur parlamentarischen Monarchie oder zur demokratischen Republik. „Teddy“ Roosevelt kam nach seiner Amtszeit auf einer Weltreise nach Wien und besuchte Kaiser Franz Joseph. Damals konnte Roosevelt noch nicht die bodenlose Dummheit und Niedertracht unseres so herrlichen Jahrhunderts voraussehen und stellte Franz Joseph die Frage: „Was, Majestät, glauben Sie, ist in diesem so fortschrittlichen Zeitalter noch die Rolle eines Monarchen?“ „Mr. Roosevelt,“ war die Antwort, „ich halte es für meine Aufgabe, meine Völker vor ihren Regierungen zu schützen.“ Heute sind aber nichteinmal mehr die Kinder im Mutterleib vor ihrer Legislative mit ihren verehrten Politikern sicher.
5. DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION UND DIE ROMANTISCHEN SOZIALISTEN
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten neue Faktoren in das politisch-gesellschaftliche Getriebe Europas ein, drei Faktoren, die nicht zufällig gemeinsame Sache machten: der Materialismus, der Sozialismus-Kommunismus, das Entstehen eines industriellen Proletariats. Diese neue Klasse, manchmal nicht sehr genau als Vierter Stand bezeichnet, war der Arbeiterstand, der sich größtenteils aus Bauernsöhnen ohne Land, aus brotlosen Handwerkern, Bettlern oder verarmten Kleinbürgern zusammensetzte. Man soll aber ja nicht glauben, daß diese Entwicklung einer Verarmunsgswelle gleichkam. Es ist vielmehr richtig, daß im Mittelalter,1) selbst im 16. und zuweilen auch im 17. Jahrhundert, der Lebensstandard der untersten Schichten keineswegs sehr niedrig war, doch senkte er sich danach, sodaß schon im 18. und selbst am Anfang des 19. Jahrhunderts das Bettlerwesen auch im Herzen Europas bedrohlich zugenommen hatte. Entgegen einer verbreiteten Meinung brachte die Industrialisierung einen geringen, wenn auch keineswegs zufriedenstellenden Wohlstand.2) „Familienlöhne“ gab es allerdings keineswegs, die Frauen, die Jugendlichen und in manchen Fällen selbst die Kinder mußten in das Erwerbsleben einbezogen werden. Die Gewinne aus den industriellen Unternehmen waren anfänglich auch ziemlich hoch, doch lebte die neue Unternehmerklasse nach heutigen Begriffen recht bescheiden. Aktiengesellschaften waren die Ausnahme, nicht die Regel: Wir haben es hier zumeist mit Familienbetrieben zu tun. Der Fabrikant hatte in der Regel Köchin, Stubenmädchen und Kutscher (was kein Luxus, sondern eine Berufsnotwendigkeit war). Er praßte in keinem Luxushotel, sein Sohn durfte oft gar nicht studieren und mußte nach seiner Sekundarausbildung nur zu oft als Stift hinter einem Schreibpult stehen. In Deutschland war dieser neue Unternehmerstand ganz vorwiegend evangelisch und sehr oft – wie die reichen Engels im Wuppertal – reformiert. Das war eine asketische Rasse, die ihre Gewinne in der Regel gleich wieder in den Betrieb steckte. Ihr Spar- und Unternehmergeist erreichte es, daß man bei uns die lange Durststrecke heil überqueren konnte, um dann nach der Mitte des 20. Jahrhunderts trotz zweier verlorener Kriege für die Arbeiterschaft einen beispiellosen Lebensstandard zu erreichen. Doch jede industrielle Gesellschaft muß eine lange Vorbereitungsperiode, ein Fegefeuer durchleiden, bis sie nach den Investitionen mit stets teurer werdenden Maschinen endlich das Hochplateau erreicht, auf dem echte Familienlöhne gezahlt werden können. Das sind sehr langwierige, für alle Betroffenen oft auch schmerzliche Phasen.3) Wir sprachen schon eingangs vom Lebensstandard eines Ludwigs XIV., der im großen und ganzen niedriger war als der eines deutschen Arbeiters. (Die „Lebensqualität“ ist allerdings etwas anderes als der rein materielle Lebensstandard, der in Pfennig und Mark ausgedrückt werden kann.) Man muß sich aber überdies vor Augen halten, daß nach neuesten Forschungen die Menschheit anderthalb Millionen Jahre alt ist und – falls wir diese 1,500.000 Jahre mit zwölf Stunden gleichsetzen – erst zwei Minuten vor zwölf (also in den letzten 5000 Jahren) an einigen ganz wenigen Plätzen der Erde einige ganz wenige Menschen ein Leben führen konnten, das wir nach heutigen Maßtäben als „menschenwürdig“ bezeichnen dürfen. Man stelle sich nur vor, welch „unmenschliche“ Existenz die Menschen führen mußten: als animalia insecura,4) also als recht instinktlose, primär auf Verstand und Vernunft angewiesene Wesen, viel schutzloser als die Tiere. In Höhlen oder unter Bäumen lebend, von Insekten zerbissen, von wilden Bestien bedroht, oft hungernd, frierend, die Säuglinge in Massen sterbend, von Kannibalen angefallen, durch schwere Geburten hinweggerafft – welch entsetzliches Dasein! So wissen wir heute, daß im Neolithikum Mitteleuropas von den Menschen, die das Säuglingsalter überlebt hatten, die Männer im Durchschnitt mit 28 und die Frauen mit 22 Jahren starben.5) Nun aber war die Neusteinzeit schon eine relativ ortgeschrittene Epoche und keineswegs die niedrigste Stufe der Menschheit! Neuzeitliches Elend und auch das Elend der sogenannten Dritten Welt muß man in diesen Perspektiven sehen und den Ausdruck ‚menschenunwürdig’ sehr, sehr vorsichtig gebrauchen. Umgekehrt müssen wir uns aber auch fragen, ob Charakteristiken, Gebräuche, Verhaltensweisen aus diesen anderthalb Millionen Jahren, die in unserer ‚hohen’ Kultur und Zivilisation wirklich „gegenstandslos“ geworden sind, vielleicht auch heute noch psychologisch kaum mehr erkannte Forderungen und Hinweise stellen. Der Krieg, nur um ein Beispiel zu nennen (und damit gewissermaßen auch die ihm verwandte Jagd), kam stets dem Agressionstrieb der Männer entgegen. In diesem konnten sie ihn stillen. Man muß sich da fragen, ob zwischen den Terrorbewegungen und den Jugendrevolten einerseits und dem Frieden des atomaren Gleichgewichts andererseits nicht etwa ein keineswegs so geheimnisvoller Zusammenhang besteht.6)
Doch kehren wir nun zum nicht wegzuleugnenden Elend der Arbeiterklasse am Anfang des industriellen Zeitalters zurück. Es ist keineswegs sicher, daß es zu einer echten Arbeiterbewegung (abgesehen von den Maschinenstürmern) und zur Geburt des Sozialismus auch ohne die Leitung und Anleitung von Intellektuellen gekommen wäre. Als Schlüsselfigur in dieser Bewegung muß man primär den britischen Fabrikanten Robert Owen erwähnen (der auch das Wort Communism erfunden hatte),7) weiters den französischen Kaufmann Fourier, den Grafen Saint-Simon, den deutsch-jüdischen Advokatensohn Dr. Karl Marx und den reichen Fabrikanten Engels aus Barmen. In ihren Ansichten, ihren Plänen, Ideologien und Utopien waren sie keineswegs aus einem Holz geschnitzt. Robert Owen war zweifellos ein rechter Idealist, aber kein systematischer Denker kontinentaler Prägung,8) Saint-Simon ein verarmter Aristokrat und Träumer, Fourier ein ausgesprochener Phantast, Marx ein reiner Theoretiker, dessen dogmatische Überzeugungen alle längst von der Wirklichkeit widerlegt worden sind, was man auch von Engels sagen kann, obwohl er im Leben ein „Praktiker“ war. Zu erwähnen wären auch freiheitliche, dem Anarchischen zuneigende Syndikalisten wie Pierre-Joseph Proudhon, ein Schriftsteller, Korrektor und Autodidakt, der russische Aristokrat Bakúnin, der in eine ähnliche Kerbe schlug, und der deutsch-jüdische Arbeiterorganisator Ferdinand Lassalle, der in seiner Ideologie auch rechtsdrallige Aspekte hatte und gar nicht unlogisch den Sozialismus mit der preußischen Monarchie verbinden wollte.9)
Wir dürfen aber hier nicht vergessen, daß diese Sozialisten ideologisch-utopische Vorläufer hatten wie Tomaso Campanella (1560–1939), einen verschrobenen Dominikaner, der monastisch beeinflußt, den „Sonnenstaat“ entwarf, und noch früher Joachim von Floris (1143–1202), einen nicht minder verrückten Zisterzienser. Beide waren adeliger Abstammung und beide kamen aus Kalabrien. Die Ideen des Joachim von Floris beeinflußten die Spirituellen Franziskaner und stifteten ganz große Verwirrungen an. Die Visionen der beiden Männer hatten überdies einen geradezu apokalyptischen Charakter. Die Analogien zwischen den Plänen und Schaubilder zwischen diesen beiden Utopisten waren aber nicht zufällig, denn ihr Sozialismus war eine Erscheinungsform des „Monastizismus“, der (gewaltsamen) Anwendung klösterlicher Ideale auf unschuldige Laien, die (späterhin in der Geschichte) das Pech hatten – wie in der Sowjetunion –, in einem atheistischen Zwangskloster leben zu müssen.
Joachim von Floris teilte, wie dann auch später Fourier, die Weltgeschichte in große Epochen ein. Zuerst kam das Zeitalter des Vaters, dann das des Sohnes (in dem Joachim lebte und predigte), das letzte aber war rein klösterlich, in dem es nur mehr Mönche und Nonnen gab, die das Jüngste Gericht erwarteten. Diese „gnostischen“ Ideen Joachims beeinflußten später Wyclif wie auch Roger Bacon.
Während aber Joachim von Floris in seinem Leben dank der schützenden Hand Friedrichs II., des stupor mundi, keine Schwierigkeiten hatte, stand es anders um Campanella, der jahrelang in Gefängnissen schmachtete. In seinem „Sonnenstaat“ gab es einen Monarchen mit einer elitären Führergruppe, aber weder Privatbesitz noch die Dauerehe. Unfruchtbare Frauen wurden automatisch öffentliche Dirnen, Schwangere konnten Geschlechtsverkehr mit jedermann haben, der Inzest war erlaubt, außer zwischen Müttern und Söhnen, doch Frauen, die sich schminkten, Schuhe mit hohen Stöckeln oder lange Röcke trugen, um ihre häßlichen Beine zu verbergen, wurden als „Lügnerinnen“ hingerichtet. Campanella entkam aber aus dem Gefängnis in Neapel, floh nach Paris, wurde von Richelieu als esprit fort geschützt und starb recht symbolisch im Kloster St. Jakob in Paris, von dem die Jakobiner später ihren Namen ableiteten. Doch der „Monastizismus“ mußte früher oder später seinen religiösen Charakter ablegen, um im echten Sozialismus zu entarten. Auch der jüngere William Morris (1834–1896) mußte mit seinen klösterlichen Tendenzen brechen, um seinen romantischen Sozialismus völlig entwickeln zu können.
Völlig irreligiös war Morelly, von dem wir persönlich so gut wie nichts wissen. Er war sicherlich ein Franzose und veröffentlichte seinen Code de la Nature 1755 in Amsterdam. Dieser wurde immer wieder neu aufgelegt, in unserer Zeit erst wieder von einem kommunistischen Verlag in Paris.10) Der Einfluß dieses Mannes auf den Kommunismus-Sozialismus kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. (Auch Alexis de Tocqueville beschäftigte sich mit diesem Buch in seinem L’Ancien Régime.11)) Ursprünglich dachte man, daß Diderot der wahre Autor dieser Schrift sei, aber diese Annahme erwies sich schon 1820 als falsch. 1846 erschien das Buch in einer deutschen Übersetzung in Berlin. V. P. Wolgin, ein sowjetischer Politologe, nannte im Vorwort der Pariser Ausgabe im Jahre 1953 Morelly einen „reinen Interpreten des Sozialismus“. Dieses Urteil kann man ohne Zaudern unterschreiben.
Der wichtigste Teil dieses kleinen Werkes ist der vierte, in dem für den idealen Staat ein „Modell der Gesetzgebung im Einklang mit der Natur“ beschrieben wird. Das Gesetz No. I,2 besagt, daß „jeder Bürger auf öffentliche Kosten ernährt, behaust und angestellt wird“. Keine Waren dürften getauscht, gekauft oder verkauft werden (II, 6). Es sollte kleine Gefängnisse und größere Zuchthäuser geben. In letzteren, inmitten von Friedhöfen, sollten hinter dicken Mauern und eisernen Gittern all jene Schwerverbrecher lebenslänglich eingesperrt werden, die das heilige Gesetz der Besitzlosigkeit zu durchbrechen suchten. Sie sollten „den bürgerlichen Tod sterben“ (III, 2). Die Größe der Städte und der Häuser sollte überall ungefähr die gleiche sein (IV, 2 und 3). Jederman sollte zwei Uniformen besitzen: eine für die Arbeit und die andere für die Feiertage. Eitelkeit müsse unterdrückt werden. Die Gesetze dürften nicht geändert werden. Alle Kinder müßten dieselbe Schulung bekommen. (Einheitsschule; Gesamtschule!) Die schwersten Strafen aber erwarteten alle jene, die metaphysische Lehren vortrugen oder der Gottheit menschliche Charakteristiken geben wollten (X, 3). Die Lehrfreiheit dürfe es nur für die Naturwissenschaften geben, nicht aber für die Geisteswissenschaften (XI, 5). Der Privatbesitz wird restlos abgeschafft, die Ehe obligatorisch, aber der Ehebruch strengstens bestraft (XII, 3). Die Kinder würden den Eltern im 5. Lebensjahr weggenommen, aber gelegentliche Kontakte in der Schulzeit würden großzügig erlaubt (X, 4). So also sah die „Natur“ im Kopf des Monsieur Morelly aus, doch was die Kinder betrifft, so war diese Planung identisch mit jener des Marquis de Sade („die Kinder gehören alleinig dem Vaterland“), mit jener Chruschtschjóws und im Grunde auch der Nationalsozialisten. Die politische Struktur dieses netten Idealstaates beruhte auf Räten, also auf „Sowjets“.
Es besteht kein Zweifel, daß Babeuf das Werk Morellys kannte, aber auch Henri de Saint-Simon schöpfte aus dieser Quelle. Saint-Simon (aus dem Haus der Herzöge von Saint-Simon), unglücklich verheiratet, geschieden, plötzlich verarmt und dann von seinen ehemaligen Kammerdiener behaust und ernährt, wandte sich als erster der neuen Arbeiterklasse zu. Die Güte seines Dieners überzeugte ihn davon, daß die Unterschichten ein besseres Herz hätten als die Bourgeois oder die Aristokraten. Er veröffentlichte recht naiv eine Zeitschrift, die an Industrielle adressiert war, und wandte sich auch an Ludwig XVIII. Zweifellos war dieser Mann, der eine kurze Zeit hindurch Auguste Comte, den Schöpfer des Positivismus als Sekretär angestellt hatte, ein waschechter Idealist. In seinem Nouveau Christianisme schlug er die Schaffung einer sozialromantischen Religion mit einer weltumspannenden Hierarchie vor, die ein Evangelium der brüderlichen Liebe verkünden sollte.
Einer seiner Jünger, Barthélémy Prosper Enfantin, war zusammen mit Armand Bazard ein Begründer des „reformierten Saint-Simonismus“. Später ernannte er sich selbst zum Père, zum Vater der „Saint-Simonistischen Kirche von morgen“. Schließlich predigte er auch die „totale Emanzipation des Fleisches“, mit anderen Worten: die volle Promiskuität. Da aber trennte sich Bazard von ihm. Enfantin, der wahrhaftig ein Infantilist war, errichtete dann in Menilmontant (Paris) ein „Kloster“ mit einem eigenartigen Habit, Weibergemeinschaft und gemeinsamer Arbeit, doch da mischte sich die Polizei ein, und die „Familie“, wie sie sich nannte, wurde zerschlagen.
Man muß aber auch andere Vorläufer des Sozialismus und Kommunismus erwähnen, und zwar noch aus dem 18. Jahrhundert, so zum Beispiel Jacques Pierre Brissot de Warville, einen Girondisten aus der Französischen Revolution, der überzeugt war, daß alle Leute ein gleiches Einkommen haben sollten, das nur die einfachsten Ausgaben deckt. Er ist einer der typischesten Vertreter des „demokratischen Sozialismus“. Auch der Abbé de Mably (1709–1785), mit wirklichem Namen Gabriel de Bonnot, der ein Bruder des Philosophen Étienne Bonnot de Condillac war, gehört hierher. Dieser Abbé wurde 1771 mit Rousseau nach Polen eingeladen, um dem Land eine neue Verfassung zu geben. In vielen Werken propagierte er eine „Sozialdemokratie“. Zwar war er nur ein Salonabbé ohne wahre Berufung, doch war er auch ein typischer Vorläufer unserer „Linkskatholiken“, die dem Edenismus huldigen, also dem Drang, ein irdisches Paradies zu entwerfen, in dem aber die Menschen Heilige oder Engel sein müßten. Hier sollte man sich an die warnenden Worte Pascals erinnern, daß der Mensch weder ein Engel noch eine Bestie sei, wer aber die Rolle des Engels zu spielen gedenkt, unausweichlich zur Bestie wird.12)
Der interessanteste dieser Träumer am Anfang des vorigen Jahrhunderts, der uns eine ebenso präzise wie auch restlos unverwirklichbare Utopie schenkte und somit den Irrealismus und Wahnsinn so richtig in den neueren Sozialismus einführte, war aber wohl François Charles Marie Fourier. Die Gesellschaft sollte nach seinem Plan in Phalanster eingeteilt werden, in denen sich viel Sex, wenig Arbeit und wenig Schlaf mit kolossal viel Romantik und spielerischer Zerstreuung abwechselten. Die Phalanster, klosterähnliche Gebäude, beherbergten an die 1600 Menschen, was an Morellys „Stämme“ erinnert. Alle Phalanster sollten wirtschaftlich unabhängig sein, jeder mit seinen Feldern und Arbeitsstätten. Doch in der Vision Fouriers feierte der paranoide Utopismus wahre Orgien. Da der Wahnsinn eine Synthese von eiskaltem Verstand und einer von aller Wirklichkeit losgelösten Phantasie ist, stehen wir bei Fourier dem Irrsinn in einer sehr reinen Form gegenüber. Überraschenderweise (oder eigentlich gar nicht so überraschend) war die Reaktion auf Fouriers Ideen doch recht beeindruckend und auch nachhaltig. Immer wieder wurden Anstrengungen gemacht, den Traum dieses Commis Voyageur zu verwirklichen. Russen passionierten sich dafür nicht weniger als Amerikaner.