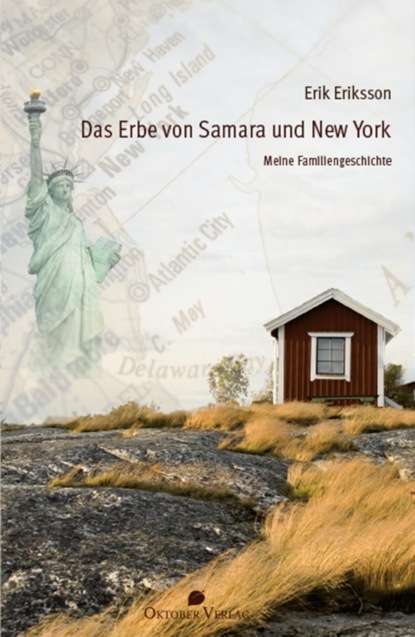- -
- 100%
- +
»In diesem Falle sollten die des Lesens Unkundigen auch das Recht haben, Schulen zu verlangen, in denen sie lesen lernen können.«
»Richtig, dieses Recht folgt daraus.«
»Also ist die Freiheit mehr wert als zersprengte Fesseln.«
»Sie reden ja wie ein Agitator, Hedvig.«
»Ich glaube, ich rede wie jeder, der nachgedacht hat.«
Der Professor widmete sich wieder seiner Zeitung oder dem Buch, das unter der Zeitung auf dem Schreibtisch lag. Hedvig trug den übervollen Aschenbecher hinaus.
Sie redeten meist englisch miteinander. Unvermutet konnte der Professor jedoch zum Französischen übergehen, um Hedvig zu prüfen. Ihr Französisch war schlechter als ihr Englisch, die Gespräche kamen ins Stocken, sie gingen wieder zum Englischen über.
Einmal machte Hedvig dasselbe. Sie wechselte mitten in einem Satz vom Englischen zum Schwedischen über.
Der Professor gab zu, dass Hedvig im Vorteil war, sie konnte drei Sprachen, er jedoch konnte nur zwei.
Er bat Hedvig um eine Einführung in die Grundzüge der schwedischen Sprache, kannte sie sich mit der Grammatik aus?
Nein, nicht sehr.
Er bestellte ein schwedisch-englisches Wörterbuch, gab Hedvig eine englische Grammatik. Sie lernte die Wortklassen und Satzteile, schlug im Wörterbuch nach, übersetzte Termini und Ausdrücke.
Sie erfanden eine Art Nonsenssprache, ein Dreisprachenspiel, hörten einander ab, wechselten die Sprache mitten in einem Satz, leierten Reihen von Reimen und Synonymen herunter.
Hedvig konnte mit einem Staubtuch durch das Zimmer gehen. Sie schlich auf Zehenspitzen, um den Professor, der mit einem Buch dort saß, nicht zu stören. Da murmelte er plötzlich:
»Today is too late to remember september.«
Hedvig blieb stehen, überlegte einen Augenblick, ehe sie antwortete.
»I morgon är hösten och trösten din vän.«
Der Professor sprach weiter, ohne von seinem Buch aufzusehen:
»Le fleuve comme la vie, la sortie comme un cri.«
»Även fågeln är fri, drar forbi med sitt skri.«
»Årrdet blir vatten på bårrdet till natten.«
Hedvig lachte. Sie hatte schon versucht, die schwedischen Vokale des Professors zu berichtigen, sie klangen genauso falsch wie ihre französischen Vokale. Sie lachten übereinander.
Aber Hedvig merkte, wie leicht ihr die Wörter fielen. Sie flogen ihr einfach zu, Wörter, Reime und Verse. Es war mit den Wörtern wie mit den Bildern, wenn sie kurz vor dem Einschlafen war. Sie brauchte nicht nachzudenken.
Karl Gustaf schrieb selten. Hedvig glaubte, dass es daran lag, dass er nicht gerne schrieb, im Gegensatz zu ihr, die bei jeder Gelegenheit gerne etwas zu Papier brachte.
Karl Gustaf hatte Amerika ein einziges Mal erwähnt. Er hatte sich den Gedanken, zu fahren, nicht aus dem Kopf geschlagen, aber es war ganz deutlich zu merken, dass er es nicht eilig hatte.
Hedvig hatte sich vorgenommen, nicht zu drängen. Sie hatte aufgehört, nach seinen Reiseplänen zu fragen, stattdessen berichtete sie, wie gut sie es hatte, wie hervorragend alles für sie gelaufen war. Das, was sie schrieb, war ja die Wahrheit. So gut wie bei der Familie Lorraine war es ihr noch nie in ihrem Leben ergangen.
Im Sommer 1895 war sie zwanzig Jahre alt geworden. Sie dachte so langsam daran, sich eine andere Arbeit zu suchen. Jetzt konnte sie die Sprachen, und sie schrieb auch mühelos. Sie müsste jetzt eigentlich eine Stelle in einem Büro finden können.
Im August schrieb Carl aus Boston. Er wollte sich verändern. Ein Freund in dem Büro der Schuhfabrik hatte eine Schwester, die bei einer Familie in New York angestellt war. Die Hausfrau suchte einen Gehilfen, der in der Schreibarbeit bewandert war. Sie bevorzugte Schweden, da sie schon einige tüchtige junge Leute aus Schweden in ihrem Haushalt beschäftigt hatte. Carl war von der Schwester seines Freundes empfohlen worden. Er konnte diese Arbeit bekommen.
Im September sollte er dort antreten. Jetzt war er dabei zu packen. In seinem Brief gab er die neue Adresse an: Die Straße hieß 5th Avenue. Hedvig fragte Professor Lorraine. Er erklärte ihr, dass das die Gegend war, in der die feinen New Yorker wohnten, in der Nähe des Central Parks.
»Wollen Sie dort hinziehen, Hedvig?«
»Ja, nicht direkt, aber ich denke so langsam daran, mich um eine Stelle in einem Büro zu bewerben.«
»Ich kann das verstehen. Sie wollen im Leben weiterkommen.«
»Ja, das ist so, aber besser als ich es hier gehabt habe, werde ich es niemals wieder treffen, das möchte ich Ihnen doch sagen.«
»Es ist ein besonderes Erlebnis gewesen, Sie im Hause gehabt zu haben, Hedvig, aber es gibt auch da draußen eine Welt, und die gehört Ihnen.«
Sie blieb noch zwei Monate dort. Dann kam wieder ein Brief von Carl. Hedvig könne vorübergehend eine Arbeit bei der Familie in New York erhalten. Sie hießen Graham, die Hausfrau brauchte ein Serviermädchen.
Carl schlug vor, dass Hedvig kommen solle. Sie könne sich in der Zeit, in der sie für Mrs. Graham arbeite, nach einer Büroarbeit umsehen.
Hedvig entschloss sich. In der letzten Novemberwoche verließ sie den Professor und die wunderbare Bibliothek in Montreal. Es war kalt geworden, aber Hedvig reiste in wärmere Gefilde.
Silvester 1895 servierte Hedvig Likör in der Bibliothek der Familie Graham. Es gab weniger Bücher als in Montreal, aber mehr Goldschnitte. An den Fenstern hingen schwere Samtvorhänge. Draußen lag der große Central Park mit seinen kleinen Seen und Hügeln und den gewundenen Spazierwegen.
Spät in der Neujahrsnacht glitzerten die Lichter zwischen den eisbedeckten Fichten des Parks.
Hedvig trank in der Küche zusammen mit den anderen Bediensteten ein Glas Wein. Die Familie Graham hatte sieben Angestellte. Hedvig war die Jüngste. An diesem Abend trug sie ein schwarzes Kleid und eine weiße Schürze. Auf dem Kopf hatte sie ein kunstvoll geklöppeltes Spitzenhäubchen.
Zurück über das Meer
Sie liefen Schlittschuh auf einem der kleinen Seen im Central Park. Hedvig ging an den Sonntagen zusammen mit Mrs. Grahams beiden jüngsten Kindern, der sechsjährigen Charlotta und der neunjährigen Jane, dorthin. Die Kinder hatten einen Schlittschuhlehrer, Peter Shildtman; er bot Hedvig an, ihr kostenlos Schlittschuhe zu leihen und mit ihr zu üben. Peter war der Sohn eines eingewanderten Österreichers. Er fuhr mit Hedvig auf der Eisbahn herum, hielt dabei ihre Hand. Das war erlaubt, sie brauchte eine Stütze. Die andere Hand hatte Peter um Hedvigs Taille gelegt. Sie fand, dass das unnötig sei. Aber sie lernte Schlittschuhlaufen; sie vermied möglichst Peters Hilfe, lief lieber mit den Mädchen. Sie waren alle drei Anfänger, machten dieselben Fehler und freuten sich über dieselben Fortschritte. Carl jedoch zog es vor, die paar Male, die ihm seine Arbeit erlaubte mitzukommen, nur zuzuschauen.
Carl war zweiter Butler, er servierte manchmal, wenn die Familie keine Gäste hatte, aber meist reinigte er Abflussrohre, holte Kohle aus dem Keller, putzte die schwer erreichbaren Scheiben oben in den zum Park hinausgehenden großen Panoramafenstern. Carl war der Mann für alles, er war erfinderisch und schnell, wartete nicht erst auf Anweisungen, sondern ergriff selbst die Initiative. Mrs. Graham erkannte schnell, dass Carl tüchtig war. Sie erhöhte seinen Lohn auf sieben Dollar die Woche. Dazu hatte er Wohnung und Essen. Carl sparte, er hatte ein Bankkonto eröffnet.
Auch Hedvig hatte ein wenig Geld gespart. Sie verdiente die erste Zeit über nur drei Dollar in der Woche, aber sie hatte einen freien Tag und freie Abende. Nach einiger Zeit bot ihr Mrs. Graham sechs Dollar an, wenn sie eine Vollzeitbeschäftigung akzeptieren würde. Das bedeutete allerdings Arbeit bis abends spät. Dann sollte Hedvig auch mit den kleinen Mädchen Schulaufgaben machen, mit ihnen spazieren gehen, ihre nächste Vertraute sein, wenn Mrs. Graham nicht zuhause war, was mehrmals im Monat vorkam. Sie begleitete ihren Mann gelegentlich auf seinen Geschäftsreisen. Mr. Graham besaß große Aktienanteile an Banken und Schiffswerften. Er saß in Vorständen, er reiste zu Sitzungen nach Boston und nach Washington, manchmal auch nach Chicago und Detroit. Mrs. Graham fuhr mit. Es war nicht unbedingt üblich, dass Frauen ihre Männer begleiteten. Es kam vor, dass jemand sie für die Sekretärin des Bankiers hielt. Sie war zweiunddreißig Jahre alt, rothaarig, sehr schön. Sie war Sekretärin gewesen, als sie Mr. William Graham kennengelernt hatte.
Hedvig hatte keine Zeit mehr für die Bücher, die sie gerne gelesen hätte. Stattdessen lernte sie alles über die Geschichte und Geographie Amerikas, über Algebra und Gleichungen. Sie wurde die Nachhilfelehrerin der Kinder.
Die Familie Graham besaß eine Sommervilla auf Long Island, nahe am Meer bei Westhampton Beach. Auch der lange Strand unterhalb der weißen Villa gehörte zu dem Besitz. Dort befand sich ein Bootshaus mit einer Brücke, die gut fünfzig Meter in das flache Wasser hineinragte.
Im Sommer 1896 verbrachte Hedvig zusammen mit Mrs. Graham und den Mädchen einen Monat in der Villa Doonbeg, die nach dem irischen Geburtsort von Mrs. Grahams Mutter benannt worden war. Hedvig hatte noch nie einen so schönen Strand gesehen, weißen Sand, flaches Wasser, Sonnenstühle und milden Sonnenschein. Die Mädchen zeigten ihr, wie man Sandburgen baute. Sie fertigten kleine amerikanische Fähnchen an, die sie auf die Türme der Burgen steckten. Hedvig bastelte eine schwedische Fahne. Sie konnte nicht richtig erklären, warum sich dieses vielfarbige Viereck in der oberen Ecke der Fahne befinden sollte.
»Das ist wie bei euren Sternen, wir haben auch eine Union, obwohl wir nur zwei Mitglieder sind.«
»Ihr könntet ja dann wohl auch zwei Sterne haben«, fand Charlotta.
Sie spielte an diesem Tag unten an der Wasserkante. Jane konnte schon schwimmen, sie war ein Stück hinausgewatet, jetzt machte sie einige Schwimmzüge, dort, wo die Wellen anschlugen.
Aber es war ein ruhiger Tag, die Wellen waren klein, es bestand keine Gefahr, Jane konnte im Wasser bleiben, wenn Hedvig sie im Auge behielt.
Das kleinere Mädchen, Charlotta, begann zu frieren. Hedvig holte ein Frottierhandtuch, trocknete sie ab, kniete sich in den Sand und wickelte das Mädchen in das große Handtuch.
Da hörte sie Mrs. Graham rufen, sie war zu den Bäumen oben vor dem Haus gegangen, jetzt kam sie zurück, sie lief.
»Wo ist Jane?«, rief sie.
Hedvig stand auf und blickte auf das Wasser hinaus. Jane war nicht zu sehen.
Charlotta rief den Namen ihrer Schwester. Hedvig lief ein paar Meter ins Wasser hinein, hob mit einer Hand den Rock hoch, ging noch ein bisschen weiter hinein und merkte, dass sie bis an die Oberschenkel nass wurde. Sie blieb stehen und rief wieder und wieder Janes Namen. Da erblickte sie das Mädchen etwas weiter draußen. Sie schwamm nicht, ihr Haar lag auf dem Wasser, einer der Arme bewegte sich etwas.
Hedvig lief zu Jane hin. Das Wasser reichte ihr jetzt bis zur Taille, eine Welle schlug ihr ins Gesicht, sie verlor den Halt, fiel zur Seite, fühlte jedoch den sandigen Boden, fand ihr Gleichgewicht wieder, ging weiter auf Jane zu.
Jetzt hatte sie sie fast erreicht, sie konnte den Arm des Mädchens packen. Hedvig wandte sich um, zog Jane mit sich, fiel wieder hin, bekam Wasser in den Mund, ließ jedoch nicht los.
Auch Mrs. Graham war ins Wasser gelaufen. Sie erreichte Hedvig und ergriff Janes andere Hand. Gemeinsam zogen sie das Mädchen an Land.
Hedvig hustete, kniete neben Jane nieder, die bewegungslos auf dem Boden lag. Da hob das Mädchen langsam eine Hand gegen das Gesicht, begann ebenfalls zu husten. Die Mutter hob den Kopf des Mädchens leicht an, strich ihr das nasse Haar aus der Stirn.
Jane hustete das Wasser aus, der Schleim rann ihr aus dem Mund. Die Hustenanfälle wurden schwächer, sie begann zu weinen; ihre kleine Schwester, die daneben gestanden hatte, kam näher und umarmte sie, begann ebenfalls zu weinen, die Mutter wiederholte immer wieder den Namen ihrer Tochter.
Hedvig hatte sich etwas abseits hingesetzt. Sie war immer noch außer Atem, das Wasser tropfte ihr aus den Haaren. Sie fühlte sich steif und kalt, jedoch kam das nicht von den nassen Kleidern, sondern von der schrecklichen, eiskalten Einsicht: Es war ihre Schuld. Jane war fast ertrunken, sie hatte nicht auf sie aufgepasst. Das Mädchen hätte jetzt tot sein können.
Vom Land her wehte ein schwacher Wind, eine leichte warme Brise. Im Westen über dem Festland hatten sich weiße Wolken aufgetürmt. Es war einer der schönsten Tage des Sommers. Aber der Hauch des Todes hatte Hedvig gestreift.
Da erhob sich Mrs. Graham. Sie ging zu Hedvig hinüber, kniete sich neben sie, ergriff ihre Hand.
»Danke, liebe Hedvig«, sagte sie mit schwacher Stimme. Hedvig verstand nicht. Sie hob den Blick nicht vom Boden auf, wollte Mrs. Graham nicht ansehen.
»Du hast meine Tochter gerettet«, sagte Mrs. Graham.
Hedvig begriff nicht, sie sah immer noch weg. Jetzt kam auch Charlotta zu ihr hin und legte ihr die Hand auf die Schulter.
Da hob Hedvig den Kopf und sah das kleine Mädchen an, das sie ängstlich anlächelte.
In diesem Herbst erhielt Hedvig vier freie Tage. Mrs. Graham fand, dass sie Zeit für Einkäufe brauchte, wie sie sagte. Sie schenkte Hedvig zehn Dollar.
Hedvig sparte dieses Geld. Sie hatte Carl das Darlehen schon zurückgezahlt, die hundert Dollar, die er ihr für die Fahrkarte geliehen hatte. Sie hatte das Geld in mehreren Raten zurückgezahlt. Jetzt hatte sie wieder etwas gespart. Zusammen mit den zehn Dollars verfügte sie im November über insgesamt sechzig Dollar.
Im Frühjahr darauf hatte sie schon fünfundachtzig Dollar auf der Bank. Sie hatte sich nach dem Zinssatz erkundigt und hatte die Central National Bank gewählt. Nicht weil Mr. Graham im Vorstand saß, sondern weil sie dort die besten Zinsen bekam.
Die Idee, Büroangestellte zu werden, hatte Hedvig aufgegeben. Vielleicht hätte sie es in einer kleineren Stadt schaffen können, aber in New York waren die Anforderungen hoch und die Konkurrenz groß. Vielleicht könnte sie studieren, ihre Sprach- und Geschichtskenntnisse verbessern, mit der Zeit Lehrerin werden.
Ab und an dachte sie auch an eigene Kinder. Vielleicht lag das an dem täglichen Umgang mit den Graham-Mädchen, der diese Sehnsucht in ihr weckte; sie ertappte sich dabei, wie sie Pläne machte für die Einrichtung eines eigenen Heims mit Karl Gustaf. Ja, natürlich, einen anderen gab es nicht.
In diesem Herbst hatte Hedvig mehrere Briefe geschrieben, und jetzt hatte sie wieder angefangen, ihn zu fragen. Hatte er sich endlich entschlossen zu kommen? Konnte er schon einen Termin nennen? Vielleicht nicht den Tag oder den Monat, aber würde er nächstes Jahr herüberkommen?
Karl Gustaf hatte ausweichend geantwortet. Er freute sich darauf, einen eigenen Hausstand zu gründen, aber er vermied es die ganze Zeit, Amerika zu erwähnen.
Im Januar 1898 schrieb Hedvig, dass sie jetzt endgültig Bescheid haben wollte. Sie waren ja verlobt, oder? Sie drückte die Feder etwas stärker auf das Papier, als sie das Wort schrieb. Sie schrieb nicht, dass das eine gemeinsame Familie bedeute, sie hatte vorgehabt, es zu schreiben, es aber dann doch gelassen. Er verstand wohl auch so, was sie meinte.
Das Frühjahr verging. Hedvigs Sparkonto wuchs. Sie hatte noch einmal zehn Dollar von Mrs. Graham geschenkt bekommen; auch die wanderten ohne Abzug auf das Sparbuch.
Als Hedvig im Sommer dreiundzwanzig Jahre alt wurde, erhielt sie von Mrs. Graham noch ein Geschenk. Sie bekam ein schönes Fotoalbum. Die freundliche Spenderin hatte außerdem einen Fototermin im New Manhattan Studio an der Park Avenue bestellt.
Hedvig wurde fotografiert. Sie ließ den Fotografen auch ein Bild von sich und Carl machen. Sie trugen ihre Arbeitsuniformen, Carl stand, Hedvig saß, mit der Hand auf einen kleinen Tisch gestützt, auf den der Fotograf eine Vase mit einer Nelke gestellt hatte.
Von dem Portrait wurden zwei Abzüge geliefert. Einen davon schickte Hedvig an Karl Gustaf.
Es dauerte zwei Monate, bis Hedvig eine Antwort von Karl Gustaf erhielt. Er schrieb freundlich, sogar liebevoll. Aber er konnte sich immer noch nicht zu der Reise entschließen. Er hatte seine Lehrlingszeit beendet, hatte eine Anstellung, es ging ihm zuhause ganz gut.
Da begriff Hedvig, dass er nicht zu ihr kommen würde. Sie vermisste Karl Gustaf. Es hatte Zeiten gegeben, in denen sie nicht so viel an ihn gedacht hatte. In Montreal war das so gewesen. Aber jetzt wuchs ihre Sehnsucht.
Anfang Februar entschloss sie sich. Sie erzählte Mrs. Graham, dass derjenige, den sie lieb hatte, in Schweden wartete. Mrs. Graham verstand, sie wusste, dass die Liebe vorgehen musste.
Am 8. April verließ Hedvig New York. Das große Schiff war weit davon entfernt, überfüllt zu sein, als es nach Osten über den Atlantik steuerte. Hedvig war fast sechs Jahre von zuhause weg gewesen.
Alvine und Oscar, die Eltern meiner Mutter
Alles wurde in Stücke geschlagen
Der polnische Leutnant
In dem Jahr, als Magda fünf Jahre alt wurde, heiratete Erika. Sie war sechzehn Jahre alt, sechs Monate zuvor hatte sie Jurij Spilewski kennengelernt. Erika wurde schwanger; als sich das nicht länger verbergen ließ, gab Oscar sehr widerwillig seine Zustimmung zu der Hochzeit. Die Alternative wäre eine große Schande gewesen, eine unverheiratete minderjährige Tochter mit Kind in der Familie, dann lieber die Hochzeit.
Oscar hatte schon, ehe Alvine etwas gemerkt hatte, den Verdacht geschöpft, dass Erika ein Kind erwartete. Er traf seine Töchter nicht häufiger, als ihre Mutter es tat; er verfügte jedoch über eine bessere Intuition, vielleicht hatte er auch verstohlene Blicke auf die Tochter geworfen und gesehen, dass sich ihre Figur verändert hatte.
Er tobte vor Wut, drohte, Erika hinauszuwerfen, hob die Hand, hielt sich jedoch zurück. Ein Kind hatte er schlagen können, das war hin und wieder vorgekommen, aber jetzt war die Tochter eine junge Frau. Oscar schlug Erika nicht ins Gesicht. Sie hatte sich auf seine Ohrfeige gefasst gemacht, sie war am Tisch sitzen geblieben, hatte den Kopf nicht eingezogen, sie hatte noch nicht einmal die Augen geschlossen.
Er schämte sich etwas. Es war sein Recht, die Kinder und die Dienstboten zurechtzuweisen, ja seine Pflicht. Es lag ihm jedoch daran, sich Damen gegenüber wie ein Gentleman zu benehmen. Also hielt Oscar Peterson an diesem Sonntag, an dem er Erika gefragt und die Antwort erhalten hatte – »Ja, Papa, ich erwarte Jurijs Kind« – seinen Schlag zurück.
Als sich Oscars Empörung gelegt hatte, fragte er, wann mit der Geburt zu rechnen sei, oder wusste Erika es nicht? Er deutete also an, dass sie vielleicht nicht wusste, wer der Vater war, dass sie ein loses Frauenzimmer sei.
Erika tat so, als ob sie es nicht gehört hätte, und antwortete, dass das Kind zum Herbst hin erwartet würde.
Erika gebar einen Jungen. Er wurde Vladimir genannt.
Jurij Spilewski kam aus Minsk in Weißrussland. Seine Familie stammte ursprünglich aus Polen, aber Ende des 18. Jahrhunderts hatte sie in Gegenden gewohnt, die von Russland besetzt worden waren. Jurij war nach seiner Wehrdienstzeit zwei Jahre auf eine Kriegsschule gegangen und Leutnant in einer Nachschubtruppe in der Armee des Zaren geworden. Er hätte vielleicht Karriere machen können, aber seine polnische Herkunft hatte sich als Hindernis erwiesen. Jurij hatte seinen Abschied genommen, als er begriffen hatte, dass sein Regiment gegen revoltierende polnische Nationalisten eingesetzt werden sollte. Er selbst war ja in seinem tiefsten Inneren einer von ihnen.
Er war nach seiner Soldatenzeit nach Samara gekommen und hatte dort ein Jahr als Lehrer gearbeitet. Dann hatte er eine Anstellung bei der Bahn erhalten. Als er Erika kennenlernte, war er achtundzwanzig Jahre alt. Sie war gerade sechzehn geworden.
Oscar hatte keine Ahnung von Jurijs polnisch-nationalistischer Gesinnung. Ihm imponierte der Offiziersrang. Oscar wollte gerne einen Offizier des Zaren in seiner Familie haben. Noch weniger ahnte er die aufkeimende Sympathie, die sein Schwiegersohn für die revolutionäre sozialdemokratische Partei hegte. Jurij hoffte, dass sein geliebtes Polen von einer sozialistischen Entwicklung in Russland profitieren würde. Er sollte Recht bekommen, das jedoch konnte er noch nicht wissen, als er Erika im Frühsommer 1916 heiratete.
Der erste Weltkrieg tobte. Russland nahm an dem großen Kampf gegen Deutschland teil. Jurijs junge Frau las keine Zeitungen, aber sie kam nicht umhin, all die Gerüchte zu hören. Die Züge mit den Truppen rollten durch Samara, verwundete Soldaten kehrten von der Front zurück. Die Armee des Zaren, die große Verluste erlitten hatte, brauchte Leute, der Feind rückte gegen Litauen und Weißrussland vor.
Jurij wurde eingezogen, aber er brauchte nicht an die Front zu gehen. Er war ja Offizier der Reserve; er war darin ausgebildet, die militärischen Nachschubtransporte zu organisieren. Er wurde in Samara, das zu einem wichtigen Knotenpunkt im Transportnetz der Armee geworden war, gebraucht.
Jurij und Erika waren zusammengezogen. Sie hatten ein Zimmer in der braunen Villa der Familie Peterson bekommen. Es wurde eng, aber es musste in Erwartung besserer Zeiten genügen. Wenn der Krieg erst vorbei war, würde sich alles zum Besten wenden.
Die frisch Verheirateten schliefen in einem großen Bett. Neben ihnen stand das Gitterbettchen des kleinen Jungen. Auch Magda schlief in diesem Zimmer – in den ersten Monaten nicht so häufig, dann jedoch wurde es zur Gewohnheit. Erika war schon immer wie eine Art Mutter für Magda gewesen, hatte sich um sie gekümmert, hatte sie getröstet, hatte mit ihr gelacht. Das blieb auch so, als sie ein eigenes Kind bekommen hatte.
Zweimal am Tag besuchte Magda zusammen mit ihren beiden größeren Schwestern Irma und Dagmar ihre Mutter Alvine. Das war eine alte Routine, nichts hatte sich verändert. Für Magda jedoch bedeutete Alvine immer weniger. Es war Erika, die ihr wirklich nahestand.
Magda hörte gelegentlich, wie Erika und Jurij über die Zukunft sprachen, über das Haus, das sie gerne kaufen würden, wenn die Zeiten besser geworden waren. Magda dachte nie darüber nach, was mit ihr selbst passieren würde, wenn dieser Tag kam. Sich von Erika trennen zu müssen, war ein unmöglicher Gedanke.
Sie suchte eine Hand im Schlaf
Das Wasser der Wolga war gefroren, die Schiffe drängten sich am Kai zusammen, eisbedeckt und schäbig. Von einigen kleinen Dampfern stieg Rauch auf. An Bord wohnten Menschen; sie versuchten, dort zu überleben, dort unten unter den schneebedeckten Decks, saßen sie dicht gedrängt an den Kachelöfen und warteten auf den Frühling.
Bis dahin jedoch war es noch eine lange Zeit. Der Winter war hart, viele Menschen in Samara hatten nichts zu essen. Läden hatten zugemacht, die Regale waren leer, die Getreidelager der großen Güter wurden immer wieder von hungernden Landarbeitern geplündert.
Und der Krieg gegen Deutschland ging weiter. Er zehrte an den Kräften; für die Armeen des Zaren stand es nicht gut, die Verluste machten sich jetzt auch in der Heimat bemerkbar. Immer mehr Leute kannten jemanden, der einen Sohn oder einen Bruder verloren hatte.
Stille Nachmittage, glitzernde Schneekristalle auf den Hausdächern in Samara. Wenn jedoch die Dunkelheit hereinbrach, konnte man die Flammen sehen, die aus den brennenden Scheunen und Höfen entlang des Flusses schlugen. Der Rauch trieb über die Stadt hinweg. Und es war nicht der große Krieg, der bis an die Wolga gekommen war, es waren die immer härter werdenden Machtkämpfe, die die Russen untereinander austrugen.
Magda war in die Schule gekommen. Sie wurde jeden Tag in eines der Klassenzimmer in Koljas Haus gebracht, das in dem wohlhabenden Viertel hinter der Alexanderstraße lag. Es gab jetzt dort zwei Klassen in der Privatschule der Familie, eine für die Kinder über acht Jahre, und eine für die allerkleinsten in Magdas Alter.
Wenn Magda in die Schule gebracht wurde, befanden sich ihre beiden großen Schwestern Dagmar und Irma mit im Wagen; wenn Magda ausgestiegen war, fuhren die beiden weiter in die Mädchenschule hinter der lutherischen Kirche. Dem Kutscher war strengstens befohlen worden, die Mädchen unterwegs nicht aussteigen zu lassen. Aber Dagmar stahl zuhause Zigaretten, bestach den Kutscher und veranlasste ihn, gelegentlich kleine Pausen einzulegen. Die Mädchen stiegen aus, betrachteten die Schaufenster, kauften Schokolade, wenn sie Geld hatten.