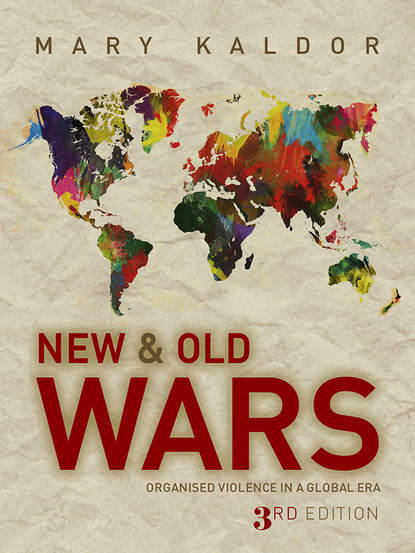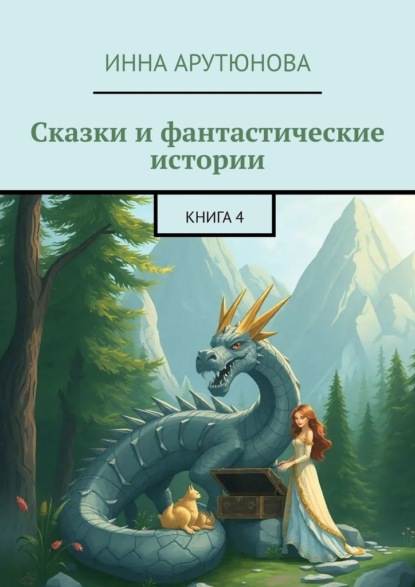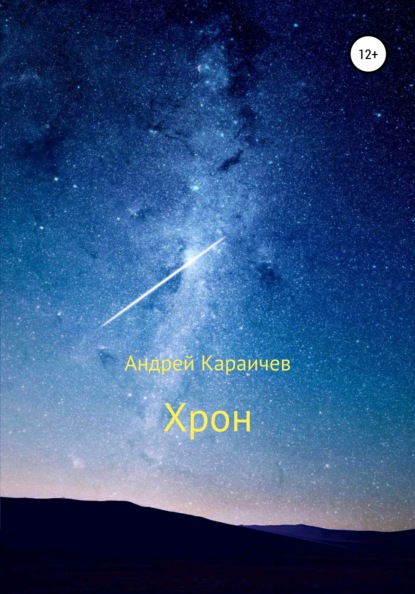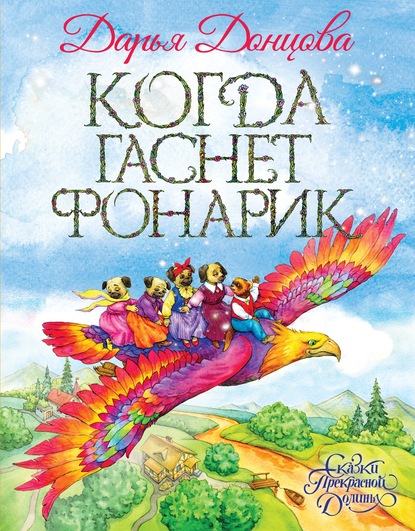- -
- 100%
- +
Die Wahl des Körpers als Bild, das die unsichtbare GanzheitGanzheit sichtbar macht, ist keineswegs beliebig, da „der menschliche Körper selbst gleichsam das ursprüngliche Vorbild auch noch des abstraktesten logischen Begriffs der Ganzheit“ (Koschorke et al. 60) ist. Gemeint ist damit keine natürlich gegebene Verbindung zwischen Körper und Ganzheit, sondern eine lange Denktradition, die beide in Beziehung zueinander setzt.
Doch mit der Darstellung der GanzheitGanzheit des Staates als Körper wird nicht nur die Vorstellung von Ganzheit selbst, die der Körper traditionell transportiert, auf den Staat übertragen: die Darstellung vollzieht parallel weitere Übertragungen von Elementen und Eigenschaften, die, gewissermaßen als „Cargo“ (Mahr 162),3 auf den Staat transferiert werden:
[S]o leistet die Metapher des sozialen Körpers die Übertragung eben jener vom menschlichen Körper abgezogenen Bestimmungen auf den Staat. Dazu gehören, neben Totalität (Vollständigkeit), Übersummativität (Kontinuität) und funktionaler Differenzierung vor allem auch Gegebenheit (Natürlichkeit), Unteilbarkeit und Fraglosigkeit der ‚Systemgrenzen‘, deren Vorstellungen dem Begriff des Staats auf metaphorischem Wege „unterlegt“ werden. (Koschorke et al. 60)
Der Vorgang ist der einer metaphorischen Übertragung (oder: Unterlegung) mit mehrfachem Cargo („Totalität“, „Übersummativität“, „funktionale Differenzierung“, „Gegebenheit“, „Unteilbarkeit“, „Fraglosigkeit der ‚Systemgrenzen‘“), die sich weiter genauer als HypotyposeHypotypose/Versinnlichung klassifizieren lässt. Hier wird also nicht etwa Achill zum Löwen, sondern einem Gegenstand, dem in der Realität ‚keine Anschauung korrespondieren kann‘ (und d.h. vor allem keine, die ihn in seiner Gänze zeigen kann), wird überhaupt erst eine Anschauung gegeben, er wird „in ein Bild [ge]kleidet“ (s.o.).4
Einer deutlich größeren GanzheitGanzheit – der ‚Welt‘ bzw. dem ‚Kosmos‘ – und ihrem Verhältnis zum (bzw. ihrer Darstellung durch den) Körper nimmt sich die mittelalterliche Konzeption des MakrokosmosMikrokosmos/Makrokosmos/Mikrokosmos an. Die Beziehung zwischen Ganzheit und Körper gestaltet sich dabei wie folgt:
Der MikrokosmosMikrokosmos/Makrokosmos ist nicht nur ein kleiner Teil des Ganzen, nicht ein Element des Weltalls, sondern gleichsam seine verkleinerte und es nachbildende Replik. Nach der Idee, die von Theologen und Dichtern geäußert wurde, ist der Mikrokosmos ganzheitlich und in sich vollendet wie auch die große Welt. Man stellte sich den Mikrokosmos in Form eines Menschen vor, der nur im Rahmen des Parallelismus ‚kleines‘ und ‚großes‘ Weltall verstanden werden kann. (Gurjewitsch 65)
Es handelt sich also um eine Parallelisierung, welche auf der „völligen Analogie zwischen Weltall-Makrokomos und Mensch-MikrokosmosMikrokosmos/Makrokosmos“ (400) beruht, die sich detailliert ausbuchstabieren lässt: „Jeder Teil des menschlichen Körpers entspricht einem Teil des Weltalls: der Kopf dem Himmel, die Brust der Luft, der Bauch dem MeerMeer, die Beine der Erde, die Knochen den Steinen, die Adern den Zweigen, die Haare dem Gras und die Gefühle den Tieren.“ (65) Wie man an dieser Aufreihung erkennen kann, handelt es sich um einen hochgradig konventionalisierten Analogieschluss, dessen einzelne Bestandteile ohne Vorwissen nicht zwingend einleuchten. Die Vorstellung vom Makrokosmos/Mikrokosmos, die „im mittelalterlichen Europa, insbesondere seit dem 12. Jahrhundert“ (65) äußerst populär ist,5 zeitigt zahlreiche bildliche Darstellungen, die menschliche Körper mit dem Kosmos im Wechselverhältnis zeigen (vgl. Gurjewitsch 67f.) und beruht des Weiteren auf der zeittypischen Vorstellung, dass die GanzheitGanzheit dualistischen Charakters ist.Mikrokosmos/Makrokosmos6 Der Körper ist also auch jenseits der StaatskörperStaatskörper (body politic)-Metapher im europäisch-christlichen Denken seit Langem mit Ganzheit assoziiert, d.h., dass der Körper somit schon seit geraumer Zeit und in verschiedenen Varianten in ein überraschendes Näheverhältnis zu kleineren und größeren Ganzheiten gerückt wird.7
In Fragen der Darstellung von GanzheitGanzheit verdient das Konzept der HypotyposeHypotypose besondere Aufmerksamkeit, denn die Darstellung der Ganzheit des Staates als Körper (bzw. die breite und aufschlussreiche Forschung zu dieser Thematik) kann die Perspektive auf die Darstellung von größeren Ganzheiten informieren. Der StaatskörperStaatskörper (body politic) kann so als Modell dienen, zu dem sich Relationen zwischen Körpern und größeren Ganzheiten in ein Verhältnis setzen lassen. Denn was für den Staat gilt, trifft auch auf größere Ganzheiten zu: „Das Ganze der Welt ist der Wahrnehmung nicht zugänglich“ (Moser u. Simonis 12). Das Argument des Abstandes zwischen Ganzheit und Wahrnehmung kann so auf eine mögliche Brücke hin geöffnet werden: der Staatskörper, der auf dem allgemeinen hohen Potenzial des Körpers zur Darstellung von „bounded systems“ (Douglas 142) fußt.Mikrokosmos/Makrokosmos8
Um das allgemeine Darstellungspotenzial von Körpern im Kontext von GanzheitGanzheit weiter darzulegen, ist auf die Rolle des Körpers im kartografischen Kontext einzugehen, der untrennbar mit dem Themenfeld des Kolonialismus verknüpft ist. Das enge Verhältnis zwischen Körper und KartografieKartografie (vgl. III.2.3, III.4.4.4) wird angesichts folgender Beschreibung zunächst überraschend erscheinen: „Die Karte bringt zahlengenaue Maßverhältnisse ins Spiel, abstrahiert von der idiosynkratischen Perspektive einzelner Subjekte und von deren seelischer Tiefe“ (Stockhammer, Kartierung 8). Dennoch gibt das menschliche Herz frühen Weltkarten ihre Form (vgl. Ramachandran 33–39), bzw. werden in Darstellungen, die Karten begleiten und rahmen, gehäuft riesenhafte menschliche Körper platziert (Ramachandran 23, 51f.). Außerdem füllen und schmücken die Darstellungen von Tieren und Menschen Globen und Karten, und bewohnen dabei zumeist unbekannte oder entlegene Regionen der Erde. Abgebildeten Kannibalen und Monstern kommt hierbei gehäuft die Rolle zu, die Peripherie der (bekannten) Erde zu markieren; so schienen etwa „die amerikanischen Reiseberichte eine Bestätigung jener antiken Prognosen zu liefern, nach denen am Rande der Welt MonsterMonster, Fabel- und Zwitterwesen leben: Kannibalen, kopflose Wesen (Acephali), Satyre, Amazonen, Hermaphroditen, Monstergestalten“ (Manow 23; zu diesen Monstern vgl. auch Daston u. Park 205).9 „As writers struggled to represent the novelty of the American hemisphere for a European audience back home, monsters and marvels became coextensive with terra incognita in colonial representations.“ (Barrenechea 27)
Man denke weiter an den AtlasAtlas (Mythos)- bzw. Herkules-Mythos, in dessen bildlicher Darstellung ein riesenhafter Mann einen Globus schultert. Jörg Dünne hat mit Bezug auf frühneuzeitliche Beschreibungen darauf aufmerksam gemacht, dass die „Ansicht der Welt in einer zweidimensionalen Karte […] den Augen ein ähnliches Unwohlsein“ verursacht „wie das Gewicht der Erdkugel, die Herkules in dem Moment, als er sie Atlas abnimmt, auf seinen Schultern zu spüren bekommt“ (12), womit ein gleich doppelt körperliches Verhältnis zur Karte (im Erschrecken einerseits und dem Bild des Atlas/Herkules andererseits) in Szene gesetzt wird. Atlas gibt darüber hinaus einem kartografischen Genre seinen Namen, beginnend mit dem Atlas von Mercartor, womit ein signifikanter Übergang markiert wird:
From a literary historical perspective, the volume’s title [AtlasAtlas (Mythos); T.E.] is striking and strange. It introduces a new nomenclature for the map book, replacing conventional metaphors with the materiality of the human body. […]. The Atlas troubles the illusion of the map as a transparently mimetic object–a “mirror of the world”–by highlighting the function of the human mapmaker as a mediator; it is through his particular perspective and technical gaze that we see the world visualized on the page. (Ramachandran 27)
Weiter werden im Rahmen der Engführung von Körper und KartografieKartografie die Relationen zwischen anthropomorphen Körpern und der GanzheitGanzheit in außergewöhnliche Größenverhältnisse gesetzt, insofern der menschliche Körper die Erdkugel schultert, oder als Riese von kosmischen Ausmaßen den Erdglobus – gleichsam Erde und ihre Repräsentation – in den Händen hält, wie auf dem Titelkupfer des AtlasAtlas (Mythos) von Gerhard Mercartor (1595); „as an allegory of making it announces a bold argument: the mapmaker embodies the world. In material and metaphorical ways, the human body and the global body become one.“ (Ramachandran 22) Ayesha Ramachandran schreibt weiter:
Rhetorically, the materialities of geographic and bodily space become powerfully fused in the early modern period, paving the way for subsequent analogies between the human body and the great body of the world. (31)
Neben diesem Zusammenhang ist auch auf die Nähe zwischen KartografieKartografie und AnatomieAnatomie hinzuweisen, insofern beide wiederholt, so kontraintuitiv es erscheinen mag, als ähnlich beschrieben wurden (Ramachandran 29–32).
Weiter ist die Darstellung von Körpern in kolonialen Kontexten zu nennen – einmal im Rahmen der Diffamierung des Anderen (vgl. Manow 23–26) und einmal im Rahmen der Darstellung von zu kolonisierenden Regionen. Am bekanntesten ist hier mit Sicherheit die gegenderte Darstellung Amerikas als nackte, von Vespucci – seines Zeichens voll bekleidet und mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgerüstet – ‚entdeckte‘ Frau (im Bildhintergrund findet, um dem Betrachter jegliche weitere Orientierungsarbeit zu ersparen, ein kannibalisches Barbecue statt). Doch gibt es auch Darstellungen, die alle – nach jeweiligem Stand der KartografieKartografie bekannten – Erdteile, zuvorderst Europa und Amerika, als „Frauengestalten“ (Manow 57) darstellen; diese Bildtradition findet auch im Titelkupfer des De Cive von Thomas Hobbes Eingang (vgl. Manow 55–57). Dieses Ins-Verhältnis-Setzen von Körpern und größeren Ganzheiten – und das koloniale Begehren, das ihnen eingeschrieben ist – kann jedoch auch ganz andere Formen annehmen: „The form of the globe finds anthropomorphic expression in the human eye or the female breast […], generating a poetics of form that connects the microcosm of a gendered human body to the macrocosm of the planetary globe.“ (Cosgrove 7f.) Auf noch konkretere Verbindungen zwischen Hobbes LeviathanLeviathan (Text und Titelkupfer) und der Kolonialgeschichte, auf die Philip Manow hingewiesen hat, wird unter III.2.4.1 eingegangen.
Die anthropomorphen Körper erscheinen in diesen – staatspolitischen, kolonialen, und kartografischen – Kontexten zumeist als stark vergrößert. Diese Tendenz wird im Spezialfall der von Horst Bredekamp beschriebenen Bildtradition der „KosmosleiberKosmosleiber“ (Hobbes 73) derart ins Extrem getrieben, dass der Körper mit Extensionen in ein Verhältnis gesetzt wird, die deutlich über den Bezugsrahmen des Terrestrischen hinausgehen – und den Körper sogar größer als die Erde erscheinen lassen, oder gar mit kosmischen Konstellationen (Sternzeichen, Himmelssphären etc.) in Näheverhältnisse rücken (vgl. Bredekamp, Hobbes 73–75). Probates Mittel zur Vergrößerung des menschlichen Körpers ist häufig dessen Darstellung als sogenannter „Kompositkörper“ (Bredekamp, Hobbes 76), der sich „[n]eben der Größe“ dadurch auszeichnet, dass er aus einer „schier unübersehbar große[n] Menge von Personen“ (ebd.) – oder Körpergliedern – zusammengesetzt ist.
Das allgemeine Darstellungspotenzial des Körpers konnte hier nur umrissen und so ein Fundament für die folgenden Analysen geschaffen werden, die dieses Potenzial in literarischen Texten weiter untersuchen und aus neuer Perspektive – in Relation zu FdG – beleuchten.
III Lektüren
Aus den bis hierher beschriebenen Beobachtungen erklärt sich der Fokus der folgenden Lektüren, der auf Texten des 18. und 19. Jahrhundert19. Jahrhundert (Welt-System)s liegt, die damit in der unmittelbaren Vor-Phase des Global-Werdens des Welt-SystemWelt-Systems angesiedelt sind (auch wenn ihnen selbst diese Terminologie natürlich fremd ist). Der Grund für den zeitlichen Fokus ist also, dass sich die bis zu diesem Punkt untersuchten und genannten Texte und Theorien einig sind, dass die ‚Weltwerdung von Erde‘ zwar deutlich früher beginnt, im 19. Jahrhundert jedoch global geworden ist; das ‚Welt-System‘, um in Wallersteins Vokabular zu sprechen, ist erdumfassend geworden. Hierbei ist dezidiert auch auf Robertsons Überlegungen zu verweisen, der im 18. und 19. Jahrhundert einen zentralen Prozess beobachtet, der unter anderem in der Integration nicht-europäischer Staaten in die ‚internationale Gemeinschaft/Gesellschaft‘ besteht (vgl. dessen Ausführungen zu JapanJapan (‚Öffnung‘) 85–96; vgl. genauer III.4.4). Weiter erklärt sich der Bezug auf Wallersteins Ansatz aus dessen Analysen der FdG ‚Welt‘, deren Ergebnisse oben dargestellt wurden.
Die folgenden drei Lektürekapitel, und die Textauswahl, die ihnen zugrunde liegt, lassen sich kontextuell und sprachlich den „three great empires – British, French, American –“ (Said, Orientalism 15) zuordnen. Denn die drei analysierten Haupttexte – Gulliver’s Travels, Candide und Moby-Dick – sind in den dominanten Sprachen (Englisch, Französisch, Englisch) dieser Imperien verfasst und in den entsprechenden Kontexten entstanden.1 Die Texte werden, um die bis hierher beschriebene Prozessualität der ExpansionExpansion nachvollziehen zu können, in der Chronologie ihres Erscheinens (1726, 1759, 1851) analysiert.
An dieser Stelle ist das Genre der untersuchten Texte zu adressieren – denn es ist auffällig, dass im Folgenden zwei Satiren und ein RomanRoman untersucht werden. Das erklärt sich vor allem aus der Thematik des Blickpunktes, die immer wieder aufgegriffen werden wird. Wie Werner von Koppenfels gezeigt hat, ist die SatireSatire2 grundsätzlich der AußenperspektiveAußenperspektive (auchextrinsische Perspektive) verschrieben, denn da sie „auf die pointierte Verkleinerung menschlicher Scheingröße abzielt, muß sie […] statt der vertrauten Nähe der Dinge ironische Distanz schaffen“ (31). Diese Distanz wird dabei häufig als „Blick aus der Höhe“ (ebd.) inszeniert – die doppelte Distanz aufrufend, die weiter oben bereits angesprochen wurde, als räumliche einerseits, und als Enthebung aus dem Alltag andererseits (vgl. II.2.1). Die Schrumpfung, welche Satiren ihrem Genre gemäß häufig inszenieren, ist im Rahmen dieser Arbeit neu zu deuten – mit Hinblick auf den beschriebenen Rahmen der ExpansionExpansion des Welt-SystemWelt-Systems.
Der RomanRoman steht ebenfalls in einem komplexen Verhältnis zum ‚Ganzen‘, insofern in ihm die Frage, inwiefern er selbst ein Ganzes – eine ‚Welt‘, mit allen Einschränkungen, die in Abschnitt II.1.3 erarbeitetet wurden – darstellt (vgl. hierzu auch III.4.1 und III.4.2.2). Darüber hinaus jedoch zeichnet sich Moby-Dick im Speziellen dadurch aus, dass dort ebenfalls eine AußenperspektiveAußenperspektive (auchextrinsische Perspektive) auf das Ganze explizit diskutiert wird.
‚Globale Realitäten‘ sind ein dem Alltag der individuellen Perspektive Entrücktes, so Jameson (s.o.), ein „absent cause“ (Jameson, „Mapping“ 350) jenseits der Wahrnehmung und SichtbarkeitSichtbarkeit (von Ganzheit). Die Annahme Jamesons dabei, dass „this absent cause can find figures through which to express itself in distorted and symbolic ways“, wird von dieser Arbeit mit allem Nachdruck vertreten – und verbunden mit der These, dass in den Texten, auf die das Projekt fokussiert, der Körper diese Funktion übernimmt, indem er – im Wechselspiel mit FdG – größere globale Einheiten und Prozesse darstellt und so sichtbar werden lässt.
1 Präliminarien: „Die Welt, sage ich, ist eine Muschel“
Ich sage dir nun, was du nie mehr vergessen wirst, weil du es im Innersten schon immer wußtest, ebenso wie ich es wußte, ehe es mir offenbar wurde. Wir haben uns nur dagegen gesträubt: Die Welt, sage ich, ist eine Muschel, die sich erbarmungslos schließt. Du sträubst dich? Du wehrst dich gegen die Einsicht? Es ist kein Wunder. Der Schritt war zu groß. Du kannst ihn nicht auf einmal tun. Der alte Nebel liegt zu dicht, als daß ein großes Licht genügte, ihn zu vertreiben. Wir müssen hundert kleine entzünden. (Süskind 45f.)
Der Ich-Erzähler namens Mussard in Patrick Süskinds Das Vermächtnis des Maître Mussard (1995) eröffnet im zitierten Passus dem unmittelbar angesprochenen Leser, dass „die Welt“ eine Muschel sei (eine einzige Muschel wohlgemerkt, doch dazu im weiteren Verlauf mehr). Damit schöpft er eine überraschende Gleichsetzung. Gleichzeitig postuliert er einen Widerstand gegen diese Behauptung seitens des im Text mit hoher Frequenz direkt angesprochenen Lesers. Der Leser wird so textintern inszeniert als ein von der Identität von Welt und Muschel zu überzeugendes Gegenüber, das Vielheit sieht, wo der Erzähler eine Identität von Welt und Muschel postuliert. Die FdG ‚Welt‘ wird so aus dem automatisierten Verständnis gerissen, und durch die In-Eins-Setzung mit einem denkbar unwahrscheinlichen, weil kleinen, Tier in eine Relation gesetzt, die jedwede intuitive Bedeutung von ‚Welt‘ unterläuft. Das Eins-Sein von ‚Welt‘ und Muschel muss entsprechend erst noch hergeleitet werden – und dieses Unternehmen steht im restlichen Verlauf des Maître Mussard im Mittelpunkt. Implizit formuliert der Text damit eine viel grundlegendere Frage: Was ist ‚die Welt‘?
Ausgehend von einem Fund beim Graben im heimischen Garten, bei dem nur knapp unter einer dünnen Schicht Erde Gestein voller versteinerter Muscheln zutage tritt, entwickelt der Protagonist die globale These, dass die gesamte Erde nur von einer dünnen Schicht Erdbodens überzogen ist, unter der sich überall Muschelgestein findet. Von diesem Ist-Zustand ausgehend, der durch (mehr und weniger überzeugende) Beweise, die der Protagonist im Lauf des Textes anhäuft, untermauert wird, entwickelt der Erzähler weiter die These, dass die gesamte ‚Welt‘ in einem Prozess der „Vermuschelung“ (54) begriffen ist. Dieser wird, so seine Prognose, im Erstarren der Erde zu einer Wüste aus Muschelgestein enden.
Doch nicht nur findet sich überall Muschelgestein, es erweist sich außerdem, dass dieses Gestein in sich völlig homogen ist. „Und wenn ich keine Muscheln fand, so fand ich Sand oder Stein, der mit ihnen substantiell identisch war.“ (51) Weiter heißt es, dass sich die „diversen Muscheln meiner Sammlung“ in nichts unterschieden „bis auf die Größe […], und abgesehen von der Form, unterschieden sie sich auch nicht von dem Gestein, mit welchem sie verwachsen waren.“ (51) Alles erscheint als Muschel, auch über deutliche Unterscheidungsmerkmale wie Größe und Form hinweg. Das Gestein, welches die versteinerten Muscheln umgibt, ist „substantiell“ mit ihnen identisch, und diese Identität überschreibt alle weiteren Unterschiede, seien sie auch noch so evident.
Mussard weitet seine Grabungen, die anfangs auf den eigenen Garten beschränkt bleiben, zunehmend aus: „Zunächst grub ich in Passy, dann in Boulogne und Versailles, schließlich hatte ich ganz Paris von St. Cloud bis Vincennes, von Gentilly bis Montmorency systematisch umgraben, ohne auch nur ein einziges Mal vergeblich nach Muscheln zu suchen.“ (50f.) Auch wenn er über Frankreich in seinen Grabungsversuchen nie hinauskommt, erscheint ihm bald eine durchgängige Berührung von Muschel und ‚Welt‘ evident: Die Muschel wächst sich im Lauf der Erzählung zu einer allumfassenden, räumlich motivierten Metonymie aus, welche die GanzheitGanzheit an allen Stellen unterirdisch berührt. Darüber hinaus fällt die zu Textbeginn bemühte ‚Welt‘ im Textverlauf zusehends mit dem „ganzen Kosmos“ (60) und dem „UniversumUniversum (Figur der Ganzheit)“ (68) zusammen. Beschränkt sich Mussard zunächst auf besagten Garten, frankreichweite Grabungen und Annahmen über die Gebirge dieser Erde (vgl. 59), so wird schließlich selbst die Erde im Zuge der eskalierenden Spekulationen verlassen. Der Sprung zum erdnahen Trabanten erfolgt konsequent, denn der Mond erscheint als „ein geradezu klassisches Beispiel für die Vermuschelung des Kosmos“ (60), und so liegt „die Vermutung nahe, daß die Vermuschelung ein allgemeines Prinzip darstellt, welchem nicht nur die äußere Erdgestalt, sondern auch alles irdische Leben, jedes Ding und Wesen auf Erden, ja im ganzen Kosmos unterworfen ist.“ (ebd.) Die Vermuschelung ist nicht weniger als „die weltbewegende Kraft“ (64), und gewinnt so über die anfängliche Feststellung eines Ist-Zustands der Erde hinaus eine dynamische, prozessuale Energie:
Die Entdeckung, daß die Erde im wesentlichen aus Muscheln besteht, könnten wir als belanglose Kuriosität achten, wenn es sich hierbei um einen Zustand handelte, der unveränderlich und abgeschlossen wäre. Leider ist dies nicht der Fall. Meine umfangreichen Studien, deren Gang im einzelnen hier dazulegen mir keine Zeit bleibt, haben ergeben, daß die Vermuschelung der Erde ein rapide fortschreitender, nicht aufzuhaltender Prozess ist. Schon in unseren Tagen ist der erdige Mantel der Welt allenthalben fadenscheinig und brüchig geworden. An vielen Stellen ist er bereits von muscheliger Substanz zernagt und zerfressen. […]. Im ganzen genommen übertrifft die bereits der Vermuschelung anheimgefallene Erdoberfläche die Fläche Europas um ein beträchtliches. (54f.)
Für den Moment betrachtet, handelt es sich bei der „Entdeckung, daß die Erde im Wesentlichen aus Muscheln besteht“ um eine Unterminierung, eine (größtenteils) unterirdische Berührung und Kontiguität von Muschel und Welt. Erst in der Behauptung, dass es sich um einen Prozess handelt – für deren Herleitung „im einzelnen hier darzulegen […] keine Zeit bleibt“ – ergibt sich, dass die Vermuschelung schlicht die ganze Erde zur Muschel machen wird. Und auch der Mensch hat in diesem Zusammenhang seinen Auftritt.
Noch entsetzlicher als die Vermuschelung des Kosmos ist der stetige Verfall unseres eigenen Körpers zur Muschelsubstanz. Dieser Verfall ist so heftig, daß er bei jedem Menschen unweigerlich zum Tode führt. Während der Mensch bei der Zeugung, wenn ich so sagen darf, nur aus einem Klümpchen Schleim besteht, welches zwar klein, aber noch völlig frei von Muschelsubstanz ist, so bildet er bereits beim Heranwachsen im Mutterleibe Ablagerungen davon aus. Kurz nach der Geburt sind diese Ablagerungen noch hinreichend weich und schmiegsam, wie wir das an den Köpfen von Neugeborenen feststellen können. Aber schon nach kurzer Zeit ist die Verknöcherung des kleinen Körpers, die Umschalung und Beengung des Gehirns durch eine harte steinige Kapsel so weit gediehen, daß das Kind eine ziemlich starre Gestalt annimmt. Die Eltern jauchzen und sehen nun erst einen richtigen Menschen in ihm. Sie begreifen nicht, daß ihr Kind, kaum daß es zu laufen beginnt, schon von Muscheln befallen ist und nur noch seinem sicheren Ende entgegentaumelt. (61)
So wird auch der menschliche Körper und dessen Altern (das eher als lebenslanges Zur-Muschel-Werden begriffen wird) in den weltweiten Prozess – im zitieren Passus ist gar von der FdG ‚Kosmos‘ die Rede – eingebunden. Körper und GanzheitGanzheit werden im Laufe des menschlichen Lebens zunehmend ‚identischer‘, bis der Unterschied Körper/Ganzheit völlig hinfällig geworden ist:
Im Alter nämlich wird die Versteinerung des Menschen am deutlichsten sichtbar: Seine Haut wird spröde, die Haare brechen, die Adern, das Herz, das Gehirn verkalken, der Rücken krümmt sich, die ganze Gestalt biegt sich und wölbt sich, der inneren Struktur der Muschel folgend, und schließlich fällt er in die Grube als ein jämmerlicher Trümmerhaufen von Muschelstein. Und selbst damit ist es noch nicht zu Ende. Denn der Regen fällt, die Tropfen dringen ein ins Erdreich, und das Wasser zernagt und zerkleinert ihn in winzige Teile, die es hinabträgt zur Muschelschicht, wo er dann in Form der bekannten Steinmuscheln seine letzte Ruhe findet. (61f.)
Hier findet ein Übergang statt, von einer Relation der Ähnlichkeit zwischen menschlichem Körper und Muschel, die über die Krümmung des menschlichen Körpers im Alter („der Gestalt der Muschel folgend“) zum Bild gebracht wird, hin zu einer Beziehung, die sich, über den Prozess der mineralischen Auswaschung, als Identität von Mensch und Muschelsubstanz darstellt. Im weiteren Verlauf jedoch erscheint die Vermuschelung damit als fortschreitende Einsmachung. Ihren Höhepunkt finden die Überlegungen zum Verhältnis zwischen Muschel und Welt in einer apokalyptischen Vision des Protagonisten, in der nicht mehr im Plural von Muscheln oder von Muschelsubstanz gesprochen wird: