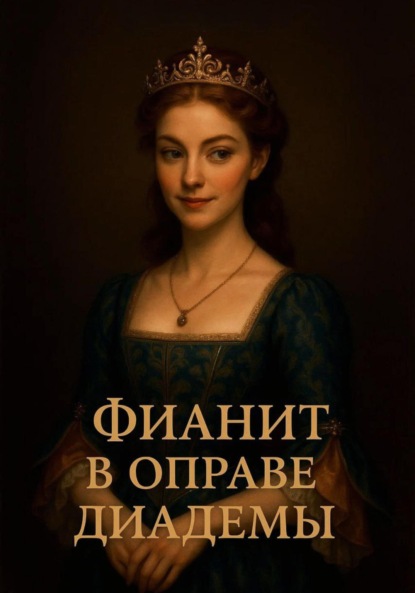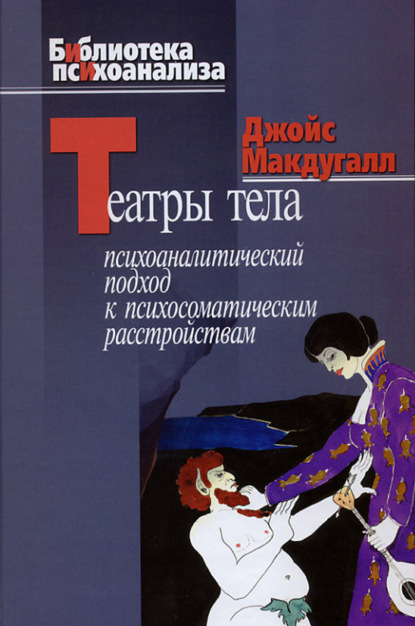- -
- 100%
- +
Ich wurde aus meinem Garten weggetragen in das Dunkle. Ich wußte nicht, wo ich mich befand, ich war nur umgeben von der Dunkelheit und von merkwürdigen gurgelnden und rauschenden Geräuschen. Diese beiden Geräuschgruppen – das wäßrige Rauschen und das steinige Knirschen – schienen mir in dem Augenblick als Schöpfungsgeräusche der Welt, wenn ich so sagen darf. Ich hatte Angst. Als die Angst am stärksten war, fiel ich abwärts, die Geräusche entfernten sich, dann fiel ich aus der Dunkelheit heraus. Mit einem Mal war ich von so viel Licht umgeben, daß ich glaubte, blind zu werden. Ich fiel weiter im Licht und entfernte mich von dem dunklen Ort, den ich jetzt als ungeheure schwarze Masse über mir erkannte. Je weiter ich fiel, desto mehr erkannte ich von der Masse und desto größer wurden ihre Ausmaße. Schließlich wußte ich, daß die schwarze Masse über mir eine Muschel war. Da spaltete sich die Masse in zwei Teile, öffnete ihre schwarzen Flügel wie ein gigantischer Vogel, riß die beiden Muschelschalen auf über das ganze Weltall und senkte sich herab über mich, über die Welt, über alles was ist und über das Licht und schloß sich darüber. Und es wurde endgültig Nacht, und das einzige, was es noch gab, war das Geräusch des Mahlens und Rauschens. Der Gärtner fand mich auf dem Kiesweg liegen. (66f.)
Mussard meint, aus einem Innenraum herauszufallen, und so, durch diese Bewegung, eine GanzheitGanzheit, die sich als die „Urmuschel“ erweist, von außen, einem archimedischen Blickpunkt, sehen zu können.1 Der Erzähler sieht nun nicht länger Gestein, das substantiell identisch ist mit all den Muscheln, oder Körper, die zu Stein werden, sondern er „wußte […], daß die schwarze Masse […] eine Muschel war“ (Hervorhebung T.E.). Grammatikalisch kommt es zu einer Singularisierung von ‚Muschel‘. In einem zweiten Schritt verschlingt die Muschel das „Weltall“ – im Übrigen die einzige Verwendung der FdG ‚Weltall‘ in diesem Text, durch die betont wird, dass diesmal wirklich die ‚totale Ganzheit‘ betroffen ist, und nicht etwa ‚nur‘ die Erde, der Mond, oder das Sonnensystem. Das Weltall wird in einer Schreckensvision von einer Muschel verschlungen.
Die Kraft, die alles Leben in ihren Bann schlägt und alles Ende herbeiführt, der höchste Wille, der das UniversumUniversum (Figur der Ganzheit) beherrscht und es zur Vermuschelung als Zeichen der eigenen Omnipräsenz und Omnipotenz zwingt, geht aus von der großen Urmuschel, aus deren Innern ich für kurze Zeit entlassen war, um ihre Größe und furchtbare Herrlichkeit zu schauen. Was ich gesehen habe, war die Vision des Weltendes. Wenn die Vermuschelung der Welt so weit gediehen ist, daß jedermann die Macht der Muschel erkennen muß, wenn die Menschen, der Hilflosigkeit und dem Entsetzen preisgegeben, zu ihren verschiedenen Göttern schreien und sie um Hilfe und Erlösung anflehen, dann wird als einzige Antwort die große Muschel ihre Flügel öffnen und sie über der Welt schließen und sie zermahlen. (68f.)
Es ist hier nur noch eine Muschel, welche die „Welt“ verschlingt, womit diese nicht länger aus unzähligen Muscheln oder „substantiell“ (s.o.) aus Muschelgestein besteht. Stattdessen wird die „Welt“ ausgelöscht, und was bleibt ist die EinsheitEinsheit (Unicity) der einen Muschel. Die unterschiedlichen FdG, die im zitierten Passus – und im übrigen Text – ihren Auftritt haben, werden von der einen Muschel verdrängt, die an ihre Stelle tritt. Hier lässt sich also eine weitere Nuance in die bereits besprochene Unterscheidung zwischen EinheitEinheit und Einsheit eintragen (vgl. II.1.4). Einheit setzt strukturell stets Vielheit voraus, welche als Einheit wahrgenommen/dargestellt wird; Einheit verdrängt Vielheit nicht notwendig. Süskinds Text hingegen inszeniert die Beseitigung von Vielheit zugunsten eines einzelnen Gegenstandes, der Muschel, der an die Stelle der Vielheit tritt, und dessen Eins-Sein stiftet.
Der Prozess der Vermuschelung stellt, so die Deutung, die hier an den Text herangetragen werden soll, die Kompression der GanzheitGanzheit als radikale Vereinsheitlichung dar. Die von Mussard gegebene Beschreibung der hauchdünn von Erdboden überzogenen Ganzheit der Erde, die im Kern schon Muschel ist, wird so als wahnhafte Momentaufnahme des Fortschreitens der Kompression lesbar, einer paranoiden oneworldedness (vgl. II.2.2), die die Ganzheit auf eine Muschel reduziert. Unter dieser Perspektive entwickelt der Text einen als materiell inszenierten globalen Zusammenhang, der in scharfem Kontrast steht zu den üblicherweise dezidiert nicht-stofflichen Metaphern und Bildern, die zur Illustration von Fernwirkungszusammenhängen herangezogen werden. So spricht man in der Globalisierungstheorie eher davon, dass alle Ereignisse auf der Erde globale Echos2 nach sich ziehen; Peter Sloterdijk spricht (allerdings für das 20. Jahrhundert) noch abstrakter von „Transaktionen“ die noch aus weiter „Ferne“ die „Gegenspieler in Mitleidenschaft“ (Sphären II 824) ziehen. Im Kontrast zu diesen Beschreibungen also erweist sich die Kompression in Süskinds Text als ein Prozess, der EinsheitEinsheit (Unicity) (in der extremsten Form) als substantiell verstandene Identität aller Stoffe inszeniert.
Mit einiger Verzweiflung wirft der Erzähler schließlich die Frage auf: Was bleibt? – und stößt den Leser damit auf die an die Körperthematik stets untrennbar gebundene Frage nach der SeeleSeele (im Verhältnis zum Körper):
Wie sollte ich dich trösten? Soll ich von der Unzerstörbarkeit deiner SeeleSeele (im Verhältnis zum Körper), von der Gnade des barmherzigen Gottes, von der Auferstehung des Leibes faseln wie die Philosophen und Propheten? […] Wozu lügen? (69)
Die Frage nach der SeeleSeele (im Verhältnis zum Körper) wird auch am Ende des Textes, welches als „Nachschrift Claude Manets, des Dieners des Herrn Mussard“ (70) Gestalt annimmt, aufgegriffen. Nach der Beschreibung des Umstandes, dass man dem Herrn Mussard einen „rechtwinklingen Sarg zimmern“ lassen musste, da „mein Herr auch nach Ablauf der üblichen Todesstarre seine versteifte Haltung nicht aufgeben wollte“, schreibt Manet: „Gott sei seiner Seele gnädig!“ (70) und ‚faselt‘ damit von eben jener Seele, von der Mussard – angesichts der Vermuschelung der Welt – keine Lügen erzählen wollte. Die Seele – mit wenigen Ausnahmen in den meisten Vorstellungen vom Körper als nicht-stofflich verstanden –3 wird also von Süskinds Text verabschiedet, da sie nicht in die materiell gedachte ‚Vermuschelung‘ passt. So fällt der Einebnung von Unterschieden – wie die Behauptung der ‚substantiellen‘ Identität sämtlicher Stoffe sie mit sich bringt – zuletzt auch die Seele zum Opfer, die als Nicht-Substantielles in der substantiellen EinsheitEinsheit (Unicity) der ‚Muschel-Welt‘ keinen Platz hat.
2 Jonathan Swifts Gulliver’s Travels
2.1 Prolog: Ideenimport aus den Kolonien (A Modest Proposal)
Swifts politisches Pamphlet1A Modest Proposal (1729) schlägt vor, die Kinder irischer Bettlerinnen nach dem ersten Lebensjahr an die englische Oberschicht zu verkaufen, von der diese als Delikatesse verspeist werden sollen; somit soll die zu dieser Zeit in IrlandIrland (im kolonialen Kontext) grassierende Armut gelindert werden.2 Das Proposal legt also eine kannibalische Praktik zur Lösung der irischen Krise nahe.3 Dies ist, auf den ersten Blick, ein satirischer Kommentar auf die bilaterale Konstellation zwischen ungleichen Staaten: Irland kommt hierbei der Sonderstatus der first colony zu und leidet gesellschaftlich massiv unter dem hegemonialen Einfluss Englands, welches Irland faktisch der Selbstbestimmung beraubt hatte.4 Die Situation stellt sich als koloniales Ausbeutungsverhältnis unmittelbarster Art dar, das in der an ein Oxymoron grenzenden Begrifflichkeit des dependent kingdom, unter dem Irland zu dieser Zeit auch adressiert wird, kaum verborgen zutage tritt.5 Dementsprechend ist folgende, im Proposal vorgebrachte Begründung des drastischen ‚Lösungsvorschlags‘ nur folgerichtig:
I GRANT this Food will be somewhat dear, and therefore very proper for Landlords; who, as they have already devoured most of the Parents, seem to have the best Title to the Children. (233)
Die althergebrachte Ausbeutung der Iren rechtfertigt somit satirisch die Ausbeutung auch noch der jüngsten Generation, wobei das körperliche Verschlingen („devoured“) die Gewalt Englands markiert.6
Dieser Vorschlag ist in seinem Inhalt jedoch keineswegs so radikal, wie es ohne eine historische Kontextualisierung den Anschein haben mag. Denn drei zeitgenössische Praktiken in IrlandIrland (im kolonialen Kontext) und England politisieren Körper ebenfalls in massiver Form. So ist in diesem Zusammenhang erstens auf die Praktik des corpse-stealing hinzuweisen, also das Stehlen und Verkaufen von Leichen (betroffen sind von dieser Praxis vor allem Angehörige der Unterschicht).7 Zweitens stellt die Praktik der öffentlichen – und das heißt immer auch: strafenden – Obduktion von ‚Kriminellen‘ eine massive Politisierung von Körpern dar,8 die in diesem Zeitraum eine große gesellschaftliche Rolle spielt.9 Drittens muss auf eine irische Beerdigungspraktik verwiesen werden, die sich zu dieser Zeit zu etablieren beginnt, in welcher der Tod prominenter Personen zum Anlass genommen wird, einen Schal aus irischem Stoff zum patriotischen dress-code zu erklären; durch den vermehrten Verkauf von irischem Leinen soll so die heimische Wirtschaft angekurbelt werden.10 Semantisch hochgradig aufgeladene Körper sind somit im politischen Gefüge Irlands Anfang des 18. Jahrhunderts sehr präsent, und zwar als Waren, als Gegenstände der Demonstration von Macht, sowie als patriotische Symbole.11 Von derart ‚aufgeladenen‘ Körpern toter Iren einerseits, und der grassierenden Angst vor Grabräubern und Obduktionen andererseits, ist der Weg zum Vorschlag in Swifts Pamphlet nicht mehr weit, der insofern nur einem heutigen Publikum als haltlose Übertreibung erscheinen muss – ganz davon abgesehen, dass das Verspeisen von Menschen als Metapher in (finanz-)ökonomischen Zusammenhängen zu dieser Zeit en vogue ist. Das Proposal denkt diesen Umgang mit menschlichen Körpern lediglich satirisch einen Schritt weiter, indem es vorschlägt, sogar Kinder dem Verkauf und Verzehr preiszugeben.
Das Proposal ist weiter Teil des Genres des politischen Pamphlets zur Lösung der Krisensituation in IrlandIrland (im kolonialen Kontext), welches Anfang des 18. Jahrhundert18. Jahrhundert (Welt-System)s hochpopulär ist und die verzweifelte wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation anprangert. Gleichzeitig verdienen die Autoren dieses Genres an genau den Missständen, die sie kritisieren, ihr Geld. Das Genre ist damit ebenso politisch wie lukrativ.12 Der Bezug des Proposal auf dieses Genre ist der einer intertextuell verfahrende Parodie, die auf den Aspekt der Lukrativität des irischen Leidens abzielt. Gleichzeitig attackiert es dieselben gesellschaftlichen Umstände, auf die sich das ganze Genre bezieht (und wird auf dem gleichen Markt zum Bestseller, auf dem die parodierten Pamphlete verkauft werden):13 „The text may set Swift up as an outsider offering a horrified commentary on an insanely acquisitive culture, but as a saleable product the Proposal cannot help but participate in the cult of commodity fetishism it satirises.“ (Ward, „Bodies“ 283)
Im Rahmen der hiesigen Studie ist nun darauf aufmerksam zu machen, dass das Proposal die beschriebene lokale Situation in Dublin, auf die der Text (vor allem an seinem Beginn) fokussiert, aus dem bilateralen Kontext (IrlandIrland (im kolonialen Kontext)/England) heraushebt. Denn im Proposal findet ein Ideenimport interkontinentaler Art statt: Die den Text strukturierende und vorantreibende Idee, die Kinder der irischen Unterschicht an die englische Oberschicht zu ‚verfüttern‘, ist, wie behauptet wird, amerikanischen Ursprungs:
I HAVE been assured by a very knowing American of my acquaintance in London; that a young healthy Child, well nursed, is, at a Year old, a most delicious, nourishing, and wholesome Food; whether Stewed, Roasted, Baked, or Boiled; and I make no doubt that it will equally serve in a Fricasie, or a Ragout. (232)
En passant14 bedient der Passus den komplexen Topos des amerikanischen (bzw. karibischen) KannibalismusKannibalismus, in welchem sich koloniale Praktiken und Topographien des othering verdichten.15 Postkolonial informierte Analysen der letzten Dekaden haben deutlich gemacht, dass der Topos des Kannibalismus den kolonialen ‚Anderen‘ diffamieren und damit entmenschlichen soll.16 Überzeugende Beweise für eine tatsächliche Praxis der Anthropophagie sind (wenn sie denn nicht gänzlich fehlen) dabei jedoch zumeist offensichtlich konstruiert, von den Erwartungen der Beobachter prädeterminiert, oder von unsicherer und äußerst vager Natur.17 So wurde die Lesart entwickelt, dass die Zuschreibung des ‚Kannibalismus‘ die Projektion des zutiefst europäischen Begehrens ist, das zu kolonisierende Gegenüber zu ‚verspeisen‘, und das heißt: auszubeuten. Der Kannibalismus ist so auf der Seite der Kolonialmächte zu verorten.18
Noch ein zusätzliches Mal wird der Bezug auf den amerikanischen KannibalismusKannibalismus im Text aktualisiert,19 diesmal mittels detaillierter Beschreibungen von kindlichem Menschenfleisch, die wiederum von der Expertise der amerikanischen Bekanntschaft herrühren:
For as to the Males [die männlichen Kinder, die verspeist werden sollen; T.E.], my American Acquaintance assured from frequent Experience, that their Flesh was generally tough and lean, like that of our School-boys, by continual Exercise; and their Taste disagreeable; and to fatten them would not answer the Charge. (234)
In der Bezugnahme des Proposal auf diesen Topos hebt der Text die irische Situation aus dem bilateralen Kontext heraus und verweist auf die interkontinentale Konstellation zwischen Europa und Amerika. Vor diesem Hintergrund wiederum erscheint IrlandIrland (im kolonialen Kontext) umso deutlicher als Kolonie Englands, d.h. als eine Kolonie unter vielen, zu denen, nicht zuletzt, auch die in Amerika gehören.20 Weiter illustriert dieses Verfahren eine zentrale Waffe Swift’scher Wahl, um die hegemonialen Praktiken des Kolonialismus literarisch zu beleuchten: Ein durch explizite Körperlichkeit geprägter Topos (sein Sprachmaterial, d.h. seine Metaphern, Intertexte etc.) wird genutzt, um eine beschriebene Situation aus ihrem lokalen Kontext herauszuheben und in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Dieser ‚größere Zusammenhang‘ ist hier der koloniale, der neben Irland auch die anderen kolonialen Beziehungen Englands einschließt. Die in körperliche Bilder gefasste Grausamkeit des importierten schemes unterstreicht darüber hinaus die kolonialen Prozessen inhärente Gewalt.
Dass der Bezug des Proposal über eine bilaterale Konstellation hinausgeht, zeigt sich auch an anderer Stelle im Text, die sich zweier Figuren der GanzheitGanzheit (FdG) bedient. So nimmt der Text als Adressat seines Vorschlags nicht etwa nur die lokale Öffentlichkeit an, sondern richtet sich an nichts weniger als „die Welt“:
I CAN think of no one Objection, that will possibly be raised against this Proposal; unless it should be urged, that the Number of People will be thereby much lessened in the Kingdom. This I freely own; and it was indeed one principal Design in offering it to the World. I desire the Reader will observe, that I calculate my Remedy for this one individual Kingdom of IRELAND, and for no other that ever was, is, or, I think, ever can be upon Earth. (237)
Die FdG ‚world‘ steht hier ein für das Publikum, das das Proposal lesen soll. Als Text eines spezifisch ‚irischen-englischen‘ Genres richtet er sich so mit dem Adressaten „Welt“ an ein ausgesprochen großes Publikum. Doch trägt diese Hyperbel nicht nur zum allgemein-ironischen Ton der Passage (und des gesamten Textes) bei. Denn die FdG ‚world‘ kann darüber hinaus auch als Verweis auf den deutlich größeren, kolonialen Zusammenhang verstanden werden. Wenn die FdG ‚world‘ hier also nicht auf die Bedeutung eines ‚zu großen‘ Publikums reduziert, sondern als Bezugnahme auf GanzheitGanzheit ernst genommen wird, so tritt die Öffnung des Textes auf eine größere Ganzheit hin, die der Kannibalen-Topos bewirkt und vorbereitet, noch einmal deutlicher hervor. Das Proposal beschreibt eine interkontinentale Konstellation und richtet sich somit an die koloniale Ganzheit seiner Zeit.
Die hyperbolische Formulierung einer allumfassenden Zeitlichkeit, die im Passus durch den Satzteil „ever was, is, or I think, ever can be“ evoziert wird, sowie der explizit aufgerufene Raum der gesamten „Earth“ verweist ebenfalls auf eine denkbar große (zeitliche und räumliche) Extension. Dieser Bezug auf GanzheitGanzheit lässt deutlich werden, dass der Sonderstatus Irlands, den der Text auf den ersten Blick behauptet, nicht ernsthaft behauptet werden soll; IrlandIrland (im kolonialen Kontext) ist mitnichten die einzige Kolonie Englands. Das „I think“ betont zusätzlich die Ironie des Gesagten und untergräbt so den vermeintlichen Einzelstatus Irlands noch weiter.
Was sich hier erkennen lässt, ist ein Verfahren des Textes, koloniale Ausbeutungsverhältnisse körperlich grausam in Szene zu setzen und diese ‚Szenen‘ dann in ein enges Verhältnis zu FdG zu setzen. Ausgehend von diesen Beobachtungen zum Proposal soll im Folgenden für Gulliver’s Travels die folgende Struktur beschrieben werden: das Herausheben lokaler oder vermeintlich bilateraler Ereignisse in einen größeren Kontext über das Mittel des Bezuges auf literarisch inszenierte Körper – ein Verfahren, das enggeführt wird mit einer intensiven Reflektion auf größere Zusammenhänge, evoziert durch FdG.
2.2 Hinführung: Ganzheit in den vier Teilen der Travels
In allen vier Büchern der Travels1 lässt sich ein konstanter Bezug auf GanzheitGanzheit nachweisen. Wie bereits beschrieben wurde, lässt sich dabei eine Struktur im Text isolieren, in der wiederholt scheinbar kleinteilig-lokales, über die Verschränkung der Inszenierung von Körpern mit der Arbeit an FdG, in ein Verhältnis mit größeren Ganzheiten gesetzt wird. So arbeitet der Text aktiv an verschiedenen Vorstellungen von Ganzheit.
Die im Text inszenierte/n GanzheitGanzheit/en erscheint/erscheinen dabei im Spannungsfeld zwischen EinsheitEinsheit (Unicity) einerseits und AsymmetrieAsymmetrie (des Welt-Systems) andererseits. Der Aspekt der Asymmetrie umfasst dabei vor allem koloniale Zusammenhänge im Allgemeinen und den atlantischen SklavenhandelSklavenhandel im Besonderen.2 Der Aspekt der Einsheit tritt im Text weniger prominent hervor und ist in der Regel an die Darstellung kolonialer Zusammenhänge gekoppelt.
Neben der beschriebenen Struktur ist die Parodie von ReiseliteraturReiseliteratur das Hauptmittel des Textes zur Arbeit an GanzheitGanzheit.3 Diese Genre-Parodie äußert sich vor allem in der Thematisierung von KartografieKartografie (und das umfasst ihr Wissen, ihre Medien und Techniken)4 sowie der Beschreibung von Menschen und/oder Wesen (‚Anderen‘), die auf den Reisen angetroffen werden. Beide Themenkomplexe sind ein fester Bestandteil der Reiseliteratur dieser Zeit und werden von den Travels intertextuell aufgegriffen. Innerhalb dieser Parodie, welche sich als durchgängige Makrostruktur des Textes beschreiben lässt, kann wiederum der Topos der Verschränkung inszenierter Körper mit der Arbeit an FdG isoliert werden; der hier vorgestellte Topos ist der Parodie von Reiseliteratur also strukturell untergeordnet. So soll das Wissen, das aus Untersuchungen zum Verhältnis zwischen dem Genre der Reiseliteratur und den Travels bereits vorliegt, um einen entscheidenden Aspekt erweitert werden, insofern deutlich gemacht werden soll, dass sich die Travels nicht nur um die Darstellung ferner Regionen der Erde und deren Bewohner drehen, sondern auch um die Frage, wie die Ganzheit, in der all diese Elemente enthalten sind, zu denken ist.
Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis der Travels zeigt einen vierteiligen Text, wobei die ersten beiden Teile jeweils acht Kapitel umfassen. Auch die Textmenge der ersten beiden Teile ist ähnlich. Die Teile III und IV dagegen umfassen einmal elf und einmal zwölf Kapitel. Auf die ersten beiden kürzeren Teile der Travels folgen also zwei längere Teile. Äußerlich betrachtet handelt es sich um einen streng strukturierten Text.
Fragt man hingegen nach der inhaltlichen Kontinuität zwischen den Textteilen, so ist der Befund weniger eindeutig. Hier wurde gehäuft darauf hingewiesen, dass die Teile I und II eine starke inhaltliche Kohärenz aufweisen, insofern die dort dargestellte Vergrößerung und Verkleinerung der dargestellten ‚Nationen‘ als Inversionen voneinander erscheinen, wohingegen der dritte und vierte Teil sich weder in Bezug aufeinander noch in Relation zu den Teilen I und II in ähnlicher Weise beschreiben lassen.5 Aus dieser Perspektive gesehen, scheint zwischen den Teilen I und II einerseits und III und IV andererseits ein ‚Bruch‘ zu stehen.6 Wie mit Blick auf aktuellere Forschungen jedoch gesagt werden kann, ergibt sich die Beschreibung eines Bruchs in der Mitte der Travels aus der Überbetonung der oberflächlichen Homogenität der Teile I und II. Denn inzwischen haben einige Studien nachgewiesen, dass sich bestimmte Themen und/oder Topoi durch den gesamten Text der Travels ziehen und ihm so eine starke inhaltliche Kontinuität geben. Exemplarisch kann etwa auf Isabel Karremanns Männlichkeit und Körper hingewiesen werden, welches jedem der vier Teile der Travels das Abhandeln jeweils eines Elements des ‚Männlichkeitskatalogs‘ des 18. Jahrhunderts nachweist.7 Auch Dennis Todds Arbeit kann hier genannt werden, der einen engen Zusammenhang zwischen dem munteren Straßenleben Londons und den im Text inszenierten Reisen herstellt, insofern beide ähnliche Attraktionen zu bieten haben: Miniaturen, Riesen, Zwerge, intelligente Pferde etc. Studien wie diese bieten also ebenso plausible wie starke Deutungen des gesamten Textes an.
Auch Jenny Mezciems bietet eine Beschreibung des ganzen Textes an:
Thematically, Gulliver’s Travels is an attack on human pride, a satire on civilized society, […] human nature as Swift saw it, and an analysis of the quality of human reason. Thematically the four Voyages are perfectly consistent: there is no individual Voyage from which any of these themes is absent, nor is the treatment of them noticeably uneven in emphasis. The themes are constant and the variations do not stray from the expression of a consistent meaning through narrative detail. In this respect the Voyage to Laputa has no less a part to play in the whole than any other Voyage. (Mezciems, „Unity“ 3)
Die Rede von einer durchgängigen „satire on civilized society“ ist einleuchtend. Problematisch ist jedoch, dass Jenny Mezciems von Swifts Meinungen ausgeht („as Swift saw it“),8 sowie der unscharfe Befund, laut dem der Text durchgängig menschliche Universalien („human pride“, „human nature“, „human reason“) adressiere. Dieser Befund hat zwar insofern seine Berechtigung, als in den Travels ähnliche Begriffe tatsächlich gehäuft fallen.9 Dass in den Travels aber wirklich unspezifisch ‚die Menschheit‘ im Allgemeinen satirisch dargestellt wird, ist zu hinterfragen, zugunsten einer nuancierteren Beschreibung der Ausrichtung des Textes auf ‚große‘ und ‚grundsätzliche‘ Themenkomplexe.
Bei den Travels handelt es sich also um einen formal stark strukturierten Text, der eine stark gegliederte Weltreise präsentiert. Jedem der vier Teile des Textes entspricht der Besuch einer abgeschlossenen Region der Erde (der Text nennt diese ‚nations‘, wie auch schon aus seinem vollen, ursprünglichen Titel hervorgeht: Travels into Several Remote Nations of the World),10 bzw. ist Teil III dem Besuch mehrerer, jedoch räumlich und thematisch eng assoziierter Regionen gewidmet.
Alle diese ‚Nationen‘ zeichnen sich durch ein starkes In-Sich-Geschlossen-Sein aus, das sich aus vier Eigenschaften ergibt: (1) Die Nationen befinden sich allesamt in (noch) nicht-kartierten oder wenig bekannten Erdteilen. (2) Sie sind in der Mehrzahl allseitig von MeerMeer umgeben und somit räumlich isoliert; gibt es eine Verbindung zum Festland, so versperren Gebirge den Weg in andere Erdteile (wie im Falle Brobdingnags, welches so von Nord-Amerika abgeschlossen ist, dessen gewaltige Verlängerung bzw. Erweiterung es darstellt). (3) Weiter glauben die Bewohner der Nationen wiederholt dezidiert nicht an die Existenz von Regionen außerhalb der geschlossenen Grenzen ihrer ‚Nation‘, die somit kein Außen kennt.11 So lassen die Bewohner Lilliputs Gulliver wissen, dass sie seinen Berichten von Gebieten jenseits von Lilliput (und seiner Nachbarinsel Blefuscu) keinen Glauben schenken wollen: