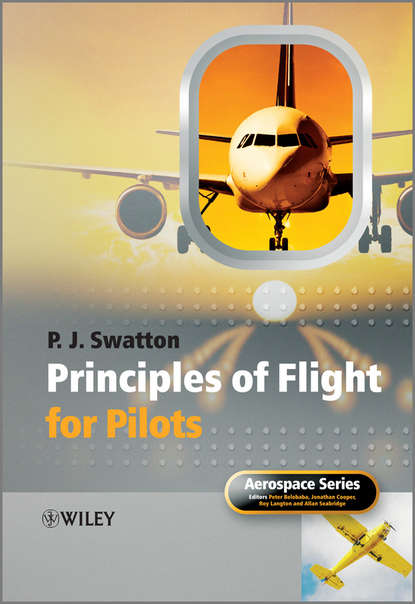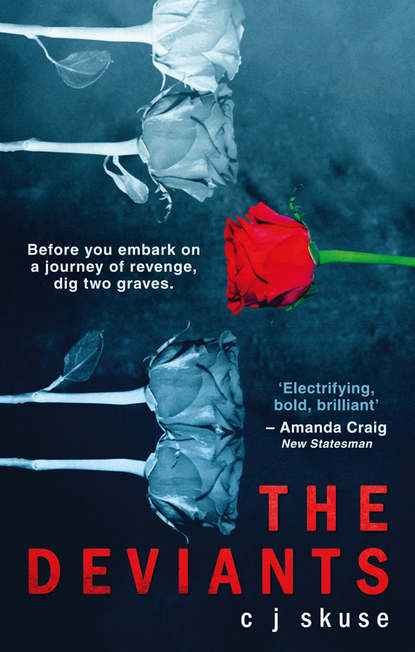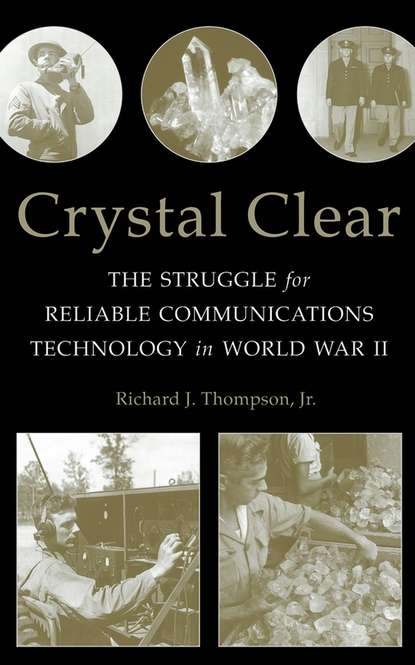- -
- 100%
- +
Now in the midst of these intestine Disquiets, we are threatned [sic] with an Invasion from the Island of Blefuscu, which is the other great Empire of the Universe, almost as large and powerful as this of his Majesty. For as to what we have heard you affirm, that there are other Kingdoms and States in the World, inhabited by human Creatures as large as yourself, our Philosophers are in much doubt, and would rather conjecture that you dropt from the Moon, or one of the Stars; because it is certain, that an [sic] hundred Mortals of your Bulk would, in a short time, destroy all the Fruits and Cattle of this Majesty’s Dominions. Besides, our Historys of six thousand Moons make no mention of any other Regions, than the two great Empires of Lilliput and Blefuscu. (40/I.4)
Zunächst fällt hier der Bezug auf die FdG ‚universe‘ auf, über den das kleine Lilliput seine größenwahnsinnige Selbstbeschreibung entfaltet. Um die Integrität der ‚Nation‘ – die in ihrer Kleinheit im Kontrast zu Gullivers enormer Größe Ausdruck findet – bewahren zu können, wird Gulliver kurzum als Außerirdischer deklariert („you dropped from the moon, or one of the stars“). So wird auf eine größere, den Mond einschließende Extension referiert, durch die Gullivers anormale Größe ‚(weg-)erklärt‘ wird – und aus dem Raum der eigenen GanzheitGanzheit ausgeschlossen werden kann.
(4) Weiter lässt sich für alle ‚Nationen‘ eine große Homogenität konstatieren: In den Teilen I und II ergibt sich diese aus den Größenverhältnissen (alles ist in der ersten ‚Nation‘ verkleinert, in der zweiten vergrößert), in Teil III über den Bezug auf die Diskussion von Wissenschaften im Stil der Royal SocietyRoyal Society, in Teil IV über die Darstellung einer idealen, augustinischen Gesellschaft. Alle Gesellschaften werden vom Text in ihren spezifischen Eigenheiten im Detail beschrieben, etwa deren Staats- und Kriegsführung, die Erziehung der Kinder usw. betreffend.12 Sie stellen in sich geschlossene Ganzheiten dar.
Diese makroperspektivischen Beschreibungen der Nationen und ihrer Eigenschaften sollen die folgende Grundbeobachtung nachvollziehbar machen: Die ‚Nationen‘ verstehen sich jeweils nicht nur als die Totalität einer Nation, d.h. als GanzheitGanzheit eines Teils, sondern vielmehr als deutlich größere Ganzheiten, wenn nicht gar als allumfassende Ganzheit (sie kennen also keine Ganzheit jenseits der eigenen, und damit konkret nicht die Erdteile, aus denen Gulliver zu ihnen kommt). Dies ist die Grundeigenschaft der Nationen in den Travels und sie gibt dieser Weltreise ihren spezifischen Charakter, der paradoxerweise stets aus der Position extrem abgeschlossener Regionen heraus auf die Ganzheit reflektiert.
So kann, ausgehend von den Punkten (1) bis (4), eine neue Struktur isoliert werden, die nicht nur den vermeintlichen ‚Bruch‘ zwischen den Teilen I/II und III/IV überbrückt, sondern welche zusätzlich auch solchen (denkbar unscharfen) Thematiken wie dem zitierten „human reason“ einen genaueren Bezug entgegensetzen kann. Denn alle Teile der Travels verbindet die ungebrochene Reflexion des Textes auf GanzheitGanzheit(en), und das heißt, wie zu zeigen ist, genauer: die Arbeit an FdG über literarisch inszenierte Körper.
2.3 Bezüge auf die Erde
2.3.1 Paratextuelle Reflexion auf Reiseliteratur
In einem dem Haupttext vorangestellten Paratext namens The Publisher1to the Reader, der bereits in der ersten Ausgabe der Travels enthalten war,2 wird dem Leser, nach einigen Abhandlungen, welche ironisch von der Glaubwürdigkeit Gullivers überzeugen sollen, seitens eines fiktiven Lektors Folgendes mitgeteilt:
THIS Volume would have been at least twice as large, if I had not made bold to strike out innumerable Passages relating to the Winds and Tides, as well as the Variations and Bearings in the several Voyages; together with the minute Descriptions of the Management of the Ship in Storms, in the Style of Sailors: Likewise the Account of the Longitudes and Latitudes; wherein I have Reason to apprehend that Mr. Gulliver may be a little dissatisfied: But I was resolved to fit the Work as much as possible to the general Capacity of Readers. However, if my own Ignorance in Sea-Affairs shall have led me to commit some Mistakes, I alone am answerable for them: And if any Traveller [sic] hath a Curiosity to see the whole Work at large, as it came from the Hand of the Author, I shall be ready to gratify him. (Swift, Travels 6)
Angeblich hat die Leserschaft eine Version des Textes vor sich, in welcher NautikNautik und kartografische Belange betreffende Passagen massiv gekürzt wurden. Entgegen dieser Behauptung findet sich jedoch Material genau dieser Art zuhauf in den Travels, denn die Travels enthalten nicht nur die oft angeführte Parodie nautischen Jargons (70/II.1), sondern auch mehrere abgebildete Karten, ein „Proposal for correcting modern Maps“ (92–96/II.4), und detaillierte Beschreibungen der Wege, die die Schiffe, auf denen Gulliver reist, zurücklegen (vgl. 16/I.1, 69/II.1). Der Text stellt kartografische Belange also wiederholt explizit in den Mittelpunkt; nicht zuletzt gilt das für die Passagen, in denen Gulliver die Landschaft vermisst. So lässt sich eine Spannung konstatieren zwischen den nicht nachvollziehbaren und insofern unsichtbaren Streichungen des Lektors einerseits, und den nichtsdestotrotz vorhandenen Bezügen auf kartografische Belange andererseits. Diese Spannung ist im Text im Allgemeinen satirisch: „Swift did not take geography more seriously than was necessary to satirize it; his carelessness with geographic details in Gulliver provides additional evidence of his contempt for natural, as opposed to moral, philosophy.“ (Bracher 74) Diese Beschreibung ist zutreffend, insofern sie einen Hang zur Nachlässigkeit in Sachen kartografischer Präzision konstatiert, der im Text eindeutig nachweisbar ist.
Doch im zitierten Passus der Travels geht es nicht in erster Linie um die Relevanz kartografischer Daten und Verfahren, sondern um die Produktion eines Textes eines spezifischen Genres (ReiseliteraturReiseliteratur). Der Bericht einer Weltreise wird hier nicht als unmittelbares Produkt eines schreibenden Reisenden präsentiert, sondern als das Ergebnis eines verlegerischen Selektionsprozesses, der sich auf das Wissen und die Aufnahmefähigkeit einer allgemeinen Leserschaft bezieht („the general Capacity of Readers“), der zwei der grundsätzlichsten Techniken der ‚Erschließung‘ der Erde – NautikNautik und KartografieKartografie – angeblich unverständlich bleiben müssen. Und daher, so lautet das Postulat, bedarf es der Kürzungen und Vereinfachung des Textes. Fingierte, zwei ‚Erd-Techniken‘ betreffende Streichungen stellen also den Modus dar, unter dem die literarische Befahrung der Erde den Lesern der Travels allererst präsentiert wird. Der Text unterstreicht damit die Tatsache, dass Reiseerzählungen aus einem Verbund an (Macht-)Techniken hervorgehen, die sich auf die Erde beziehen. Denn Nautik und Kartografie sind eng mit kolonialen und imperialen Praktiken verknüpft, insofern sie die Bedingung der Möglichkeit europäischer ExpansionExpansion darstellen. Beide Techniken werden für den Leser gleich doppelt ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: einmal, indem eine fingierte Streichung inszeniert wird, ein anderes Mal, durch die dennoch im Text anzutreffenden Passagen, die sich mit eben diesen zwei Techniken eingehend beschäftigen.3 Die Rolle von Nautik und Kartografie, welche Fernwirkungszusammenhänge ermöglichen bzw. herstellen, tritt so in den Fokus. Noch vor seinem Beginn wird der Text im Rahmen expansiver Prozesse lokalisiert – Prozesse, deren Tendenz zur Unsichtbarkeit vom Text offenbar gemacht wird.
Der Text stellt also eine fingierte Reduktion aus, der allzu technische Details zum Opfer fallen. Diese Reduktion ist in ihrer Form autoreflexiv, insofern sie mit dem Fiktionscharakter der Literatur (von dem zur Zeit Swifts freilich noch nicht in diesen Worten die Rede ist) spielt. Der Name des Lektors, der den Paratext unterzeichnet, „Richard Sympson“, verweist gleichermaßen auf den realen Herausgeber Richard Simpson, der einige Texte Swifts publizierte, und William Symson, Autor des „largely plagiarized A Voyage to the East Indies“ (Swift, Travels 6, Fußnote 6). Die Travels reihen sich so bewusst ein in die allzu lange Kette von Reiseberichten fragwürdiger Qualität und Authentizität, welche „during this ‘Silver Age of Travel’“ (Bracher 59) den Buchmarkt überschwemmen.4 Der Bezug zu GanzheitGanzheit ist in diesem Paratext bereits in eine spezifische Form gegossen: NautikNautik und KartografieKartografie sind hier das Medium einer literarischen Selbstreflexion, über die das Verhältnis zwischen Text und Erde austariert wird; im Modus eines ausgestellten Fingiert-Seins wird auf die Mittelbarkeit von Reiseerzählungen reflektiert.
2.3.2 Lokalisierung der ‚Nationen‘
Die vier Teile der Travels verbindet, dass alle in ihrem Verlauf besuchten Orte kartografisch auf der Erde verortet werden. Bekanntlich steht am Anfang jedes der vier Teile des Textes eine Karte, die das Geschehen geografisch lokalisiert.1 Der unbekannte Zeichner der Karten in den Travels hatte bei seiner Arbeit wohl mit einigen Problemen zu kämpfen, da die Präzision der kartografischen Verortungen im Text starken Schwankungen unterliegt bzw. in manchen Fällen sogar schlicht mit dem kartografischen Wissen der Zeit nicht in Einklang zu bringen ist.2 Zu einem Zeitpunkt, an dem die konkreten Konturen aller KontinentKontinente und Inseln der Erde noch lange nicht in allen Details erfasst sind und die Weltkarte noch weiße Flecken enthält (vgl. Stockhammer, Kartierung 92), lokalisieren die Travels die Darstellung von Gesellschaften (d.h.: die Inseln, Halbinseln und Kontinente, auf denen Gulliver fremde nations entdeckt) in eben diesen (noch) nicht kartografierten Regionen. Der unabgeschlossene Prozess der Kartierung der Erde stellt also die ‚Bedingung der Möglichkeit‘ dieses spezifischen Textverfahrens dar, insofern der konkrete Stand der kartografischen und damit immer auch kolonialen Erschließung der Erde die Verortung und den Umfang der möglichen Projektionsflächen definiert: die weißen Flecken auf der Weltkarte. Durch diese Lokalisierung wird insofern auf die GanzheitGanzheit reflektiert, als sie den expansiven Prozess der Erschließung der Erde – zu einem spezifischen Zeitpunkt in seinem Verlauf – getreu abbildet. Zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt wäre die Lokalisierung der ‚Nationen‘ nicht auf die exakt gleiche Art möglich.
Benedict Anderson spricht in Imagined Communities davon, dass die inszenierten Orte der Travels realen ‚Entdeckungen‘ nachempfunden seien:
Francis Bacon’s New Atlantis (1626) was perhaps new above all because it was situated in the Pacific Ocean. Swift’s magnificent Island of the Houyhnhnms (1726) came with a bogus map of its South Atlantic location. (The meaning of these settings may be clearer if one considers how unimaginable it would be to place Plato’s Republic on any map, sham or real.) All these tongue-in-cheek utopias, ‘modelled’ on real discoveries, are depicted, not as lost Edens, but as contemporary societies. One could argue that they had to be, since they were composed as criticisms of contemporary societies, and the discoveries had ended the necessity for seeking models in the vanished antiquity. In the wake of the utopias came the luminaries of the Enlightenment, Vico, Montesquieu, Voltaire, and Rousseau, who increasingly exploited a ‘real’ non-Europe for a barrage of subversive writings directed against current European social and political institutions. In effect, it became possible to think of Europe as only one among many civilizations, and not necessarily the Chosen or the best. (Anderson 69f.)
Anderson beschreibt, dass das Spezifische der im 17. und frühen 18. Jahrhundert18. Jahrhundert (Welt-System) geschriebenen „Utopien“ in deren real-kartografischer Lokalisierung und eindeutigem Bezug zu zeitgenössischen „real discoveries“ besteht. Damit werden die neu entdeckten Regionen der Erde gleich doppelt ausgebeutet: Nicht nur werden sie zu Kolonien Europas, sie dienen zusätzlich dem Vorstellen von alternativen (auf Europa kritisch bezogenen) Gesellschaftsentwürfen. Mit der Klassifizierung der Travels als „tongue-in-cheek“ Utopie gibt Anderson freilich eine diskutable Beschreibung der Travels, die jedoch insofern völlig einwandfrei ist, als sie den intertextuellen und parodistischen Charakter der Travels betont, der ihr wesentlichstes Merkmal ist.
Der affirmative Charakter des Verwendens von kartografischen Diskurselementen darf dabei jedoch auch nicht überschätzt werden. Der Text generiert kartografische Präzision zumeist nur gerade so weit, wie nötig ist, um sie in einem zweiten Schritt überraschend enttäuschen zu können. Der Status der KartografieKartografie im Text ist damit von ambivalentem Charakter, insofern über sie einmal ein spezifischer Stand in der Erschließung der Erde abgebildet wird und andererseits die (schwankende) Präzision dieser Abbildung satirische Züge trägt.
Zusätzlich jedoch können die in den ‚Nationen‘ angetroffenen Bewohner (die verkleinerten Lilliputians und die vergrößerten Brobdingnagians der ersten zwei Teile, die ‚entstellten‘ Bewohner Laputas, sowie die Yahoos und die Hounynhms der letzten beiden) in einem erheblich viel kleineren Raum lokalisiert werden, als in den noch nicht kartografierten Regionen der Erde. Denn Dennis Todd macht deutlich, dass sämtliche ‚Anblicke‘, denen Gulliver auf seinen Reisen begegnet, im Rahmen von „tourist sights, public entertainments, shows, spectacles and exhibitions in the streets and at the fairs of London“ (Tod 396) beobachtet werden konnten. Diese Londoner Shows zeigten, als Teil einer populären Straßenkultur, Miniaturen (von Stadtansichten, Schlachten etc.), Zwerge, Riesen, Menschen mit vermeintlich ‚tierischen‘ Merkmalen und – nicht zuletzt – überraschend ‚intelligente‘ Pferde, die Kunststücke vorführen.3 Dies lässt sich in weiten Teilen als Kommodifizierung des Anderen beschreiben. London4 liefert seinem Straßenpublikum also Anblicke, die dem Leser der Travels allzu vertraut vorkommen müssen. So werden beispielsweise auch ‚Kannibalen‘ aus weit-entfernten Teilen der Erde, die nach London verschleppt wurden, ‚ausgestellt‘.5 Die Praktiken des Ausstellens sind somit eng mit kolonialen und damit transkontinentalen Kontexten verbunden. So gesehen charakterisieren die Travels durch die Verortung der sprechenden Pferde, Riesen etc. in weitentfernten Regionen der Erde London verstärkt als Zentrum eines expandierenden Imperiums, dessen ‚Straßenkultur‘ als Ergebnis kolonialer Praktiken erkennbar wird.
Die Lesart Andersons lässt sich also mit der Todds verbinden. Denn die Travels projizieren Londoner Ereignisse auf die weißen Flecken der Weltkarte, und stellen so die Verbindung zwischen den „real discoveries“ (s.o.) und dem Londoner Stadtleben aus; es handelt sich um ein Ganzes. Die Prozesse des expandieren Welt-SystemWelt-Systems erscheinen im Spannungsverhältnis zwischen einer lokalen Kultur (des imperialen Londons) und der kartografischen und kolonialen Erschließung der Erde.6
Vor diesem Hintergrund muss auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass Gulliver im Erzählen vom heimatlichen England dieses mitnichten als geschlossenes Territorium eines Staates darstellt, so wie hier, bei der Beschreibung die Gulliver dem König Brobdingnags gibt:
I BEGAN my Discourse by informing his Majesty that our Dominions consisted of two Islands, which composed three mighty Kingdoms under one Sovereign, besides our Plantations in America. I dwelt long upon the Fertility of our Soil, and the Temperature of our Climate. (106/II.6)
Die „Plantations in America“ werden explizit erwähnt. Aus der Perspektive einer in ihren ‚unentdeckten‘ Teilen besuchten Erde heraus wird ‚England‘ in den kolonialen Zusammenhang gestellt. Dies geschieht wiederholt und in allen vier Teilen der Travels.
2.3.3 Kartografischer Maßstab und „Erzählprojektion“
„Parody […] works by exacerbating and ridiculing incongruities of scale, as we know from probably the most famous satirical work of all time, Swift’s Gulliver’s Travels“ (Aravamudan 237). Über diese grundsätzliche Beschreibung hinaus können die Teile I und II der Travels – ausgehend von Frederick Bracher – als mit kartografischen Mitteln erzählte Reisen verstanden werden. Denn die ersten beiden Reisen der Travels sind nach einem MaßstabMaßstab (Kartografie) – 1:12 bzw. 12:1 – gestaltet: In Lilliput ist alles zwölfmal kleiner, in Brobdingnag alles zwölfmal größer als in europäischen Ländern; dies betrifft, neben den Bewohnern, auch die Architektur, Flora und Fauna.1 Es handelt sich also nicht um eine ‚phantastische‘ Reise zu schlechterdings oder unbestimmt großen/kleinen ‚Nationen‘, sondern um eine kartografisch informierte Art der Darstellung. Diese „schlägt mit der Konstruktion dieser Inseln zugleich eine neue Variante des kartographischen Verfahrens vor: eine Erzählprojektion.“ (Stockhammer, Kartierung 101f.). Über den Bezug auf den Maßstab als kartografisches Mittel zur Erfassung der Erde ist in den Teilen I und II der Travels in der Darstellung aller Wesen und Dinge immer ein spezifischer Bezug auf die GanzheitGanzheit eingeschrieben – ein Bezug, der sich mit Stockhammer als ‚Erzählprojektion‘ bezeichnen lässt. „Scale becomes a method for Swift“ (Aravamudan 237).
Über das maßstabsgebundene Darstellungsverhältnis in den Teilen I und II ist etwa die Darstellung von zwölffach vergrößerten Bettlern in Brobdingnag (mit der der Text vor allem Bezug nimmt auf die Situation in IrlandIrland (im kolonialen Kontext))2 immer schon in eine Perspektive eingebunden, die eine größere GanzheitGanzheit im Blick hat.
One Day the Governess ordered our Coachman to stop at several Shops, where the Beggars, watching their Opportunity, crowded to the sides of the Coach, and gave me the most horrible Spectacle that ever an European Eye beheld. […]. But the most hateful Sight of all was the Lice crawling on their Cloaths. I could see distinctly the Limbs of these Vermin with my naked Eye, much better than those of a European Louse through a Microscope, and their Snouts with which they rooted like Swine. (93f./II.4)
Das Mittel des Maßstabes, über das die GanzheitGanzheit der Erde kartografisch darstellbar wird, lässt den Bettler vergrößert, und damit in schmerzvoll offensichtlichen Details, erscheinen. Der Zustand körperlichen Elends und hygienischer Verwahrlosung wird so zu einem überwältigenden3 Anblick, der jedoch in Relation gesetzt wird zum europäischen Raum, insofern Gulliver auf seine Wahrnehmung als die eines „European Eye“ referiert und die Parasiten vergleicht zu einer „European Louse“.
Der Körper Gullivers und der anderen inszenierten Figuren gewinnt in den beiden ersten Teilen des Textes ein Potenzial für verschiedenste Bedeutungen (politisch-soziale,4 gegenderte5 etc.), deren Spezifik sich stets nur im Kontext des genannten kartografischen Rahmens verstehen lässt, insofern dieser die Art der Darstellung durch und durch bestimmt.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.