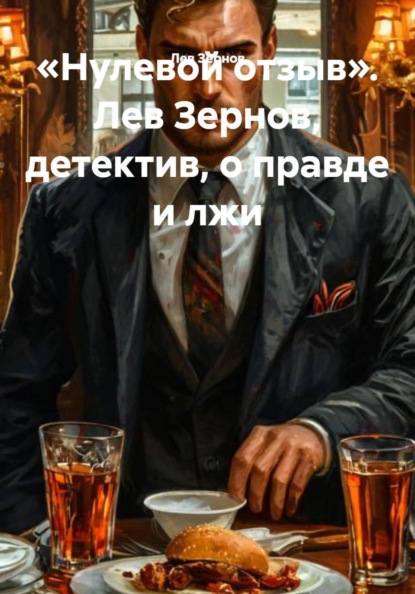- -
- 100%
- +
In Sanandaj trafen noch viele andere Bussen ein. Sie kamen aus allen möglichen Städten Kurdistans. Wir trafen dort Schüler, die anders waren als wir. Auf der einen Seite waren sie frech, auf der anderen aber auch sehr schick. Sie gaben sich selbstbewusst und die Mädchen waren irgendwie freier als unsere Mädchen. Sie trugen Make-up, ihre Augen waren geschminkt und die Lippen rot. Ich bewunderte unsere Mädchen, denn sie versuchten sich vor den anderen zu verstecken, weil sie sich armselig fühlten. Zu der Gruppe der uns fremden Schüler gehörten einige Musiker mit verschiedenen Instrumenten. Wir hatten keine Chance, mit denen konnten wir nicht mithalten.
Die Stimme eines der Lehrer erklang durch einen Lautsprecher. „Wir fahren alle zusammen mit vier großen Bussen weiter. Die Fahrt geht über mehrere Hundert Kilometer, aber wir machen alle paar Stunden eine Pause. Zuerst fahren wir nach Mashhad zu dem Grab von Imam Reza und beten. Von dort aus geht es weiter zu dem Camp in Nischapur.“ Auf allen vier Bussen klebte ein Plakat mit der Aufschrift „Schulkarawane aus Kurdistan“. So fuhren wir über die Autobahnen zu unserem Ziel.
Unterwegs spielten Sanandajs Schüler Musik, zu der wir alle sangen. Später hielten wir an einer Raststätte und machten eine halbe Stunde Pause. Die Lehrer hatten inzwischen Essen und Getränke an uns verteilt. Jeder bekam eine kleine Tüte mit einem belegten Brötchen und einer Dose Cola. Als ich genüsslich in mein Brötchen biss, kam Nasrin zu mir und sagte: „Ich muss mit dir reden.“ Sie sprach gleich weiter: „Hast du gesehen, dass die Pishahang von Sanandaj alle miteinander befreundet sind? Die Jungs haben alle eine Freundin und die Paare gehen Hand in Hand. Wir beide müssen auf dieser Reise zusammenhalten und du passt bitte auf mich auf.“
Ich erwiderte: „Warum soll ich auf dich aufpassen? Warum kommst du ausgerechnet zu mir? Soll sich doch ein anderer um ich kümmern.“
Nasrin bettelte weiter: „Ich freue mich, bei Imam Reza zu beten. Es war schon immer mein Traum, ihm meine Wünsche zu sagen, damit sie in Erfüllung gehen. Aber ich habe Angst, dass mir etwas passiert. Ich habe ein schwaches Herz und gerate in Menschenansammlungen leicht in Panik. Wenn ich umfalle und bewusstlos werde, wer soll mir dann helfen?“
Ich lenkte ein. „Gut, ich passe auf dich auf, hab keine Angst.“
Sofort erklärte sie mir: „Wenn ich umfalle, musst du mich von Mund zu Mund beatmen.“
Ich fragte mich, was Nasrin plante. Während ich grübelte, sah ich ein Sanandaj-Mädchen am Rand der Autobahn stehen. Sie hatte sich von der Schülergruppe gelöst, war dorthin gelaufen, hatte ihre Bluse hochgezogen und zeigte sich so den vorbeifahrenden Autofahrern, die begeistert waren und große Augen machten. Alle Schüler lachten und klatschten, weil die Autofahrer sich nicht mehr auf das Fahren konzentrierten. Und so kam es, wie es kommen musste: Einige Autos fuhren ineinander und es gab einen Unfall.
Die Lehrer reagierten schnell, holten das Mädchen zurück und schimpften mit ihr.
Unter uns Schülern löste das Ereignis eine große Diskussion aus. Wir waren der Meinung, dass dieses Verhalten für uns Kurden eine Schande war. Was sollen die Menschen nur von uns denken? Die Busse waren ja plakatiert. Andere meinten, wir hätten die Perser verarscht und den Unfall verursacht. Das zeigte wieder einmal: Wir waren Kurden, die waren Perser, und wir waren nicht das gleiche Volk. Dieses Beispiel verdeutlichte den Unterschied in unserem Land, den Unterschied zwischen Reich und Arm (Machthaber und Besatzungsland). Wir Schüler fragten uns ständig: Warum war es hier anders? Hier war es viel schöner als bei uns. Seit der letzten Stadt, die wir in Kurdistan passiert hatten, war alles anders. Hier gab es gut ausgebaute Autobahnen mit besseren Straßenschildern, hübsche Gebäude und im Vorbeifahren sahen wir überwiegend neue Autos. Bei uns in Kurdistan wurden meist alte Autos gefahren und Autobahnen gab es nur wenige. Was die Kultur betraf, so waren wir jedoch etwas freier als die Perser, nicht so abergläubisch. Das öffnete mir die Augen und in meinem Gedanken ging es mir um Gerechtigkeit, wie bei Hajeje Uhlhassan, der Analphabet war und nicht persisch sprechen konnte, weil das nur in der Schule gelehrt wurde, die er aber nie besucht hatte. Wie ungerecht war das für ihn!
Ich war tief in Gedanken versunken, als der Reiseführer uns darüber informierte, dass wir gleich das heilige Grab von Imam Reza erreichen würden. „Wir bleiben eine Stunde. Seid bitte pünktlich wieder hier. Danach reisen wir zu unserem Camp.“
Wir stiegen aus den Bussen und gingen zum Haram Imam Reza. Das Dach des Hauses war eine riesengroße, goldene Kuppel, es war eine gigantische Residenz! So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ein riesiger Palast in Gold gehüllt. In der großen Halle war das Grab vom Imam. Es war von goldenen Gittern umrahmt. Da waren Tausende Gläubige, die ihre Gebet oder Wünsche vor sich hin murmelten. Ich war verwundert, dass so viele Menschen den Imam kannten und um ihn weinten, obwohl er doch bereits vor mehreren Jahrtausenden ermordet worden war. Ich beobachtete die Gläubigen. Eine Frau hatte etwas hinter das Goldgitter geworfen. Das machte mich neugierig und ich traute meinen Augen nicht, als ich näher hinsah. Da lagen zahlreiche große Geldscheine, goldene Ringe, Goldketten. Ich überlegte. Davon ließen sich in Kurdistan Krankenhäuser und Schulen bauen oder man könnte mit diesem Geld Dörfer mit Strom und fließendem Wasser versorgen. Aber ich war nur ein Kind und hatte keine Ahnung.
Meine Gedanken wurden von Nasrin gestört, die mich laut rief. Nein, sie schrie! Sie schrie tatsächlich um Hilfe. Ein großer Mann hatte Nasrin an das Goldgitter gepresst und wollte sich von hinten an sie drücken. Alle, die rundherum beteten, hoben die Hände nach oben und drängten in einer Masse zusammen. Mit meiner Faust schlug ich auf den großen Mann ein, schrie und schimpfte: „Was machen Sie mit meiner Schwester?“
Der Mann fragte: „Sie ist deine Schwester? Dann ist sie auch meine Schwester.“
Als Nasrin ohnmächtig auf den Boden sank, ließ der Mann endlich von ihr ab. Ich bekam Angst und wusste nicht, was ich tun sollte. Hektisch fragte ich eine alte Frau: „Können Sie helfen!“ Sie schaute mich an und schüttelte den Kopf. Dann gab sie Nasrin etwas zu trinken aus ihrer Wasserflasche und spritzte ein paar Tropfen Wasser über ihr Gesicht. Nasrin kam zu sich, rappelte sich auf und schaute mich verwirrt an. Nach all diesen Eindrücken und Erlebnissen würde mir der Ort Mashhad in Erinnerung bleiben.
Später erzählte ich in Marivan Jewad von diesem Ereignis. Er lachte mich aus. „Hussein, du bist ein Dummkopf, warum hast du sie nicht beatmet.“ Sie wollte doch nur, dass du sie küsst!“ Aber ich dachte nur an das Mädchen zwei Reihen vor mir.
Die Busfahrt ging weiter und wir fuhren als kurdische Karawane unserem nächsten Ziel entgegen, dem Camp. Die anderen drei Busse waren hinter uns. Es war so schön, im Vorbeifahren die Landschaft zu betrachten. Alles in dieser Umgebung war in ein faszinierendes Grün gehüllt, so als hätte Gott mit der Natur ein Geschenk vollbracht. Die vielen Obstbäume und die gepflegten Felder waren traumhaft. In dieser Gegend gab es auch im Sommer Regen. Dadurch war es immer feucht, sodass die Landwirtschaft erblühen konnte. Die Straßen sahen aus wie Alleen, denn sie waren von hohen Bäumen gesäumt. Ein leiser Wind wehte durch die halb offenen Fenster in unseren Bus und verstärkte das aufkommende Gefühl von Ferien. Wir waren neugierig und gleichzeitig gespannt, welche Abenteuer uns im Camp erwarten würden.
Endlich erreichten wir das Camp. Man zeigte uns die Plätze, die für uns vorgesehen waren. „Richtet euch in euren Unterkünften ein, packt eure Koffer aus und bezieht eure Betten. Die Lehrer bringen euch später zum Camp-Zentrum“, sagte unser Betreuer.
Neugierig schaute ich mich im Camp um. Es war eine riesengroße Anlage mit vielen schmalen Straßen, an deren Rand Blumen wuchsen. Alles sah sehr gepflegt aus. Ich suchte nach Zelten, jedoch waren unsere Unterkünfte kleine Hütten wie bei unseren Bauern in Kurdistan, aber aus neuerem Material wie Aluminium und Holz. Zudem waren sie auch noch bunt. Eine Seite war blau, gegenüber war die Außenwand rot und die linke Seite einer Hütte war gelb. Vielleicht waren die Farben so ausgewählt, weil sie die Farben jeder Stadt oder des Landes darstellen sollten. Neben jeder sechsten Hütte stand ein kleines Haus, das mit Schildern versehen war. Es waren die sanitären Anlagen mit Dusche, Toiletten und Waschmöglichkeiten. Beim Zähneputzen konnte man sich im Spiegel betrachten. Ich war erstaunt. Alles war so schick und sauber. So etwas hatte ich in unserer Stadt noch nie gesehen. Meine Gedanken kreisten und ich fragte mich, wer hat das alles gebaut hatte. In jedem Häuschen befanden sich zwei Betten, zwei kleine Schränke und sogar ein kleiner Kühlschrank.
Voller Staunen konzentrierte ich mich kurz darauf auf unseren Lehrer. Er sagte: „Ihr zwei, Hussein und Mohamed Pänahy, geht in das Haus Nummer 208.“ Wir beide schauten uns an, griffen freudig nach unserem Gepäck und bezogen unser Haus. Wir waren neugierig und voller Erwartung. Mohamed, der größer und kräftiger war als ich, warf seinen Koffer auf das Bett, war der Erste am Kühlschrank, griff sich etwas Essbares und stopfte sich den Mund voll. Ich dachte: Was ist das für ein Kamerad, der erst einmal etwas für sich nimmt? Er sprach mich an: „Lass uns ganz unkompliziert beim Vornamen nennen, Hussein. Du kannst mich Mohamed nennen. Lassen wir den Unsinn mit den Nachnamen. Soll ich dir was verraten? Ich habe etwas Schnaps von zu Hause mitgebracht, weil der hier bestimmt verboten ist.“ Er versteckte ein paar Flaschen hinter seinem Bett und beschwor mich, niemandem etwas davon zu erzählen. Ich musste etwas unsicher gewirkt haben, denn er sagte: „Wir sind eben schon moderner als ihr aus Marivan, aber wir sind alle Kurden. Meine Freunde aus der Schule haben alle einige Flaschen mitgebracht. Wir sind doch hier in den Ferien, um Spaß zu haben. Wir werden nachts bestimmt viel diskutieren, über unser Volk und dessen Ungerechtigkeiten in diesem Land.“ Ich stimmte ihm zu. Ja, ja, wir waren in den Ferien. Gleichzeitig machte ich mir Gedanken, welche Menschen ich hier noch kennenlernen würde.
Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt hatte und etwas Obst gegessen hatte, liefen Mohamed und ich zur Zentralstation des Camps. Dort trafen wir auf mehrere Hundert Jungen und Mädchen in ihren Uniformen aus verschiedenen Städten Irans.
In einem großen Saal der Zentralstation war der Oberste der Organisation auf der Bühne hinter ein Mikrofon getreten und begrüßte uns alle. Er erklärte uns, warum wir hier seien und welche Aktivitäten uns während der Ferienzeit erwarteten. Er wies darauf hin, was erlaubt und was verboten sei. Nachdem er einige Hinweise zu normalen Aspekten des menschlichen Miteinanders gegeben hatte, wies er strengstens darauf hin, dass jeglicher Genuss von Alkohol strikt verboten sei, und wenn jemand dabei erwischt werden sollte, gäbe es eine Strafe und einen Verweis aus dem Camp. Da ich kleiner war, schaute ich zu Mohamed hoch. Er zwinkerte und lächelte mir zu. Ich machte ein unschuldiges Gesicht, als wüsste ich nicht, was Mohamed mir zuvor in unserer Hütte erzählt hatte. Reden war bekanntlich Silber und Schweigen Gold.
Der Camp-Oberste in Uniform fuhr in seiner endlosen Rede fort: „Morgen kommen unsere Gäste aus Pakistan, Indien, Irak, Bangladesch und Japan. Ihr werdet ein Vorbild für unser Land sein, und wenn unsere Gäste nach den Ferien nach Hause fahren, werden sie nur Gutes über unser Land Iran und die Pishahang berichten. Ihr seid verpflichtet, Freundschaften mit euren Nachbarschülern zu schließen, damit sie unser Land nach den Ferien in guter Erinnerung behalten.“
Nach dem gemeinsamen Abendessen in der Kantine schlenderte ich mit Mohamed und einigen seiner Freunde in Richtung der Hütten. Einer der anderen sagte: „Wir ziehen uns um und besuchen euch in einer halben Stunde.“ Ich fragte Mohamed: „Was meinen deine Freunde damit?“ Er lachte: „Junge, wir sind Kurden, wir haben unsere eigene Kleidung, unsere eigene Tradition. Wir laufen doch nicht den ganzen Tag in der Pishahang-Uniform herum. Mach dir keinen Kopf, du wirst schon sehen.“
In unserem Zimmer wechselte ich die Pishahang-Uniform gegen Mohameds kurdischen Anzug, der etwas zu groß für mich war. Ich fand, dass ich in dieser Kleidung komisch aussah, weil die Ärmel und die Länge der Hose gar nicht zu meinem Körper passten. Aber ich bedankte mich bei Mohamed. Es fehlte das kurdische Tuch für meinen Kopf, sodass ich aus Verlegenheit das Pishahang-Tuch um meinen Hals wickelte. Mohamed betrachtete mich in meiner Verkleidung und sagte: „Hussein, diese Uniform steht dir besser.“
Plötzlich klopfte es an unsere Tür. Die Freunde von Mohamed waren gekommen. Sie waren zu fünft, und das Erste, was einer von ihnen Mohamed fragte, war: „Wer ist das?“ Dabei sah er mich prüfend an. Es war Huschiar, der uns gleich darauf wie auch die vier anderen begrüßte. Mohamed antwortete: „Liebe Freunde, das ist mein Zimmerkollege Hussein aus Marivan. Er hat keine kurdische Kleidung dabei und ich habe ihm etwas von mir geliehen. Die Kleidung ist zwar ein wenig zu groß für ihn, aber Not macht erfinderisch. Es steht ihm doch gut, oder?“
Alle seine Freunde, die es sich gerade in unserer Hütte gemütlich machten, trugen traditionelle kurdische Kleidung. Manche trugen sogar ihre Schuhe. Die Kelasch gehörten wie das Kopftuch zu unserer Tradition. Die Kleidung, die ich trug, war zwar zu groß, meine Schuhe passten nicht zur Kleidung und statt des kurdischen Kopftuches trug ich das rote Pishahang-Tuch um den Hals, aber so war ich erst einmal akzeptiert, was die Kleidung anbelangte. Es war für mich ein völlig neues Erlebnis, aber ich war sehr neugierig.
Huschiar sagte zu Mohamed: „Dies ist unsere erste Nacht im Camp und wir wollen Spaß haben. Also lasst uns einen Schluck Schnaps trinken. Wo ist die Flasche?“
Mohamed kroch unter sein Bett, holte eine Flasche hervor und reichte sie Huschiar.
Der fragte: „Haben wir keine Gläser? – Ach, das macht nichts. Wir nehmen alle einen Schluck aus der Flasche. Und wenn die leer ist, gehen wir alle zum Azerga.“ Er nahm einen großen Schluck aus der Schnapsflasche und reichte sie weiter.
Es war, als wollten wir uns für später Mut antrinken. Rezgar war der Nächste und die Flasche ging reihum, bis ich als Letzter einen großen Schluck trinken sollte. Ich tat so, als wäre es für mich eine Selbstverständlichkeit, aber ich hatte noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Ich empfand es als Mutprobe, denn ich wollte mich nicht vor den anderen blamieren. Ich wusste aus eigenen Beobachtungen, dass Alkohol nicht gut für den Körper war, weil er den Geist verwischte. Als mir die Flasche gereicht wurde, erinnerte ich mich an den Vater meines Freundes Jewad. Er war nach zu starkem Alkoholgenuss des Öfteren im Basar umgefallen. Jewad schämte sich sehr für seinen Vater, der häufig mit einer Schubkarre vom Basar nach Hause gebracht werden musste. Man stellte ihn vor der Tür ab und Jewads Mutter musste den Transport bezahlen. Das war mehr als peinlich für die ganze Familie. Es war armselig, wie der Mann im Leben abrutschte. Jedoch konnte man in die Seele eines Menschen nicht hineinschauen, dachte ich. Es konnte jedem passieren, alkoholkrank zu werden, zum Beispiel wenn es Probleme gab, die man nicht lösen konnte. Aber dieses Zeugs, das wusste ich, machte Konflikte im Grunde nur noch schlimmer.
Ich setzte die Flasche an und nahm einen großen Schluck, als hätte ich das schon hundert Mal gemacht. In meiner Brust wurde es auf einmal ganz heiß. Der Schnaps lief in meinen Magen und mir war hundeelend. Doch ich ließ mir nichts anmerken. Ich musste würgen, versuchte aber, es zu unterdrücken. Die Flasche kreiste weiter, und als sie endlich leer war, gingen wir alle fröhlich zum Azerga, dem Feuerlager.
Schon von Weitem hörten wir die Musik, und als wir näher kamen, erschien es mir, als wäre ich in einer anderen Welt.
Die Farben des Feuers tanzten vor meinen Augen, als mich Nasrin erblickte. Sie war traurig. „Woher hast du diese Kleidung?“, wollte sie wissen. „Ich habe kein schönes Kleid mitgebracht und kann nicht mit euch feiern.“ Sie hatte Tränen in den Augen.
Ich reichte ihr die Hand zum Tanz und sagte: „Nasrin, du bist auch ohne schönes Kleid ein wertvoller Mensch.“ Dann zog ich sie zum Feuer und wir gesellten uns zu den Tanzenden. Die Musiker spielten unsere kurdische Musik und mir war, als wäre ich losgelöst von allen Sorgen und Anstrengungen des Lebens. Jungen und Mädchen tanzten rund um das Feuer. Es war ein wunderschöner Anblick, die vielen tanzenden Menschen in kurdischer Kleidung und mit fröhlichen Gesichtern zu sehen. Alle Augen, die ich beobachten konnte, leuchteten wie glückliche Blitze und hatten ein Strahlen, als hätte man sich verliebt und würde auf einer Wolke schweben. Die Freiheit kannte keine Grenzen in diesen Glücksmomenten.
Viele der Jugendlichen waren mit ihrer Pishahang-Uniform gekommen. Aber wir Kurden trugen unsere traditionelle Kleidung und die kurdischen Mädchen zeigten sich in farbenfrohen, langen Kleidern, die im Wind um das Feuer wehten und ein wunderschönes Bild abgaben. Voller Romantik spiegelten sich die hübschen Mädchen mit funkelnden Augen hinter den Farben des Feuers. Es waren unbeschreibliche Bilder. Eine Augenweide im schnellen Rhythmus des Tanzes und unserer Lieder.
Immer mehr Pishahang, Türken und andere junge Leute gesellten sich zu uns und reihten sich in den Tanz rund um das Feuer ein. Einige von ihnen kannten diese Fröhlichkeit nicht, doch sie ließen sich bald davon anstecken. Wir alle waren plötzlich eins, wir sangen und tanzten. Bis spät in die Nacht hinein waren wir wie eine glückliche Familie. An diesem Abend gab es keinen Unterschied zwischen den Menschen und ihren Kulturen. Viele von den anderen kannten uns Kurden gar nicht, sie glaubten auch nicht, dass wir im Iran leben. Sie waren neugierig und wollten unsere Lieder und deren Inhalte verstehen lernen.
Es wurde spät, und wir alle gingen in unsere Unterkunft, denn es waren nur noch wenige Stunden bis zum nächsten Morgen. Ich fiel wie berauscht und glücklich in mein Bett und träumte die ganze kurze Nacht von diesem schönen Abend. Es war ein wunderschöner Traum, voller Zufriedenheit und Neugierde, was alles während unserer Ferien im Camp noch passieren würde. Als es Morgen wurde, träumte ich noch immer, jetzt aber anders. In meinem Traum hörte ich ein Lied und dachte in den Bildern meines Traumes, ich sei noch immer am abendlichen Feuerlager. Jedoch war das Lied ein anderes, es war nicht unsere Musik, nicht unser Tanz.
Vorsichtig öffnete ich nach dieser kurzen Nacht meine Augen und bemerkte, dass dieses Lied kein Traum war. Es klang nach der persischen Sprache und hatte auch keine Melodie. Jemand sprach über die Lautsprecher des Camps und weckte alle zum rechtzeitigen Aufstehen. Mit müden Augen schaute ich zu Mohamed, der noch im Tiefschlaf war. Schnell, aber vorsichtig weckte ich ihn. „Mohamed, wir müssen aufstehen. Es ist schon spät. Wir müssen uns anziehen und zum Frühstück in die Kantine laufen.“ Er reagierte sofort und wir eilten zum Waschhaus. Dort stellten wir uns gemeinsam an das Waschbecken, machten eine Katzenwäsche, putzen uns den Nachgeschmack des Alkohols aus dem Mund und schlüpften, als wir wieder in unsere Hütte zurückgekehrt waren, in Windeseile in unsere Pishahang-Uniform. Dann rannten wir los, um zu frühstücken.
Die große Kantine war schon voller Jungen und Mädchen. Wir entdeckten das große Büffet, nahmen uns ein Tablett und stellten uns an. Das Angebot an Speisen war sehr reichhaltig, es gab alles, was das Herz begehrte. Verschiedene Brotsorten, Käse, gekochte Eier, auch Wurst auf iranische Art, Marmelade, Honig, Milch und Orangensaft. Noch nie zuvor hatte ich Nahrungsmittel in dieser Dimension gesehen. Aber es musste ja auch für alle reichen. Ich war begeistert.
Mohameds Augen glänzten und er füllte sein Tablett im Überfluss. Er sagte: „Hussein, mach mir das nach, nimm alles, worauf du Hunger hast.“
Nachdem unser Tablett übervoll war, bahnten wir uns einen Weg an den Tischen vorbei in die hintere Ecke, wo wir auf Huschiar trafen. Er winkte uns und deutete damit an, dass an seinem Tisch noch Plätze frei seien. Huschiar schaute auf unsere Tabletts. „Mohamed, was hast du denn gemacht? Das kannst du nie im Leben alles aufessen, das reicht ja für zehn Personen!“ Mein Tablett war tatsächlich übervoll und ich schämte mich, weil ich das Gleiche tat wie Mohamed.
Mohamed, der sich ebenfalls angesprochen fühlte, lächelte nur und sagte: „Das ist doch egal, ich habe einfach zugeschlagen, weil ich noch nie so viele leckere Sachen auf einmal gesehen habe.“
Huschiar überlegte: „Eigentlich hast du recht, Mohamed. Auch ich habe so einen Überfluss noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, wer das alles finanziert. Aber hier kann man mal sehen, wie die Reichen leben.“
Wir saßen am Tisch und aßen alles, was unser Hunger erlaubte. Hossein, der sich zu uns gesellt hatte, sagte: „Auf der einen Seite bin ich froh, so viel Essen vor meinen Augen zu haben, aber wenn ich an zu Hause denke, an unsere Nachbarn, die acht Kinder haben – deren Vater ist Bauarbeiter und findet im Jahr sechs Monate lang keine Arbeit –, dann ist es traurig. Und seine Frau putzt bei anderen Leuten, durchstöbert auf dem Markt die Abfallkörbe nach verfaultem Obst und versucht auf dem Basar altes Brot zu finden. Ihre Kinder sind armselig gekleidet und tragen alte, gebrauchte Kleidung. Da werde ich nachdenklich und traurig.“
Wir alle hoben unseren Blick und stimmten Hossein zu. Was er erzählt hatte, machte jeden von uns nachdenklich.
Wir sahen meinen Lehrer aus Marivan auf unseren Tisch zukommen. „Störe ich euch?“ Als keiner von uns antwortete, fragte er: „Darf ich mich zu euch setzen?“
„Sie stören doch nicht“, sagte ich. „Bitte nehmen Sie Platz.“
Nachdem er uns gefragt hatte, wie es uns geht und ob es uns hier gefällt, rückte er mit seinem eigentlichen Anliegen heraus: „Wisst ihr, ich bin aus einem besonderen Grund zu euch gekommen. Gestern Abend habe ich eure Musik gehört, euch beim Tanzen gesehen und möchte mit euch darüber sprechen.“
Prompt und unaufgefordert reagierte Huschiar: „Wir haben einfach mit allen gesungen, getanzt. Und das Azerga-Feuer war für alle angezündet.“
Der Lehrer sagte: „Ja, aber ihr habt kurdische Kleidung angehabt.“
„Na und?“, entgegnete Huschiar. „Was soll daran falsch sein?“
„Ja“, sagte der Lehrer, „es war euer freier Abend und ich will nicht sagen, was daran falsch oder richtig war, ich möchte euch nur einen Ratschlag geben. Hört auf mich wie auf einen großen Bruder. Wir sind hier auf den Befehl von oben gekommen, und zwar mit dem Ziel, Kontakte zu anderen Schulen zu knüpfen, das Ministerium will es so. Ihr alle müsst auf euch achten. Es gibt hier geheimdienstliche Aufpasser der Savak.“ Mit diesen Worten ließ er uns allein. Im Stillen musste ich an Hajeje denken, den armen alten Mann, dem die Savak Finger- und Fußnägel ausrissen hatten. Die reinste Folter! Aber das behielt ich für mich.
„Was ist das für ein Lehrer?“, fragte Huschiar. „Er spricht persisch und nicht unsere Sprache, kurdisch.“
Ich entgegnete: „Das ist mein Lehrer aus Marivan. Er spricht nur persisch. Er gibt sich auch in der Schule sehr ängstlich. Wenn wir Kinder ihn auf der Straße treffen und grüßen, antwortet er immer nur kurz und knapp.“
„Was ist das für ein Kurde?“, ereiferte sich Huschiar. „Auf solche Feiglinge kann ich verzichten. Im Gegenteil, bei uns in Bane sprechen unsere Lehrer nur kurdisch mit uns. Und sie sind wie unsere Brüder. Nur in Ausnahmefällen, wenn es unbedingt nötig ist, sprechen sie persisch mit uns. Unser Lehrer ist schon oft zur Savak vorgeladen worden, aber er ist mutig und macht weiter. Mein Vater kennt seine ganze Familie, die politisch aktiv ist. Er hat mir auch gesagt, dass sein Großvater in Komala-J-Kaf war.“
Ich fragte ihn, was das sei, Komala-J-Kaf?
„Komala-J-Kaf ist eine Widerstandsbewegung in der Republik Mahabad, die gegen den Schah protestiert hat.“ Huschiar schaute mich an und sagte: „Junge, du musst noch viel lernen! Aber jetzt haben wir keine Zeit, wir müssen gehen. Mal sehen, was sie heute mit uns machen.“
Bevor wir die Kantine verließen, gaben wir unser Tablett zurück, auf dem noch so viel Essen lag, dass einige der Armen in unserer Stadt davon satt geworden wären. Aber man konnte es ja nicht sammeln und dort hinschicken, dachte ich.