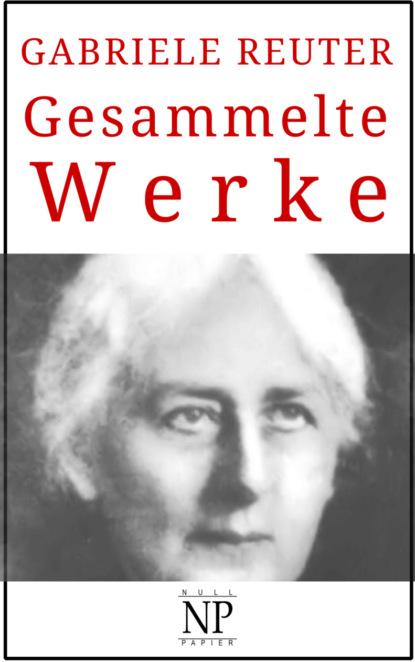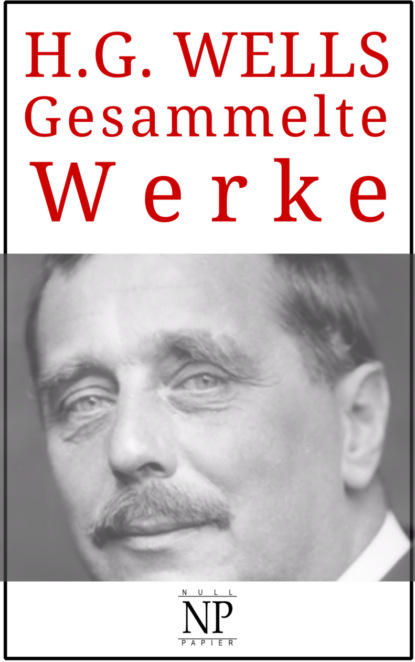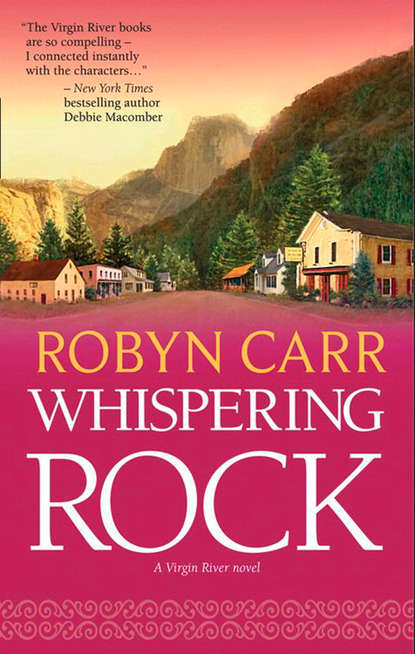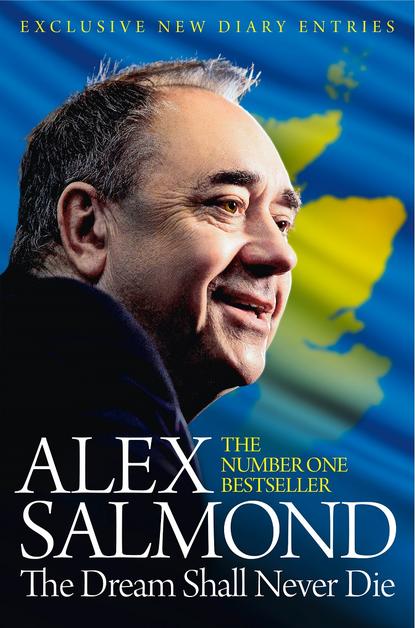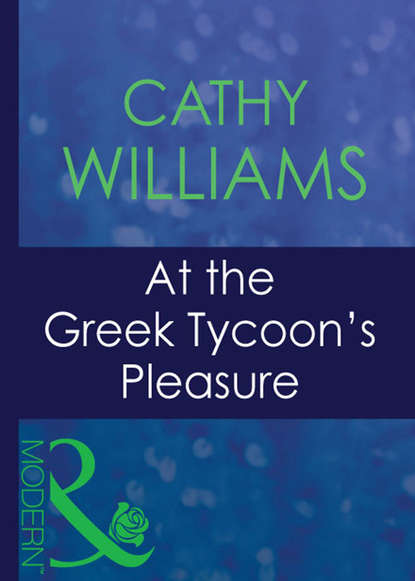Hans Fallada – Gesammelte Werke

- -
- 100%
- +
Aber wie so oft schon vorher und nachher hatte der Minister mit seinem ersten Artikel die niedersten Pöbelinstinkte wachgerufen, und Anna Quangel sah hier ohne Weiteres ihre Möglichkeiten. Zwar wohnten in ihrem Bezirk meist nur schlichte Leute, aber eine Dame wusste sie doch, auf die jene Beschreibung des Ministers haargenau passte. Anna Quangel lächelte schon im Voraus bei dem Gedanken, welche Wirkung ihr Besuch wohl haben würde.
Die von ihr aufgesuchte Dame wohnte in einem großen Hause am Friedrichshain, und Frau Quangel sagte zu dem öffnenden Mädchen mit Barschheit, durch die sie ihre eigene, sie plötzlich heimsuchende Unsicherheit verstecken wollte: »Ach was, nachsehen, ob die gnädige Frau zu sprechen ist! Ich komme von der Frauenschaft, und ich muss sie sprechen, und ich werde es auch! – Übrigens, Fräulein«, setzte sie plötzlich mit gesenkter Stimme hinzu, »wieso gnädige Frau? So was gibt es doch im Dritten Reich gar nicht mehr! Wir arbeiten alle für unsern geliebten Führer – jedes an seinem Platz! Ich will zu Frau Gerich!«
Es bleibt ungewiss, warum Frau Gerich diese Gesandtin der NS-Frauenschaft empfing, ob doch leise beunruhigt durch den Bericht ihres Mädchens oder ob einfach aus Langerweile, die halbe Stunde eines öden Nachmittags zu verkürzen. Jedenfalls empfing sie Frau Quangel.
Sie kam ihr mit einem liebenswürdigen Lächeln bis in die Mitte ihres üppigen Salons entgegen, und Frau Quangel stellte mit einem Blick fest, dass Frau Gerich wirklich das Geschöpf war, das sie suchte: eine langbeinige Blondine, zurechtgemacht und parfümiert, über der Stirn ein hoher Aufbau von Locken und Löckchen. Die Hälfte davon falsch!, entschied Anna Quangel sofort. Diese Feststellung gab ihr ein wenig von ihrer Sicherheit zurück, die beim Anblick dieses wirklich prachtvollen Zimmers ins Wanken gekommen war, eines Zimmers, wie es mit Seidenteppichen, Couches, Sesseln und Sesselchen, Tischen und Tischchen, mit Wandbehängen und einer Unzahl blitzender Beleuchtungskörper Anna Quangel noch nie in ihrem Leben gesehen hatte, selbst nicht bei jenen wirklich feinen Herrschaften, bei denen sie vor mehr als zwanzig Jahren in Stellung gewesen war.
Die Dame begrüßte Anna Quangel gebührend, aber nur mit einer lässigen Erhebung des Armes: »Heil Hitler!« Ernst und genau korrigierte Anna Quangel durch ihr zackiges »Heil Hitler!« diese Nachlässigkeit.
»Sie kommen von der NS-Frauenschaft, wie ich höre, Frau –?« Die Dame wartete einen Augenblick, da ihr aber kein Name genannt wurde, lächelte sie unmerklich und sagte: »Aber bitte, nehmen Sie doch Platz! Sicher handelt es sich um eine Spende – ich gebe gerne, soweit es mir möglich ist.«
»Es handelt sich um keine Spende!« Anna Quangel stieß diese Worte fast zornig hervor. Sie empfand plötzlich eine tiefe Abneigung gegen dieses bildschöne Geschöpf, das doch nur ein Weibchen war und das nie Frau und Mutter werden würde, wie es Anna Quangel gewesen war und noch war. Sie hasste und verachtete die andere, weil sie nie jene Bindungen anerkennen würde, die Anna Quangel stets heilig und unverletzlich erschienen waren. Dieser da war alles nur ein Spiel, zu wahrer Liebe war sie völlig unfähig, und nur auf jene Beziehungen legte sie Wert, die Anna in ihrer Ehe mit Otto Quangel stets als einen ganz unwesentlichen Teil dieser Ehe erschienen waren. »Nein, keine Spende!«, stieß sie noch einmal ungeduldig hervor. »Sondern es handelt sich darum –«
Sie wurde noch einmal unterbrochen. »Aber bitte, nehmen Sie doch wirklich Platz! Ich kann doch nicht sitzen bleiben, wenn Sie hier stehen, und Sie als die Ältere …«
»Ich habe keine Zeit!«, sagte Anna Quangel. »Wenn Sie mögen, dann stehen Sie auf, sonst können Sie auch ruhig sitzen bleiben. Mir macht das nichts aus!«
Frau Gerich kniff die Augen ein wenig zusammen und musterte erstaunt diese biedere Frau aus dem Volke, die mit solcher Brutalität gegen sie vorging. Sie zuckte leicht mit den Achseln und sagte, immer noch liebenswürdig, aber nicht mehr ganz so verbindlich: »Ganz nach Ihrem Wunsch! Ich werde also sitzen bleiben. Sie wollten sagen …«
»Ich will Sie fragen«, sagte Frau Quangel entschlossen, »warum Sie nicht arbeiten? Sie haben doch sicher die Aufrufe gelesen, dass jeder in der Rüstungsindustrie arbeiten soll, der noch keine Beschäftigung hat? Warum arbeiten Sie also nicht? Was haben Sie für Gründe?«
»Ich habe den sehr guten Grund«, sagte Frau Gerich jetzt mit heiterer Gelassenheit und betrachtete nicht ohne Spott die verarbeiteten, vom Gemüseputzen verfärbten Hände der anderen, »dass ich noch nie in meinem Leben körperlich gearbeitet habe. Ich bin in keiner Weise für körperliche Arbeit geeignet.«
»Haben Sie es denn je versucht?«
»Ich denke gar nicht daran, mich durch einen solchen Versuch krank machen zu lassen. Ich kann jederzeit ein ärztliches Attest beibringen, dass –«
»Das glaube ich!«, unterbrach sie Frau Anna Quangel. »Ein Attest für zehn oder zwanzig Mark! Aber bei dieser Sache sind nicht die Atteste gefälliger Privatärzte gültig, sondern der Fabrikarzt des Betriebes, dem Sie zugewiesen werden, wird über Ihre Arbeitsfähigkeit entscheiden!«
Frau Gerich betrachtete für einen Augenblick das zornige Gesicht der Frau. Dann zuckte sie die Achseln. »Also schön, weisen Sie mich irgendeinem Betriebe zu! Sie werden ja sehen, was Sie davon haben!«
»Das werden Sie sehen!« Anna Quangel holte ein Heft hervor, ein in Wachstuch eingeschlagenes Heft, wie es die Schulkinder benutzen. Sie trat an ein Tischchen, schob ärgerlich eine Schale mit Blumen beiseite und feuchtete, ehe sie mit Schreiben anfing, den Bleistift mit der Zungenspitze an. Sie tat das alles bewusst, sie wollte die andere reizen; sie konnte nicht eher den Zweck dieses Besuches für erfüllt ansehen, ehe sie nicht die spöttische Gelassenheit der anderen zerschlagen und auch sie in Zorn gebracht hatte.
Was war der Vater gewesen? Tischlermeister, so – und dann im ganzen Leben nie körperlich gearbeitet! Nun ja, wir werden ja sehen. Wie groß ist denn hier der Haushalt? Drei Personen? Die Hausangestellte mit eingerechnet? Also eigentlich zwei Personen …
»Können Sie wirklich nicht Ihren Mann allein versorgen? Noch ein Mensch mehr der Rüstungsindustrie entzogen, werde ich mir auch notieren! Kinder haben Sie natürlich keine?«
Der anderen schoss jetzt auch das Blut in die Wangen, man sah es aber nur an den Schläfen, so gemalt war sie. Aber eine Ader über die Stirn weg zur Nasenwurzel hin fing an zu schwellen und zu klopfen.
»Nein, Kinder natürlich keine!«, sagte Frau Gerich jetzt auch sehr scharf. »Aber Sie können sich noch notieren, dass ich mir zwei Hunde halte!«
Anna Quangel richtete sich steif auf und sah die andere mit düster glühenden Augen an. (In diesem Augenblick hatte sie vollkommen vergessen, warum sie diesen Besuch gemacht hatte.) »Sagen Sie mal!«, rief sie und gab ihrer Stimme absichtlich einen gewöhnlichen Klang. »Wollen Sie mich und die Frauenschaft verhöhnen? Wollen Sie sich etwa über die Arbeitsbestimmungen und unsern Führer lustig machen? Ich warne Sie!«
»Und ich warne Sie!«, schrie Frau Gerich dagegen. »Sie scheinen nicht zu wissen, bei wem Sie sind! Ich und mich über eine Bestimmung lustig machen! Mein Mann ist Obersturmbannführer!«
»Ach so!«, sagte Anna Quangel. »Ach so!« Ihre Stimme war plötzlich ganz ruhig geworden. »Na ja, Ihre Angaben habe ich ja nun, Sie bekommen dann Bescheid! Oder haben Sie noch irgendwas geltend zu machen? Vielleicht eine kranke Mutter zu versorgen?«
Frau Gerich zuckte nur verächtlich mit den Achseln. »Ehe Sie jetzt gehen«, sagte sie, »möchte ich doch einmal Ihren Ausweis sehen. Ich hätte mir auch gerne Ihren Namen notiert.«
»Bitte!«, sagte Frau Quangel und hielt der anderen ihren Ausweis hin. »Steht alles drauf. Visitenkarten habe ich leider keine.«
Zwei Minuten später war Frau Anna Quangel gegangen, und nicht drei Minuten danach rief ein fassungsloses, in Tränen aufgelöstes Wesen den Obersturmbannführer Gerich an und berichtete ihm schluchzend, manchmal aber auch vor Wut mit den Füßen trampelnd, von der unerhörten Beleidigung, die ihr durch eine Botin der Frauenschaft angetan worden war.
»Nein, nein, nein«, gelang es dem Obersturmbannführer schließlich, beruhigend einzuschieben. »Wir werden selbstverständlich von Partei wegen dies nachprüfen. Aber du musst immer bedenken, dass Nachkontrollen notwendig sind. Natürlich war es eine Dämelei, mit so was zu dir zu kommen. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht wieder vorkommt!«
»Nein, Ernst!«, schrie es förmlich am anderen Ende der Leitung. »Du wirst nichts derart tun! Sondern du wirst dafür sorgen, dass mich dieses Weib um Verzeihung bittet. Schon der Ton, in dem sie mit mir gesprochen hat! ›Kinder natürlich keine!‹, das hat sie gesagt. Damit hat sie auch dich beleidigt, Ernst – empfindest du das denn gar nicht?«
Der Obersturmbannführer musste es schließlich empfinden, er versprach seiner ›süßen Claire‹ alles, um sie zu beruhigen. Ja, sie würde um Verzeihung gebeten werden. Jawohl, es würde noch heute geschehen. Selbstverständlich würde er Karten für die Staatsoper besorgen und hinterher vielleicht die Femina, damit sie ein wenig abgelenkt und beruhigt werde? Ja, er würde sofort einen Tisch für sie bestellen lassen, sie möge doch versuchen, ein paar Freundinnen und Freunde telefonisch zusammenzutrommeln …
Nachdem er seiner Frau so eine ablenkende Beschäftigung gegeben hatte, ließ er sich mit der Hauptleitung der Frauenschaft verbinden und rügte im schärfsten Ton die ihm angetane Beleidigung. Ob man denn wahrhaftig niemand Besseres als derartig gemeine Weiber für solche Aufgaben einzusetzen habe? Da sei vermutlich eine genaue Nachprüfung fällig! Jawohl, um Verzeihung habe diese Quangel-Quingel-Quungel seine Frau zu bitten! Heute Abend noch, er müsse doch sehr bitten! Er verlange auch sofortige Meldung von dem Geschehenen!
Als der Obersturmbannführer schließlich anhängte, war er nicht nur blaurot im Gesicht, sondern er war jetzt auch fest davon überzeugt, unverzeihlich schwer beleidigt worden zu sein. Er rief sofort seine süße Claire an, musste es aber mindestens zehnmal versuchen, ehe er eine Verbindung mit ihr bekam, denn sie war jetzt eifrig dabei, ihre Freundinnen von der ihr angetanen Schmach zu benachrichtigen.
Das von ihrem Manne aber geführte Telefongespräch sickerte ein in das Netz von Berlin, es breitete sich aus, es lief hierhin und dorthin, Erkundigungen wurden eingezogen, Nachfragen wurden gehalten, streng vertraulich wurde geflüstert. Manchmal schien das Gespräch ganz von seinem ursprünglichen Ziele abgekommen, aber dank der Trefflichkeit und Unfehlbarkeit des Selbstwählersystems fand es immer wieder zurück, bis es schließlich, zu einer Lawine vergrößert, jene kleine Geschäftsstelle der Frauenschaft fand, der Anna Quangel unterstellt war. Dort hatten zurzeit zwei Damen (ehrenamtlich) Dienst, die eine weißhaarig und dürr, mit dem Mutterkreuz geschmückt, die andere mollig und noch jung, aber mit Herrenschnitt und dem Parteiabzeichen auf der schwellenden Brust versehen.
Die Weißhaarige hatte es erwischt, sie hatte zuerst zum Telefon gegriffen, über sie stürzte diese Lawine zuerst dahin. Sie wurde völlig überschüttet von ihr, sie ruderte hilflos mit den Armen, sie warf flehende Blicke auf die Mollige, sie versuchte kleine Bemerkungen einzuschieben: »Aber die Quangel – eine ganz zuverlässige Frau. Kenne sie seit Jahren …«
Umsonst, nichts konnte sie retten! Kein Blatt wurde, auch bei der Frauenschaft nicht, vor den Mund genommen, es wurde ihr klargemacht, was für eine Sauwirtschaft auf ihrer Geschäftsstelle herrsche. Sie könne sich gratulieren, wenn sie da einigermaßen mit sauberer Weste herauskam! Aber was diese Quangel angehe – natürlich heute noch und für immer und ewig absetzen und um Verzeihung bitten, heute noch! Jawohl, Heil Hitler!
Und kaum hatte die Weißhaarige angehängt und begann, noch an allen Gliedern zitternd, der Molligen einen Bericht zu machen, so schrillte wieder das Telefon, und eine andere vorgesetzte Dienststelle fühlte sich ebenfalls berufen, zu schreien, zu schelten, zu drohen.
Diesmal hatte es die Mollige getroffen. Auch sie wankte unter diesem Anprall, auch sie zitterte, denn wenn sie auch schon in der Partei war, ihr Mann galt als politisch unzuverlässig, weil er als Anwalt vor 1933 öfters ›Rote‹ vor Gericht verteidigt hatte. So eine Sache konnte ihnen den Hals brechen. Sie versuchte es mit Demut, Bereitwilligkeit, tiefster Ergebenheit. »Jawohl, ein bedauerliches Versehen … Diese Frau muss wahnsinnig geworden sein … Natürlich, es wird alles geschehen, heute Abend noch. Ich gehe selber …«
Umsonst, alles umsonst! Die Lawine stürzte auch über sie nieder und zerbrach ihr jeden Knochen im Leibe. Sie war nur noch ein nasser Lappen.
Und nun folgte Anruf auf Anruf. Es war, als sei die Hölle hereingebrochen! Sie bekamen kaum noch Atem, so rasch folgte ein Anruf dem anderen. Schließlich flohen sie aus diesem Büro, einfach unfähig, diese ständig wiederholten Beschimpfungen weiter anzuhören. Noch als sie die Tür abschlossen, hörten sie das Telefon nach immer neuer Beute schreien, aber sie gingen nicht wieder zurück. Sie nicht, für kein Geld der Welt! Ihr Bedarf war eingedeckt für heute, für morgen, für die nächsten Jahre!
Eine Weile marschierten sie schweigend ihrem Ziele, der Quangel’schen Wohnung, zu. Dann sagte die eine: »Der werde ich es aber geben, uns derartige Schwierigkeiten zu bereiten!«
Und die mit dem Parteiabzeichen: »So ist es. Die Quangel kann uns ganz egal sein! Aber Sie wissen ja, man hat auch so schon viel zu viel Schwierigkeiten …«
»Gewiss!«, sagte das Mutterkreuz kurz und dachte an einen Sohn, der in Spanien, aber auf der falschen, nämlich auf der roten Seite gekämpft hatte.
Aber die Unterhaltung mit Frau Anna Quangel verlief dann doch wesentlich anders, als die beiden erwartet hatten. Frau Quangel ließ sich weder andonnern noch einschüchtern.
»Erklären Sie mir bloß erst, was ich falsch gemacht habe. Hier sind meine Notizen. Die Frau Gerich fällt unter das Arbeitsdienstpflicht-Gesetz …«
»Aber, Liebste, Beste« – dies sagte die Mollige – »darum handelt es sich hier doch gar nicht. Sie ist die Gattin eines Obersturmbannführers. Sie verstehen doch?«
»Nein! Was hat das damit zu tun? Wo steht geschrieben, dass die Frauen von höheren Führern frei sind? Ich weiß davon nichts!«
»Seien Sie bloß nicht so begriffsstutzig!«, meinte die Weißhaarige streng. »Als Frau eines höheren Führers hat Frau Gerich höhere Pflichten. Sie muss für ihren überarbeiteten Mann sorgen.«
»Muss ich auch.«
»Sie hat große Repräsentationspflichten.«
»Was ist denn das?«
Nichts zu machen mit der Frau, nichts mir ihr anzufangen, sie sieht ihr Unrecht nicht ein. Sie will einfach nicht begreifen, dass höhere Führer mit all ihren Anverwandten von all ihren Pflichten gegen den Staat und die Gemeinschaft befreit sind.
Die Mollige mit dem Hakenkreuz ist es, die den wirklichen Grund für Frau Anna Quangels Hartnäckigkeit zu ermitteln meint. Sie entdeckt das Foto eines blässlich, unterernährt aussehenden Jungen an der Wand, mit einem Kranz und einer Trauerschleife geschmückt. »Ihr Sohn?«, fragt sie.
»Ja«, antwortet Anna Quangel kurz und verdrossen.
»Ihr einziger – gefallen?«
»Ja.«
Die Weißhaarige mit dem Mutterkreuz sagt milde: »Man soll eben nicht nur einen Sohn in die Welt setzen!«
Anna Quangel hat eine hastige Antwort auf der Zunge. Aber sie verkneift sie sich noch. Sie will nicht jetzt noch alles verderben.
Die beiden Damen tauschen einen Blick. Ihnen ist alles klar. Diese Frau hat den einzigen Sohn verloren, und da sieht sie solch eine Dame, von der sie meint, sie will sich einer kleinen Pflicht entziehen, nicht das geringste Opfer bringen … So was muss ja schiefgehen.
Die Mollige sagt: »Sie werden sich doch entschließen, eine kleine Entschuldigung vorzubringen?«
»Sobald Sie mir bewiesen haben, dass ich im Unrecht bin.«
Die Weißhaarige: »Aber ich habe es Ihnen bewiesen!«
»Dann habe ich es nicht begriffen. Für so was bin ich wohl zu dumm.«
»Na schön. Dann müssen wir es erst einmal allein versuchen. Ein schwerer Weg für uns.«
»Ich bitte Sie nicht darum!«
»Und dann, Frau Quangel, vorerst müssen Sie mal daran denken, sich zu schonen. Immer treppauf und treppab, und jetzt dieser Kummer. Sie sind ja eine unserer Fleißigsten gewesen.«
»Sie schmeißen mich also raus!«, stellt Anna Quangel fest. »Weil ich so einer Dame mal die Wahrheit gesagt habe!«
»Aber nein, um Gottes willen, fassen Sie das bloß nicht so auf! Vorläufig sind Sie erst einmal zur Schonung beurlaubt. Wir holen Sie uns wieder …«
Den Weg bis zum Friedrichshain legten die beiden Damen schweigend zurück. Sie sind ganz mit ihren Gedanken beschäftigt. Vermutlich hätten sie eben zu der Quangel viel schärfer sein müssen, sie auch anbrüllen und niederdonnern müssen. Aber das ist ihnen leider nicht gegeben – sie gehören zu jenen, die immer kuschen, sie sind wehrlos. Und weil sie das wissen, werden sie zum Fußabtreter für jeden, der schreien kann. Wenn es nur jetzt gutgeht mit diesem Besuch bei der hohen Dame, wenn sie nur (ohne die Hauptschuldige mitzubringen) ein einigermaßen günstiges Ergebnis nach Haus holen.
Aber sie haben Glück. Es ist jetzt doch – über all dem Telefonieren, Schreien, Besuchen – ziemlich spät am Abend geworden. Die gnädige Frau ist gerade beim Ankleiden, die gnädige Frau will in die Staatsoper. Aber sie dürfen auf zwei Hockern in der Diele warten.
Nach einer Viertelstunde werden sie dann von dem Mädchen gefragt, um was es sich denn eigentlich handele? Sie berichten es der Angestellten mit bedauerndem Flüstern und bekommen den Bescheid, weiter zu warten.
Aber in Wirklichkeit interessiert die ganze Sache Frau Obersturmbannführer Gerich kaum noch. Sie hat drei Stunden mit ihren Freundinnen telefoniert, sie hat gebadet, die Staatsoper erwartet sie, nachher ein gemütlicher Abend in der Femina – was soll da so ein Weib aus dem Volk die Dame der Gesellschaft noch groß interessieren? So sagt die Claire nach einer weiteren Viertelstunde zu ihrem Ernst: »Ach, geh und brüll die Weiber ein bisschen zusammen und schick sie weg! Ich will mir mit so was nicht den Abend verderben.«
So geht der Obersturmbannführer ein bisschen auf die Diele und brüllt die Besucherinnen zusammen. Er begreift dabei gar nicht, dass keine der beiden die eigentlich Schuldige ist. Das ist ihm ganz egal, er schreit sie an, und dann schmeißt er sie raus. Der Fall ist erledigt, endgültig!
Die beiden gehen nach Haus. Die Mollige sagt: »Eigentlich kann ich so ’ne Frau wie die Quangel manchmal direkt verstehen.«
Die Weißhaarige denkt an ihren Sohn und presst die Lippen fest zusammen.
Die Mollige fährt fort: »Manchmal wünsche ich es mir direkt, nichts weiter zu sein als eine einfache Arbeiterin, in der Masse zu verschwinden. Man wird so erledigt von diesem ewigen Vorsichtigsein, dieser nie ablassenden Angst …«
Das Mutterkreuz schüttelt den Kopf. »Ich würde lieber nicht so reden«, sagt sie kurz. Und sie setzt hinzu, als die andere gekränkt schweigt: »Jedenfalls haben wir die Sache auch ohne die Quangel, so gut wie es ging, hingekriegt. Er hat ausdrücklich gesagt, der Fall ist für ihn erledigt, und das melden wir nach oben weiter.«
»Und dass die Quangel abgesetzt ist!«
»Natürlich, das auch! Die will ich nie wieder auf unserer Geschäftsstelle sehen!«
Und sie bekamen sie dort auch nicht wieder zu sehen. Anna Quangel aber konnte ihrem Mann einen Erfolg melden, und so sorgfältig er sie auch ausfragte, es schien ein wirklicher Erfolg zu sein. Quangels waren beide ihre Ämter los, ohne Risiko …
18. Die erste Karte wird geschrieben
Der Rest der Woche verlief ohne alle besonderen Ereignisse, und so kam der Sonntag wieder heran, dieser Sonntag, von dem sich Anna Quangel endlich die so sehnlich erwartete und so lange aufgeschobene Aussprache mit Otto über seine Pläne erwartete. Er war erst spät aufgestanden, aber er war guter Stimmung und nicht ruhelos. Manchmal sah sie ihn beim Kaffeetrinken rasch von der Seite an, ein wenig aufmunternd, aber er schien das nicht zu merken, er aß, langsam kauend, sein Brot und rührte dabei in seinem Kaffee.
Nur schwer konnte sich Anna entschließen, das Geschirr fortzuräumen. Aber diesmal war es wirklich nicht an ihr, das erste Wort zu sprechen. Er hatte ihr für den Sonntag diese Aussprache zugesagt, und er würde schon sein Wort halten, jede Aufforderung von ihr hätte wie ein Drängen ausgesehen.
So stand sie mit einem ganz leisen Seufzer auf und trug die Tassen und die Teller in die Küche. Als sie zurückkam, um den Brotkorb und die Kanne zu holen, kniete er vor einem Schubfach der Kommode und kramte darin herum. Anna Quangel konnte sich nicht erinnern, was eigentlich in diesem Schubfach lag. Es konnte nur alter, längst vergessener Schraps sein. »Suchst du was Bestimmtes, Otto?«, fragte sie mit einem alten Berliner Witz.
Aber er gab nur einen Knurrlaut von sich, so zog sie sich tief in die Küche zurück, um abzuwaschen und das Essen vorzubereiten. Er wollte nicht. Er wollte also wieder nicht! Und mehr denn je war sie der Überzeugung, dass sich etwas in ihm vorbereitete, von dem sie immer noch nichts wusste und das sie doch wissen musste!
Später, als sie wieder in die Stube hereinkam, um sich beim Kartoffelschälen in seine Nähe zu setzen, fand sie ihn an dem seiner Decke beraubten Tisch, die Platte lag voller Schnitzmesser, und kleine Späne bedeckten bereits den Boden um ihn. »Was tust du denn, Otto?«, fragte sie maßlos erstaunt.
»Mal sehen, ob ich noch schnitzen kann«, gab er zurück.
Sie war maßlos enttäuscht und auch ein wenig gereizt. Wenn Otto auch kein großer Kenner der Menschenseele war, eine kleine Ahnung musste er doch davon haben, wie es in ihr aussah, mit welcher Spannung sie jede Mitteilung von ihm erwartete. Und nun hatte er seine Schnitzmesser aus ihren ersten Ehejahren hervorgesucht und schnippelte am Holz herum ganz wie damals, als er sie durch sein ewiges Schweigen zur Verzweiflung brachte. Damals war sie seine Wortkargheit noch nicht so gewohnt gewesen wie heute, aber heute, grade heute, da sie sie gewohnt war, schien sie ihr völlig unerträglich. Schnitzen, du lieber Gott, wenn das alles war, was diesem Mann nach solchen Erlebnissen einfiel! Wenn er sich mit stundenlanger schweigender Schnitzkunst seine so eifersüchtig gehütete Stille wiederholen wollte – nein, das würde eine schwere Enttäuschung für sie bedeuten. Er hatte sie schon oft schwer enttäuscht, aber diesmal würde sie das nicht so stillschweigend ansehen können.
Während sie dieses alles sehr unruhig und verzweifelt überdachte, sah sie doch mit halber Neugier auf das längliche, dicke Holzstück, das er nachdenklich zwischen seinen großen Händen drehte, von dem er nachdenklich mit seinem Messer dann und wann einen stärkeren Span abnahm. Nein, eine Wäschetruhe wurde das diesmal nicht, so viel stand fest.
»Was wird denn das, Otto?«, fragte sie halb unwillig. Ihr war der seltsame Gedanke gekommen, dass er da irgendein Werkstück schnitzte, vielleicht einen Teil eines Bombenzünders. Aber so was auch nur zu denken, war Unsinn – was hatte Otto mit Bomben zu tun?! Außerdem konnte man wahrscheinlich Holz bei Bomben gar nicht verwenden. »Was wird denn das, Otto?«, hatte sie also halb widerwillig gefragt.
Erst schien er wieder nur mit einem Knurren antworten zu wollen, aber vielleicht fiel ihm ein, dass er diesen Morgen seiner Anna schon ein bisschen viel zugemutet hatte, vielleicht war er aber auch einfach bereit, Auskunft zu geben. »Kopf«, sagte er. »Will mal sehen, ob ich noch einen Kopf schnitzen kann. Habe früher viel Pfeifenköpfe geschnitzt.«
Und er drehte und schnippelte weiter.
Pfeifenköpfe! Anna stieß einen empörten Laut aus. Sie sagte jetzt doch sehr ärgerlich: »Pfeifenköpfe! Aber Otto! Besinn dich! Die Welt stürzt ein, und du denkst an Pfeifenköpfe! Wenn ich bloß so was höre!«
Er schien weder auf ihren Ärger noch auf ihre Worte groß zu achten. Er sagte: »Das wird natürlich kein Pfeifenkopf. Ich will mal sehen, ob ich unser Ottochen ein bisschen zurechtschnitzen kann, wie er ausgesehen hat!«
Sofort schlug ihre Stimmung um. Also an Ottochen dachte er, und wenn er an Ottochen dachte und seinen Kopf schnitzen wollte, so dachte er auch an sie und wollte ihr eine Freude damit machen. Sie stand von ihrem Stuhle auf und sagte, hastig die Kartoffelschüssel absetzend: »Warte, Otto, ich hole dir die Bilder, damit du auch weißt, wie Ottochen wirklich ausgesehen hat.«
Er schüttelte ablehnend den Kopf. »Ich will keine Bilder sehen«, sagte er. »Ich will den Otto schnitzen, wie ich ihn hier in mir drin habe.« Er tippte gegen seine hohe Stirn. Und nach einer Pause setzte er noch hinzu: »Wenn ich’s kann!«