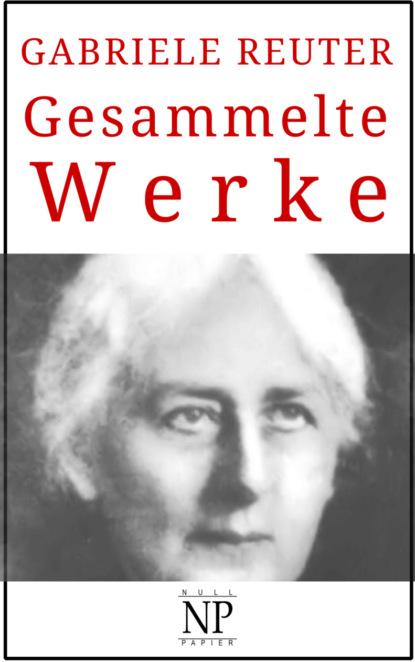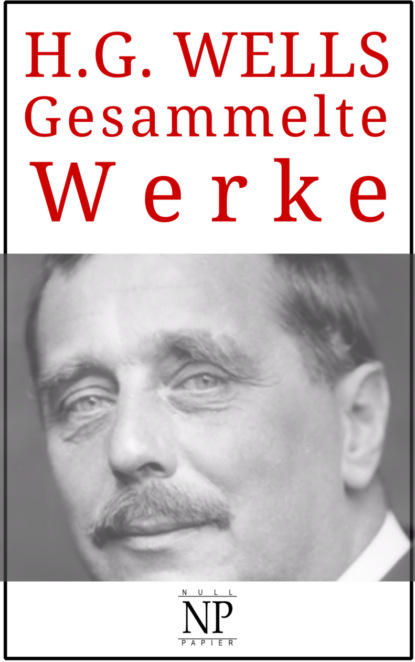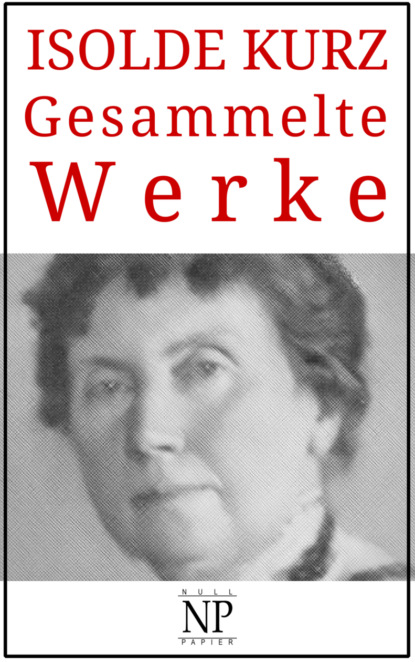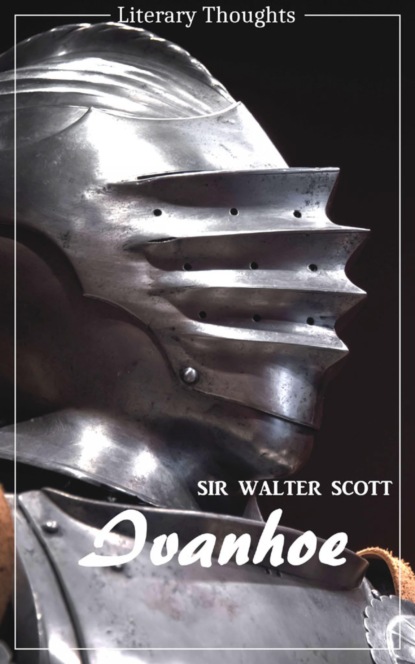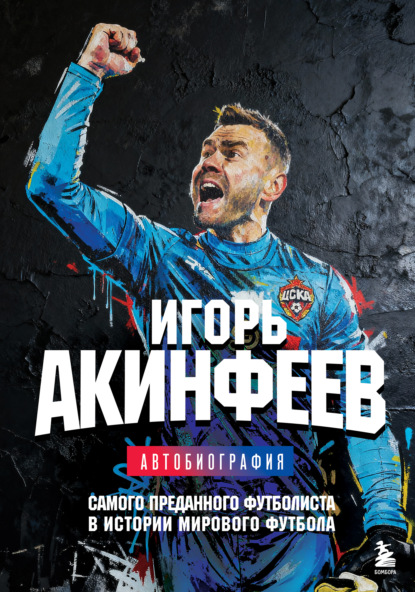Hans Fallada – Gesammelte Werke
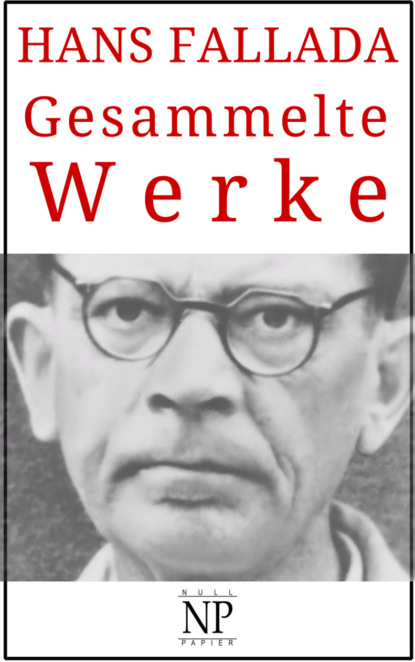
- -
- 100%
- +
Aber der kleine Buckel hatte auf nichts von alledem geachtet. Sein Blick war zur Decke des Saales gerichtet. Nun rief er laut, mit einer ekstatisch verzückten Stimme: »Ich komme!«
Er hob die Arme, er stieß sich mit den Füßen von der Bank ab, er wollte fliegen …
Dann fiel er unbeholfen zwischen die vor ihm sitzenden Zeugen, die erschrocken zur Seite sprangen, rollte zwischen die Bänke …
»Schaffen Sie den Mann raus!«, rief der Präsident gebieterisch in den schon wieder tumultuarisch erregten Saal. »Er soll ärztlich untersucht werden!«
Ulrich Heffke wurde aus dem Saal gebracht.
»Wie man sieht: eine Familie von Verbrechern und Wahnsinnigen«, stellte der Präsident fest. »Nun, es wird für die Ausmerzung gesorgt werden.«
Und er warf einen drohenden Blick auf Otto Quangel, der, seine Hosen mit den Händen haltend, noch immer auf die Tür sah, durch die der kleine Schwager verschwunden war.
Freilich wurde für die Ausmerzung des kleinen Buckels Ulrich Heffke gesorgt. Körperlich wie geistig war er nicht lebenswert, und nach einem kurzen Anstaltsaufenthalt sorgte eine Spritze dafür, dass er dieser bösen Welt wirklich Valet sagen konnte.
65. Die Hauptverhandlung: Die Verteidiger
Der Verteidiger Anna Quangels, der versorgte, graue ältliche Mann, der so gerne in selbstvergessenen Augenblicken in der Nase bohrte und der unverkennbar jüdisch aussah (dem aber nichts »bewiesen« werden konnte, denn seine Papiere waren »rein arisch«), dieser Mann, der ex officio zum Rechtsbeistand der Frau gemacht worden war, erhob sich zu seinem Plädoyer.
Er führte aus, dass er es sehr bedauern müsse, gezwungen zu sein, in Abwesenheit seiner Mandantin sprechen zu müssen. Gewiss seien ihre Ausfälle gegen so bewährte Einrichtungen der Partei wie die SA und die SS beklagenswert …
Zwischenruf des Anklägers: »Verbrecherisch!«
Jawohl, selbstverständlich stimme er der Anklagebehörde zu, solche Ausfälle seien höchst verbrecherisch. Immerhin sehe man an dem Fall des Bruders seiner Mandantin, dass sie kaum für voll zurechnungsfähig angesehen werden könne. Der Fall Ulrich Heffke, der sicher dem hohen Gerichtshof noch lebhaft in der Erinnerung sei, habe bewiesen, dass in der Familie Heffke der Geist religiösen Wahns umgehe. Er nehme wohl, ohne dem Urteil des ärztlichen Sachverständigen vorgreifen zu wollen, mit Recht an, dass es sich um Schizophrenie handele, und da die Schizophrenie zu den Erbkrankheiten gehöre …
Hier wurde der graue Verteidiger zum zweiten Male von dem Ankläger unterbrochen, der den Gerichtshof bat, den Rechtsanwalt zu ermahnen, zur Sache zu sprechen.
Präsident Feisler mahnte den Anwalt, zur Sache zu sprechen.
Der Anwalt wandte ein, er spreche zur Sache.
Nein, er spreche nicht zur Sache. Es handle sich um Hoch- und Landesverrat, nicht um Schizophrenie und Irresein.
Wieder wandte der Anwalt ein: Wenn der Herr Ankläger berechtigt sei, die moralische Minderwertigkeit seiner Mandantin zu beweisen, so sei er berechtigt, über Schizophrenie zu sprechen. Er bitte um Gerichtsbeschluss.
Der Gerichtshof zog sich zur Beschlussfassung über den Antrag des Verteidigers zurück. Dann verkündete Präsident Feisler: »Weder in der Voruntersuchung noch in der heutigen Verhandlung haben sich irgendwelche Anzeichen für eine geistige Störung der Anna Quangel ergeben. Der Fall ihres Bruders Ulrich Heffke kann nicht als beweiskräftig herangezogen werden, da über den Zeugen Heffke noch kein gerichtsärztliches Gutachten vorliegt. Es ist sehr wohl möglich, dass es sich bei dem Ulrich Heffke um einen gefährlichen Simulanten handelt, der seiner Schwester nur Hilfestellung leisten wolle. Es wird der Verteidigung aufgegeben, sich an die Tatsachen des Hoch- und Landesverrates zu halten, wie sie in der heutigen Verhandlung zutage getreten sind …«
Triumphierender Blick des Anklägers Pinscher zu dem versorgten Anwalt.
Und trüber Gegenblick des Anwalts.
»Da es mir vom Hohen Gerichtshof untersagt ist«, begann der Anwalt Anna Quangels von Neuem, »auf den Geisteszustand meiner Mandantin einzugehen, so überspringe ich alle die Punkte, die für eine verminderte Zurechnungsfähigkeit sprechen: ihre Beschimpfung des eigenen Gatten nach dem Tode des Sohnes, ihr seltsames, fast geistesgestört anmutendes Verhalten bei der Frau des Obersturmbannführers …«
Der Pinscher kläfft los: »Ich erhebe schreienden Protest dagegen, wie der Verteidiger der Angeklagten das Verbot des Gerichtes umgeht. Er überspringt die Punkte und hebt sie umso nachdrücklicher hervor. Ich beantrage Gerichtsbeschluss!«
Wiederum zieht sich der Gerichtshof zurück, und bei seinem Wiedererscheinen verkündet der Präsident Feisler bitterböse, dass der Anwalt wegen Übertretung eines Gerichtsbeschlusses zu einer Geldstrafe von fünfhundert Mark verurteilt sei. Für den Fall einer Wiederholung wird der Wortentzug angedroht.
Der graue Anwalt verbeugt sich. Er sieht sorgenvoll aus, als plage ihn der Gedanke, wie er diese fünfhundert Mark zusammenbringen solle. Er beginnt zum dritten Mal seine Rede. Er bemüht sich, die Jugend Anna Quangels zu schildern, die Dienstmädchenjahre, dann die Ehe an der Seite eines Mannes, der ein kalter Fanatiker sei, ein ganzes Frauenleben: »Nur Arbeit, Sorge, Verzicht, Sichfügen in einen harten Mann. Und dieser Mann beginnt plötzlich, Karten hochverräterischen Inhalts zu schreiben. Es ist aus der Verhandlung klar erwiesen, dass es der Mann war, der auf diesen Gedanken kam, nicht die Frau. Alle gegenteiligen Behauptungen meiner Mandantin in der Voruntersuchung sind als fehlgeleiteter Opferwille aufzufassen …«
Der Anwalt ruft: »Was sollte Frau Anna Quangel gegen den verbrecherischen Willen ihres Gatten tun? Was konnte sie tun? Ein Leben voller Dienstbarkeit lag hinter ihr, sie hatte nur Gehorchen gelernt, nie Widerstand geleistet. Sie war ein Geschöpf ihres Mannes, sie war ihm hörig …«
Der Ankläger sitzt mit gespitzten Ohren da.
»Hoher Gerichtshof! Die Tat, nein, die Beihilfe zur Tat durch eine solche Frau kann nicht voll bewertet werden. Wie man einen Hund nicht bestrafen kann, der auf Befehl seines Herrn in einem fremden Revier Hasen fängt, so ist diese Frau nicht voll für ihre Beihilfe verantwortlich zu machen. Sie hat – auch aus diesem Grunde – den Schutz des Paragrafen 51 Absatz 2 hinter sich …«
Der Ankläger unterbricht wieder. Er kläfft los, der Anwalt habe wiederum das Verbot des Gerichtshofes übertreten.
Der Verteidiger widerspricht.
Der Ankläger liest ab, von einem Block: »Nach dem Stenogramm hat die Verteidigung Folgendes gesagt: Sie hat – auch aus diesem Grunde – den Schutz des Paragrafen 51 Absatz 2. Die Worte ›Auch aus diesem Grunde‹ beziehen sich ganz klar auf die von der Verteidigung behauptete Geisteskrankheit der Familie Heffke. Ich beantrage Gerichtsbeschluss!«
Präsident Feisler befragt den Verteidiger, worauf er die Worte »Auch aus diesem Grunde« bezogen habe?
Der Anwalt erklärt, diese Worte hätten sich auf im weiteren Verlauf seiner Verteidigung zu entwickelnde Gründe bezogen.
Der Ankläger schreit, niemand beziehe sich in seiner Rede auf etwas, das noch nicht gesagt worden sei. Eine Bezugnahme könne nur auf Bekanntes, nie auf Unbekanntes erfolgen. Die Worte des Herrn Verteidigers stellten nichts als eine faule Ausrede dar.
Der Verteidiger protestierte gegen den Anwurf, eine faule Ausrede gebraucht zu haben. Im Übrigen könne man sich in einer Rede sehr wohl auf etwas noch Vorzutragendes beziehen, dies sei eine bekannte Redekunst, Spannung auf etwas noch Vorzutragendes zu erzeugen. So habe zum Beispiel Marcus Tullius Cicero in seiner berühmten dritten Philippika gesagt …
Anna Quangel war vergessen; jetzt sah Otto Quangel mit vor Staunen geöffnetem Munde von einem zum anderen.
Ein hitziger Disput war im Gange. Es regnete Zitate in Latein und Altgriechisch.
Schließlich zog sich der Gerichtshof wiederum zurück, und Präsident Feisler verkündete bei seinem Wiedererscheinen zur allgemeinen Überraschung (denn die meisten hatten über dem gelehrten Disput den Anlass dazu völlig vergessen), dass dem Anwalt der Angeklagten wegen nochmaliger Übertretung eines Gerichtsbeschlusses das Wort entzogen sei. Die Offizialverteidigung der Anna Quangel sei dem zufällig anwesenden Assessor Lüdecke übertragen.
Der graue Verteidiger verbeugte sich und verließ den Sitzungssaal, versorgter denn je aussehend.
Der »zufällig anwesende« Assessor Lüdecke erhob sich und sprach. Er hatte noch nicht viel Erfahrung, er hatte auch nicht recht zugehört, er war vom Gerichtshof eingeschüchtert, außerdem war er zurzeit stark verliebt und keines vernünftigen Gedankens fähig. Er sprach drei Minuten, bat um mildernde Umstände (falls der Hohe Gerichtshof nicht anderer Meinung sein sollte, in welchem Falle er bat, seine Bitte als ungesprochen anzusehen) und setzte sich wieder, sehr rot und verlegen aussehend.
Dem Verteidiger Otto Quangels wurde das Wort erteilt.
Er erhob sich, sehr blond und sehr hochmütig. In die Verhandlung hatte er bisher in keinem Fall eingegriffen, er hatte sich nicht eine Notiz gemacht, der Tisch vor ihm war leer. Während der stundenlangen Verhandlung hatte er sich eigentlich nur damit beschäftigt, seine rosigen, sehr gepflegten Fingernägel sanft gegeneinander zu reiben und immer wieder genau zu betrachten.
Jetzt aber sprach er, der Talar war halb geöffnet, eine Hand hatte er in der Hosentasche, die andere machte sparsame Gesten. Dieser Verteidiger konnte seinen Mandanten nicht ausstehen, er fand ihn widerlich, beschränkt, unglaubhaft hässlich und gradezu abstoßend. Und Quangel hatte leider alles getan, diese Abneigung seines Verteidigers noch zu verstärken, indem er trotz des dringenden Abratens Dr. Reichhardts dem Anwalt jede Auskunft verweigert hatte: er brauchte keinen Anwalt.
Jetzt also sprach Rechtsanwalt Dr. Stark. Seine nasale, schleppende Redeweise stand in starkem Gegensatz zu den krassen Worten, die er gebrauchte.
Er sagte: »Selten haben wohl wir alle, die wir hier zur Stunde in diesem Saale versammelt sind, ein solches Bild abgrundtiefer menschlicher Verworfenheit vorgeführt bekommen, wie es hier heute geschehen ist. Landesverrat, Hochverrat, Hurerei, Kuppelei, Abtreibung, Geiz – ja, gibt es denn ein menschliches Verbrechen, das mein Mandant nicht auf sich geladen, an dem er nicht teilgenommen hat? Hoher Gerichtshof, meine Herren, Sie sehen mich außerstande, einen solchen Verbrecher zu verteidigen. In einem solchen Falle lege ich die Robe des Verteidigers ab, ich selbst, der Verteidiger, muss zum Ankläger werden, und mahnend erhebe ich meine Stimme: die Gerechtigkeit nehme in ihrer äußersten Strenge den Lauf. In Abänderung eines bekannten Satzes kann ich nur sagen: Fiat justitia, pereat mundus![35] Keine Milderungsgründe für diesen Verbrecher, der den Namen Mensch nicht verdient!«
Damit verbeugte sich der Verteidiger zur allgemeinen Überraschung und setzte sich wieder, sorgfältig die Hosen über den Knien hochziehend. Er warf einen prüfenden Blick auf seine Nägel und begann, sie sachte gegeneinander zu reiben.
Nach einem kurzen Stutzen fragte der Präsident den Angeklagten, ob er noch etwas zu seinen Gunsten vorzutragen habe. Er möge sich aber gefälligst kurz fassen.
Otto Quangel sagte, seine Hosen festhaltend: »Ich habe nichts zu meinen Gunsten zu sagen: Aber ich möchte meinem Anwalt aufrichtig für seine Verteidigung danken. Endlich habe ich erfasst, was ein Linksanwalt ist.«
Und Quangel setzte sich unter stürmischer Bewegung der anderen. Der Anwalt unterbrach sein Nagelpolieren, erhob sich und verkündete nachlässig, dass er auf einen Antrag gegen seinen Mandanten verzichte, dieser habe nur wieder bewiesen, dass er ein unverbesserlicher Verbrecher sei.
Dies war der Augenblick, da Quangel lachte, zum ersten Mal seit seiner Verhaftung, nein, seit undenklichen Zeiten, heiter und unbekümmert lachte. Die Komik, dass dieses Verbrechergesindel ihn ernsthaft zum Verbrecher stempeln wollte, überwältigte ihn plötzlich.
Der Präsident ließ den Angeklagten wegen seiner unziemlichen Heiterkeit scharf an. Er erwog, mit noch schärferen Strafen gegen Quangel vorzugehen, aber dann fiel ihm ein, dass er eigentlich alle nur möglichen Strafen bereits über den Angeklagten verhängt hatte, dass ihm nur noch die Ausschließung aus dem Verhandlungszimmer blieb, und er bedachte, wie wenig es wirken würde, wenn er das Urteil in Abwesenheit beider Angeklagten verkünden würde. So beschied er sich zur Milde.
Der Gerichtshof zog sich zur Urteilsfällung zurück.
Große Pause.
Die meisten gingen, wie im Theater, um eine Zigarette zu rauchen.
66. Die Hauptverhandlung: Das Urteil
Bestimmungsgemäß hätten die beiden Schutzpolizisten, die jetzt Otto Quangel bewachten, während der Verhandlungspause ihren Gefangenen in die kleine Wartezelle abführen müssen, die für solche Pausen vorgesehen war. Da aber der Saal sich fast völlig geleert hatte und der Transport des Gefangenen mit den ewig rutschenden Hosen über die vielen Gänge und Treppen ziemlich umständlich war, so glaubten sie sich über diese Vorschrift hinwegsetzen zu können und blieben plaudernd in einiger Entfernung von Quangel stehen.
Der alte Werkmeister stützte den Kopf in die Hände und versank für wenige Minuten in eine Art Halbschlaf. Die siebenstündige Verhandlung, während der er seiner Aufmerksamkeit nicht einmal erlaubt hatte abzuirren, hatte ihn erschöpft. Bilder zogen schattenhaft an ihm vorüber: die krallenfingrige Hand des Präsidenten Feisler, die sich öffnete und schloss, der Verteidiger von Anna mit dem Finger in der Nase, der kleine Buckel Heffke, wie er fliegen lernen wollte, Anna, die mit roten Backen »Siebenundachtzig« sagte und deren Augen dabei eine so heitere Überlegenheit bezeigt hatten, wie er sie nie an ihr gesehen, und viele andere Bilder noch, viele – andere – Bilder – noch –
Sein Kopf presste sich fester gegen seine Hände, er war so müde, er musste schlafen, nur fünf Minuten …
So legte er einen Arm auf den Tisch und den Kopf darauf. Er atmete behaglich. Nur fünf Minuten fester Schlaf, eine kleine Spanne Vergessen.
Aber er schreckte wieder hoch. Es war da etwas in diesem Saale, das ihm die ersehnte Ruhe zerstörte. Er sah mit weit aufgerissenen Augen umher, und sein Blick fiel auf den Kammergerichtsrat a.D. Fromm, der am Geländer des Zuhörerraums stand und ihm Zeichen zu machen schien. Quangel hatte den alten Herrn schon vorher gesehen, wie überhaupt nichts seiner regen Aufmerksamkeit entgangen zu sein schien, aber bei den vielen erregenden Eindrücken dieses Tages hatte er nicht viel Notiz von dem früheren Hausgenossen aus der Jablonskistraße genommen.
Jetzt also stand der Rat an der Barriere und machte ihm Zeichen.
Quangel warf einen Blick auf die beiden Schupos. Sie standen etwa drei Schritte von ihm entfernt, keiner sah ihn direkt an, und sie waren in ein sehr lebhaftes Gespräch vertieft. Quangel hörte gerade die Worte: »Und da fass ick den Bruder ins Jenick …«
Der Werkmeister war aufgestanden, hatte die Hosen fest mit beiden Händen gepackt und ging nun Schritt um Schritt durch die ganze Länge des Saales auf den Kammergerichtsrat zu.
Der stand an der Barre, den Blick hielt er jetzt gesenkt, als wolle er den herannahenden Gefangenen nicht sehen. Dann – Quangel war nur noch ein paar Schritte von ihm entfernt – drehte sich der Kammergerichtsrat rasch um, ging zwischen den Stuhlreihen hindurch und auf die Ausgangstür zu. Aber von ihm zurückgelassen, lag ein kleines weißes Päckchen, nicht einmal so groß wie ein Garnröllchen, auf dem Geländer.
Quangel machte die letzten Schritte, fasste zu und barg das Röllchen zuerst in der hohlen Hand, dann in der Hosentasche. Es hatte sich fest angefühlt. Er drehte sich um und sah, dass seine beiden Bewacher noch immer nicht seine Abwesenheit bemerkt hatten. Dann klappte eine Tür im Zuschauerraum, und der Kammergerichtsrat war fort.
Quangel begann wieder seine Wanderung zurück zu seinem Platz. Er war ziemlich erregt, sein Herz klopfte, es schien so unwahrscheinlich, dass dieses Abenteuer gut ausgehen sollte. Und was war dem alten Rat so wichtig erschienen, es ihm zuzustecken, dass er darum so viel gewagt hatte?
Quangel war nur noch einige Schritte vom Platz entfernt, als der eine Wachtmeister ihn plötzlich sah. Er fuhr erschrocken zusammen, warf einen verwirrten Blick auf den leeren Sitz Quangels, als wolle er sich überzeugen, dass der Angeklagte wirklich nicht mehr dort saß, und schrie dann fast in seinem Schreck: »Wat machen Sie denn da?«
Auch der andere Schupo fuhr herum und starrte Quangel an. In ihrer ersten Verwirrung standen beide wie angewurzelt, dachten gar nicht daran, den Gefangenen zurückzuführen.
»Ich möchte mal austreten, Herr Wachtmeister!«, sagte Quangel.
Aber während der rasch beruhigte Polizist noch knurrte: »Da latschen Se jefällichst nich alleene los! Da melden Se sich jefällichst, Sie!« – während der Polizist noch so sprach, dachte Quangel plötzlich, dass er es nicht anders haben wollte als Anna. Sollten die ruhig ihr Urteil ohne die beiden Angeklagten verkünden, es würde ihnen viel von ihrem Spaß nehmen. Er, Quangel, war nicht neugierig darauf, weil er es nämlich schon kannte. Außerdem sehnte er sich danach, zu erfahren, was für eine Wichtigkeit ihm der alte Rat da zugesteckt hatte.
Die beiden Polizisten waren bei Quangel angelangt und fassten ihn bei den Armen, die doch die Hosen hielten.
Quangel sah sie kalt an und sagte: »Hitler, verrecke!«
»Was?« Sie waren verblüfft, trauten ihren Ohren nicht.
Und Quangel sehr schnell und sehr laut: »Hitler, verrecke! Göring, verrecke! Goebbels, du Aas, verrecke! Streicher,[36] verrecke!«
Eine ihn unter dem Kinn treffende Faust machte das weitere Ableiern dieses Rosenkranzes unmöglich. Die beiden Schupos schleppten den bewusstlosen Quangel aus dem Saal.
So kam es, dass Präsident Feisler das Urteil doch ohne die beiden Angeklagten verkünden musste. Umsonst hatte der höchste Richter über die Beleidigung des Anwalts gnädig hinweggesehen. Und Quangel behielt recht: die Urteilsverkündung machte dem Präsidenten ohne die Gesichter der beiden Angeklagten keinen Spaß mehr, nicht mehr den allergeringsten. Er hatte sich so schöne beschimpfende Formulierungen ausgedacht.
Während Feisler noch sprach, öffnete Quangel in seiner Wartezelle die Augen. Sein Kinn schmerzte, der ganze Kopf schmerzte, mühsam nur konnte er sich an das Geschehene erinnern. Seine Hand tastete sich vorsichtig in die Tasche: Gottlob, das Päckchen war noch da.
Er hörte den Schritt der Wache auf dem Gang, nun hörte das Geräusch auf, und stattdessen wurde ein leiser, schürfender Laut von der Tür her vernehmlich: das Schutzschild wurde vom Spion zurückgeschoben. Quangel hatte die Augen geschlossen, er lag, als sei er noch immer bewusstlos. Nach einer endlos erscheinenden Frist kam wiederum das leise, schürfende Geräusch von der Tür her und dann endlich von neuem der Schritt der Wache …
Der Spion war wieder geschlossen, die nächsten zwei, drei Minuten würde der Posten bestimmt nicht hereinsehen.
Quangel fasste schnell in die Tasche und brachte das Röllchen zum Vorschein. Er streifte den Faden ab, der es umspannte, entfaltete den Zettel, der um ein Glasröhrchen lag, und las die Maschinenschrift: »Blausäure, tötet schmerzlos in wenigen Sekunden. Im Mund verstecken. Für die Frau wird auch gesorgt. Zettel vernichten!«
Quangel lächelte. Der gute alte Mann! Der herrliche alte Mann! Er kaute das Zettelchen, bis es ganz nass war, und schluckte es dann herunter.
Neugierig betrachtete er die Ampulle, sah die wasserklare Flüssigkeit an. Rascher, schmerzloser Tod, sagte er sich. Oh, wenn ihr das wüsstet! Und für Anna wird auch gesorgt werden. Er denkt an alles. Guter alter Mann!
Er schob das Glasröhrchen in den Mund. Er probierte. Er fand, dass er es am besten zwischen Zahnfleisch und Backzähnen verbergen konnte, wie einen Stift, einen Priem, den viele Arbeiter in der Tischlerwerkstatt gebraucht hatten. Er tastete die Backe ab. Nein, er konnte von einer Erhöhung nichts spüren. Und wenn sie wirklich etwas merkten, ehe sie ihm das Ding fortnehmen konnten, hatte er zugebissen und es im Munde zermalmt.
Wieder lächelte Quangel. Jetzt war er wirklich frei, jetzt hatten sie keinerlei Gewalt mehr über ihn!
67. Das Totenhaus
Das Totenhaus in Plötzensee beherbergt jetzt Otto Quangel. Die Einzelzelle des Totenhauses ist nun seine letzte Heimat auf dieser Erde.
Ja, jetzt liegt er auf einer Einzelzelle: Für die zum Tode Verurteilten gibt es keine Gefährten mehr, keinen Dr. Reichhardt, nicht einmal einen »Hund«. Die zum Tode Verurteilten haben nur noch den Tod zum Gefährten, so will es das Gesetz.
Es ist ein ganzes Haus, in dem sie leben, diese zum Tode Verurteilten, Dutzende, vielleicht Hunderte, Zelle an Zelle. Immer geht der Schritt der Wachen über den Gang, immer hört man Klirren, und die ganze Nacht bellen die Hunde auf den Höfen.
Aber in den Zellen die Gespenster sind still, in den Zellen ist Ruhe, man hört keinen Laut. Sie sind so still, diese Todeskandidaten! Aus allen Teilen Europas zusammengeholt, Männer, Jünglinge, fast noch Knaben, Deutsche, Franzosen, Holländer, Belgier, Norweger, gute Menschen, schwache Menschen, böse Menschen, alle Temperamente vom Sanguiniker bis zum Choleriker, bis zum Melancholiker. Aber in diesem Hause verwischen sich die Unterschiede, sie sind alle still geworden, nur noch Gespenster ihrer selbst. Kaum je hört Quangel nachts ein Weinen, und wieder Stille, Stille … Stille …
Er hat die Stille immer geliebt. Diese letzten Monate hatte er ein Leben führen müssen, das seiner ganzen Wesensart entgegengesetzt war: nie mit sich allein, so oft zum Sprechen gezwungen, er, der doch alles Sprechen hasste. Nun ist er noch ein Mal, ein letztes Mal, zu seiner Art des Lebens zurückgekehrt, in die Stille, in die Geduld. Der Dr. Reichhardt war gut, er hat ihn vieles gelehrt, aber nun, dem Tode so nahe, ist es noch besser, ohne den Dr. Reichhardt zu leben.
Von Dr. Reichhardt hat er es übernommen, sich ein regelmäßiges Leben hier in der Zelle einzurichten. Alles hat seine Zeit: das sehr sorgfältige Waschen, einige Freiübungen, die er dem Zellengefährten abgelauscht hat, je eine Stunde Spaziergang am Vor- wie am Nachmittag, das gründliche Reinigen der Zelle, das Essen, der Schlaf. Es gibt hier auch Bücher zum Lesen, jede Woche werden ihm sechs Bücher auf die Zelle gebracht; aber darin hat er sich nicht geändert, er sieht sie nicht an. Er wird doch auf seine alten Tage nicht noch mit Lesen anfangen.
Aber noch ein anderes hat er von dem Dr. Reichhardt übernommen. Während seiner Spaziergänge summt er vor sich hin. Er erinnert sich an alte Kinder- und Volkslieder, von der Schule her. Aus seiner frühesten Jugend tauchen sie in ihm auf, Vers reiht sich an Vers – was für einen Kopf er doch hat, der dies alles über vierzig Jahre hin noch weiß! Und dann die Gedichte: Der Ring des Polykrates, Die Bürgschaft, Freude, schöner Götterfunken, Der Erlkönig. Aber das Lied von der Glocke bekommt er nicht mehr zusammen. Vielleicht hat er nie alle Verse gekonnt, das weiß er nun nicht mehr …
Ein stilles Leben, aber den Hauptinhalt des Tages bietet doch die Arbeit. Ja, hier muss er arbeiten, ein bestimmtes Quantum Erbsen muss er sortieren, wurmstichige Erbsen auslesen, halbe, zerbrochene entfernen wie die Unkrautsamen und die schwarzgrauen Kugeln der Wicken. Er tut diese Arbeit gerne, seine Finger sortieren fleißig Stunde um Stunde.
Und es ist gut, dass er gerade diese Arbeit bekommen hat, sie sättigt ihn. Denn nun sind die guten Zeiten, da er von den Speisen Dr. Reichhardts mitessen durfte, endgültig vorbei. Was sie ihm in seine Zelle reichen, ist schlecht gekocht, Wassergeplemper, nasses, klebriges Brot mit Kartoffelbeimischung, das unverdaulich schwer in seinem Magen liegt.
Aber da helfen die Erbsen. Er kann nicht viel abnehmen, denn sein Quantum wird ihm zugewogen, aber er kann so viel abnehmen, dass er einigermaßen satt wird. Er weicht sich diese Erbsen in Wasser ein, und wenn sie gequollen sind, tut er sie in seine Suppe, damit sie ein bisschen warm werden, und dann kaut er sie. So verbessert er sein Essen, von dem das Wort gilt: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.
Er vermutet es beinahe, dass die Aufseher, die Arbeitsinspektoren wissen, was er tut, dass er Erbsen stiehlt, aber sie sagen nichts. Und sie sagen nichts, nicht weil sie den zum Tode Verurteilten schonen wollen, sondern weil sie gleichgültig sind, stumpf geworden in diesem Hause, in dem sie alle Tage so viel Elend erleben.