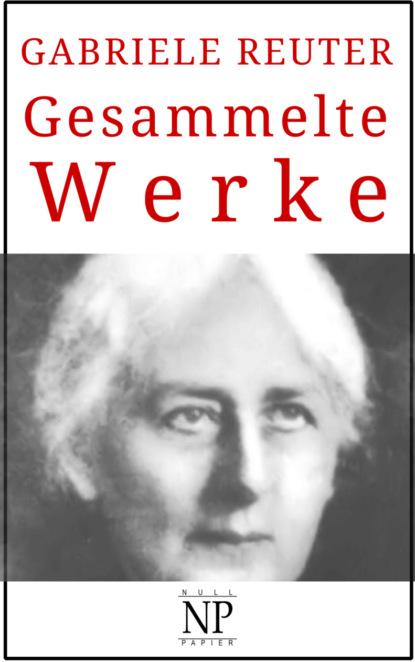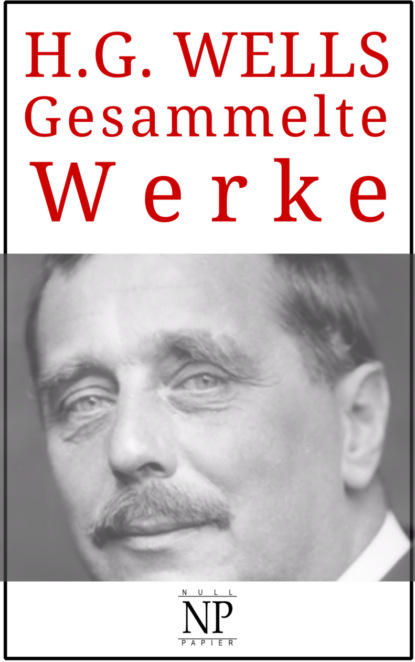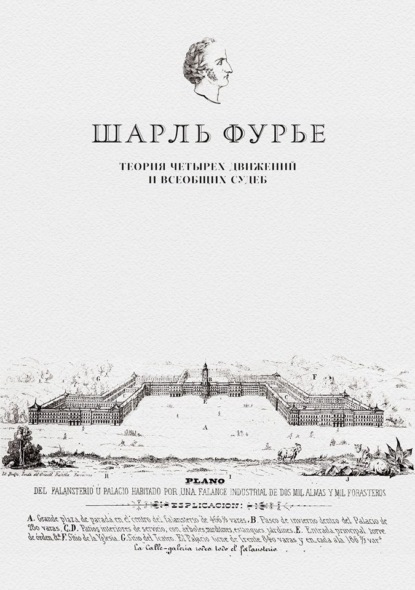Hans Fallada – Gesammelte Werke

- -
- 100%
- +
»Wie?«, rief der Geistliche, halb verwirrt, halb drohend.
»Herr Pastor Lorenz hieß im Gefängnis nur der gute Pastor«, erklärte Quangel.
»Nein, nein«, rief der Pastor zornig, »ich sehne mich nicht nach einem solchen von euch gespendeten Ehrennamen! Ich würde das einen Unehrennamen heißen!« Er besann sich. Mit einem Plumps fiel er auf die Knie, genau auf das weiße Taschentuch. Er deutete auf eine Stelle des dunklen Zellenbodens neben sich (denn das weiße Tuch reichte nur für ihn aus): »Knien Sie auch nieder, Quangel, wir wollen beten!«
»Vor wem soll ich knien?«, fragte Quangel kalt. »Zu wem soll ich beten?«
»Oh!«, brach der Pastor ärgerlich aus, »fangen Sie doch nicht schon wieder damit an! Ich habe schon viel zu viel Zeit an Sie verschwendet!« Er sah kniend zu dem Mann mit dem harten, bösen Gesicht auf. Er murmelte: »Gleichviel, ich werde meine Pflicht tun. Ich werde für Sie beten!«
Er senkte den Kopf, faltete die Hände, und seine Augen schlossen sich. Dann stieß er den Kopf vor, öffnete die Augen weit und schrie plötzlich so laut, dass Quangel erschrocken zusammenfuhr: »O Du mein Herr und mein Gott! Allmächtiger, allwissender, allgütiger, allgerechter Gott, Richter über Gut und Böse! Ein Sünder liegt hier vor Dir im Staube, ich bitte Dich, Du wollest die Augen in Barmherzigkeit wenden auf diesen Menschen, der viele Missetat begangen hat, ihn erquicken an Leib und Seele und ihm alle seine Sünden in Gnaden vergeben …«
Der kniende Pastor schrie noch lauter: »Nimm an das Opfer des unschuldigen Todes Jesu Christi, Deines lieben Sohnes, für die Bezahlung seiner Missetat! Er ist ja auch auf desselbigen Namen getauft und mit desselbigen Blut gewaschen und gereinigt. So errette ihn nun von des Leibes Qual und Pein! Verkürze ihm seine Schmerzen, erhalte ihn wider die Anklage des Gewissens! Verleihe ihm eine selige Heimfahrt zum ewigen Leben!«
Der Geistliche senkte seine Stimme zu einem geheimnisvollen Flüstern: »Schicke Deine heiligen Engel her, dass sie ihn begleiten zur Versammlung Deiner Auserwählten in Christo Jesu, unserm Herrn.«
Der Pastor rief wieder sehr laut: »Amen! Amen! Amen!«
Er stand auf, faltete das weiße Tuch sorgfältig wieder zusammen und fragte, ohne Quangel anzusehen: »Es ist wohl vergeblich, dass ich Sie frage, ob Sie bereit sind, das heilige Abendmahl einzunehmen?«
»Völlig vergeblich, Herr Pastor.«
Der Pastor streckte zögernd seine Hand gegen Quangel aus.
Quangel schüttelte den Kopf und legte seine Hände auf den Rücken.
»Auch das ist vergeblich, Herr Pastor!«, sagte er.
Der Pastor ging, ohne ihn anzusehen, zur Tür. Er wandte sich noch einmal um, warf einen flüchtigen Blick auf Quangel und sagte: »Nehmen Sie noch diesen Spruch mit zur letzten Richtstätte, Philipper 1,21: Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.«
Die Tür klappte, er war gegangen.
Quangel atmete auf.
71. Der letzte Weg
Der Geistliche war kaum gegangen, da trat ein kleiner, untersetzter Mann in einem hellgrauen Anzug in die Zelle. Er warf einen raschen, scharf prüfenden, klugen Blick auf Quangels Gesicht, ging dann auf ihn zu und sagte: »Dr. Brandt, Gefängnisarzt.« Er hatte dabei Quangels Hand geschüttelt und behielt sie nun in der seinen, während er sagte: »Darf ich Ihnen den Puls fühlen?«
»Immer zu!«, sagte Quangel.
Der Arzt zählte langsam. Dann ließ er die Hand Quangels los und sagte beifällig: »Sehr gut. Ausgezeichnet. Sie sind ein Mann.«
Er warf einen raschen Blick zur Tür, die halb offengeblieben war, und fragte flüsternd: »Kann ich was für Sie tun? Was Betäubendes?«
Quangel bewegte verneinend den Kopf. »Ich danke schön, Herr Doktor. Es wird auch so gehen.«
Seine Zunge berührte die Ampulle. Er überlegte einen Augenblick, ob er dem Arzt noch irgendeinen Auftrag an Anna geben sollte. Aber nein, dieser Pastor würde ihr doch alles erzählen …
»Sonst etwas?«, fragte der Arzt flüsternd. Er hatte Quangels Schwanken sofort bemerkt. »Vielleicht ein Brief zu bestellen?«
»Ich habe hier kein Schreibzeug – ach nein, ich will es auch lassen. Ich danke Ihnen jedenfalls, Herr Doktor, wieder ein Mensch mehr! Gottlob sind auch in solch einem Bau nicht alle schlecht.«
Der Arzt nickte trübe, gab Quangel noch einmal die Hand, überlegte und sagte rasch: »Ich kann Ihnen nur sagen: Bleiben Sie so mutig.«
Und er verließ rasch die Zelle.
Ein Aufseher trat ein, gefolgt von einem Gefangenen, der eine Schüssel und einen Teller trug. In der Schüssel dampfte heißer Kaffee, auf dem Teller lagen mit Butter bestrichene Brote. Daneben zwei Zigaretten, zwei Streichhölzer und ein Stückchen Reibfläche.
»So«, sagte der Aufseher. »Sie sehen, wir lassen uns nicht lumpen. Und alles ohne Karten!«
Er lachte, und der Kalfaktor lachte pflichtschuldigst mit. Es war zu merken, dass dieser »Witz« schon oft gemacht worden war.
In einer plötzlichen, überraschenden Aufwallung von Ärger sagte Quangel: »Nehmen Sie das Zeug wieder raus! Ich brauche eure Henkersmahlzeit nicht!«
»Das soll mir keiner zweimal sagen!«, sagte der Aufseher. »Übrigens ist der Kaffee bloß Muckefuck und die Butter Margarine …«
Und wieder war Quangel allein. Er ordnete sein Bett, zog die Bezüge ab und legte sie neben der Tür nieder, klappte das Gestell an die Wand. Dann machte er sich daran, sich zu waschen.
Er war noch dabei, als ein Mann, gefolgt von zwei Burschen, die Zelle betrat.
»Die Wascherei sparen Sie sich man«, sagte der Mann lärmend. »Jetzt werden wir Sie erstklassig rasieren und frisieren! Los, Jungens, macht ein bisschen schnell, wir sind spät dran!« Und entschuldigend zu Quangel: »Ihr Vorgänger hat uns zu sehr aufgehalten. Manche wollen gar keine Vernunft annehmen und begreifen nicht, dass ich nichts ändern kann. Ich bin nämlich der Scharfrichter von Berlin …«
Er streckte Quangel die Hand hin.
»Nun, Sie werden sehen, ich werde weder trödeln noch quälen. Macht ihr keine Schwierigkeiten, mache ich auch keine. Ich sage immer zu meinen Jungens: ›Jungens‹, sage ich, ›wenn einer sich unvernünftig anstellt und schmeißt sich hin und brüllt und schreit, so seid ihr auch unvernünftig. Packt ihn an, wo ihr ihn zu fassen kriegt, und wenn ihr ihm die Hoden rausreißt!‹ Aber bei vernünftigen Leuten, wie du einer bist, immer fein sachte!«
Während er so immer weiterredete, war eine Haarschneidemaschine über Quangels Kopf hin und her gewandert, sein sämtliches Kopfhaar lag auf dem Zellenboden. Der andere Henkersgehilfe hatte Seife zu Schaum geschlagen und rasierte Quangels Bart. »So«, sagte der Scharfrichter befriedigt. »Sieben Minuten! Wir haben wieder aufgeholt. Noch ein paar solche Vernünftige, und wir sind pünktlich wie die Eisenbahn.« Und bittend zu Quangel: »Sei so nett und feg dein Zeug selber zusammen. Du bist nicht dazu verpflichtet, verstehst du, aber wir sind knapp mit der Zeit. Der Direktor und der Ankläger können jeden Augenblick kommen. Schmeiß die Haare nicht in den Kübel, ich leg dir hier ’ne Zeitung hin: wickle sie ein und lege sie neben die Tür. Es ist ein kleiner Nebenverdienst, du verstehst?«
»Was machst du denn mit meinen Haaren?«, fragte Quangel neugierig.
»Verkauf ich an einen Perückenmacher. Perücken werden immer gebraucht. Nicht nur für die Schauspieler, auch so. Na, dann dank ich auch schön. Heil Hitler!«
Auch die waren gegangen, muntere Burschen, konnte man wohl sagen, sie verstanden ihr Handwerk, man konnte nicht mit mehr Seelenruhe Schweine schlachten. Und doch entschied Quangel, dass diese rohen, herzlosen Burschen besser zu ertragen seien als der Pastor vorhin. Dem Scharfrichter hatte er doch sogar ohne Weiteres die Hand gegeben.
Quangel hatte gerade die Wünsche des Scharfrichters, die Zellenreinigung betreffend, erfüllt, als schon wieder die Tür geöffnet wurde. Es traten ein, begleitet von einigen Uniformierten, ein dicker Herr mit rotem Schnurrbart und einem fetten, bleichen Gesicht – der Gefängnisdirektor, wie sich gleich herausstellte, und ein alter Bekannter Quangels: der Ankläger aus der Hauptverhandlung, der wie ein Pinscher kläffte.
Zwei Uniformierte packten Quangel und rissen ihn roh gegen die Zellenwand zurück, wo sie ihn zwangen, Haltung einzunehmen. Dann stellten sie sich neben ihn.
»Otto Quangel«, schrie der eine.
»Ach so!«, kläffte der Pinscher los. »An das Gesicht erinnere ich mich doch!« Er wandte sich an den Direktor. »Dem habe ich selber sein Todesurteil verschafft!«, sagte er stolz. »Ein ganz unverschämter Bursche das. Er dachte, er könnte dem Gericht und mir frech kommen. Aber wir haben’s dir gegeben, Bursche!«, kläffte er, zu Quangel gewendet, weiter. »Was, wir haben’s dir gegeben! Wie ist dir nun? Nicht mehr ganz so frech, wie?«
Einer der Männer neben ihm puffte Quangel in die Seite. »Antworten!«, flüsterte er befehlend.
»Ach, leckt mich doch alle!«, sagte Quangel gelangweilt.
»Wie? Was?« Der Ankläger tanzte vor Erregung von einem Bein aufs andere. »Herr Direktor, ich verlange …«
»Ach was!«, sagte der Direktor, »lassen Sie die Leute doch zufrieden! Sie sehen doch, das ist ein ganz ruhiger Mann! Nicht wahr, das sind Sie doch?«
»Natürlich!«, antwortete Quangel. »Er soll mich nur zufrieden lassen. Ich lasse ihn schon in Ruhe.«
»Ich protestiere! Ich verlange …!«, schrie der Pinscher.
»Was denn?«, sagte der Direktor, »was können Sie denn jetzt noch verlangen? Mehr als hinrichten können wir den Mann doch nicht, und das weiß der sehr gut. Also, machen Sie los, lesen Sie ihm schon das Urteil vor!«
Endlich beruhigte sich der Pinscher, entfaltete ein Aktenstück und begann vorzulesen. Er las hastig und undeutlich, übersprang Sätze, verwirrte sich und schloss ganz plötzlich: »Also, Sie wissen Bescheid!«
Quangel antwortete nicht.
»Führen Sie den Mann nach unten!«, sagte der rotbärtige Direktor, und die beiden Wachen packten Quangel fest bei den Armen.
Er machte sich unwillig los.
Sie packten ihn noch fester an.
»Lassen Sie den Mann allein gehen!«, befahl der Direktor. »Der wird schon keine Schwierigkeiten machen.«
Sie traten auf den Gang hinaus. Dort standen eine Menge Leute, Uniformierte und Zivilisten. Plötzlich hatte sich ein Zug gebildet, dessen Mittelpunkt Otto Quangel war. An der Spitze gingen Wachtmeister. Dann folgte der Pastor, der jetzt einen Talar mit weißem Kragen trug und irgendetwas Unverständliches vor sich hin betete. Hinter ihm ging Quangel, in eine ganze Traube von Aufsehern gehüllt, aber der kleine Arzt im hellen Anzug hielt sich dicht bei ihm. Dahinter folgten der Direktor und der Ankläger, denen wieder Zivilisten und Uniformierte nachgingen, die Zivilisten zum Teil mit Fotoapparaten bewaffnet.
So bewegte sich der Zug über Korridore, die schlecht beleuchtet waren, über eiserne Treppen, deren Linoleumbelag schlüpfrig war, durch das Totenhaus. Und wo er vorbeikam, schien ein Stöhnen in den Zellen laut zu werden, ein verhaltenes Ächzen aus tiefster Brust. Plötzlich rief eine Stimme aus einer Zelle sehr laut: »Lebe wohl, Genosse!«
Und ganz mechanisch antwortete Otto Quangel laut: »Lebe wohl, Genosse!« Erst einen Augenblick später fiel ihm ein, wie widersinnig dieses »Lebewohl« an einen Sterbenden gewesen war.
Jetzt wurde eine Tür aufgeschlossen, und sie traten auf den Hof hinaus. Noch hing das nächtliche Dunkel zwischen den Mauern. Quangel sah rasch rechts und links, seiner überwachen Aufmerksamkeit entging nichts. Er sah an den Fenstern des Zellengefängnisses das Rund vieler bleicher Gesichter, die Kameraden, die, gleich ihm zum Tode verurteilt, noch lebten. Ein Schäferhund fuhr laut bellend dem Zuge entgegen, wurde von dem Posten zurückgepfiffen und zog sich knurrend zurück. Der Kies knirschte unter den vielen Füßen, es sah aus, als müsse er bei Tageslicht leicht gelblich aussehen, jetzt, im Schein der elektrischen Lampen, wirkte er weißlichgrau. Über die Mauer sah schattenhaft der Umriss eines entblätterten Baumes. Die Luft war fröstelig und feucht. Quangel dachte: In einer Viertelstunde werde ich nicht mehr frieren – komisch!
Seine Zunge tastete nach der Glasampulle. Aber es war noch zu früh …
Seltsam, so deutlich er alles sah und hörte, was um ihn vorging, bis auf die geringste Kleinigkeit, so unwirklich schien ihm doch alles. Dies war ihm einmal erzählt worden. Er lag in seiner Zelle und träumte davon. Ja, es war ganz unmöglich, dass er hier körperlich wandelte, und sie alle, die hier mit ihm gingen, mit ihren gleichgültigen oder rohen oder gierigen oder traurigen Gesichtern, sie alle waren nichts Körperliches. Der Kies war kaum Kies, und das Scharren der Füße, das Knirschen der Steinchen unter den Sohlen – das waren Traumgeräusche …
Sie traten durch eine Tür und kamen in einen Raum, der so grell beleuchtet war, dass Quangel zuerst nichts sah. Seine Begleiter rissen ihn plötzlich nach vorn, an dem niederknienden Geistlichen vorbei.
Der Scharfrichter kam mit seinen beiden Gehilfen auf ihn zu. Er streckte ihm die Hand hin.
»Also, nimm mir’s nicht übel!«, sagte er.
»Nee, zu was denn?«, antwortete Quangel und nahm mechanisch die Hand.
Während der Scharfrichter Quangel die Jacke auszog und den Kragen seines Hemdes abschnitt, sah Quangel zurück auf die, die ihn begleitet hatten. Er sah in der blendenden Helle nur einen Kranz weißer Gesichter, die alle ihm zugewandt waren.
Ich träume das, dachte er, und sein Herz begann stärker zu klopfen.
Aus dem Zuschauerraum löste sich eine Gestalt, und als sie näher kam, erkannte Quangel den kleinen, hilfsbereiten Arzt im hellgrauen Anzug.
»Nun?«, fragte der Arzt mit einem matten Lächeln. »Wie geht es uns?«
»Immer ruhig!«, sagte Quangel, während ihm die Hände auf dem Rücken gebunden wurden. »Im Augenblick habe ich ziemliches Herzklopfen, aber ich nehme an, das wird sich in den nächsten fünf Minuten geben.«
Und er lächelte.
»Warten Sie, ich gebe Ihnen was!«, sagte der Arzt und griff in seine Tasche.
»Machen Sie sich keine Mühe, Herr Doktor«, antwortete Quangel. »Ich bin gut versorgt …«
Und für einen Augenblick zeigte die Zunge zwischen den dünnen Lippen die Glasampulle …
»Ja, dann!«, meinte der Arzt und sah verwirrt aus.
Sie drehten Quangel um. Jetzt sah er vor sich den langen Tisch, der mit einem glatten, stumpfen, schwarzen Überzug bedeckt war, wie Wachstuch. Er sah Riemen, Schnallen, aber vor allem sah er das Messer, das breite Messer. Es schien ihm sehr hoch über dem Kopf zu hängen, drohend hoch. Es blinkte grausilbern, es sah ihn tückisch an.
Quangel seufzte leicht …
Plötzlich stand der Direktor neben ihm und sprach mit dem Scharfrichter einige Worte. Quangel sah unverwandt auf das Messer. Er hörte nur halb hin: »Ich übergebe Ihnen als dem Scharfrichter der Stadt Berlin diesen Otto Quangel, dass Sie ihn mit dem Fallbeil vom Leben zum Tode bringen, wie es angeordnet ist durch rechtskräftiges Urteil des Volksgerichtshofes …«
Die Stimme schallte unerträglich laut. Das Licht war zu hell …
Jetzt, dachte Quangel. Jetzt …
Aber er tat es nicht. Eine fürchterliche, peinigende Neugier kitzelte ihn …
Nur noch ein paar Minuten, dachte er. Ich muss noch wissen, wie es auf diesem Tisch ist …
»Nun mal los, alter Junge!«, mahnte der Scharfrichter. »Mach jetzt keine langen Geschichten. In zwei Minuten hast du es ausgestanden. Hast du übrigens an die Haare gedacht?«
»Liegen an der Tür«, antwortete Quangel.
Einen Augenblick später lag Quangel auf dem Tisch, er fühlte, wie sie seine Füße festschnallten. Ein stählerner Bügel senkte sich auf seinen Rücken und presste seine Schultern fest gegen die Unterlage …
Es stank nach Kalk, nach feuchtem Sägemehl, es stank nach Desinfektionsmitteln … Aber vor allem stank es, alles andere übertäubend, widerlich süß nach etwas, nach etwas …
Blut …, dachte Quangel. Es stinkt nach Blut …
Er hörte, wie der Scharfrichter leise flüsterte: »Jetzt!«
Aber so leise er auch flüsterte, so leise konnte kein Mensch flüstern, Quangel hörte es doch, dieses »Jetzt!«
Er hörte auch ein surrendes Geräusch …
Jetzt!, dachte es auch in ihm, und seine Zähne wollten die Zyankaliampulle zerbeißen …
Da würgte es in ihm, ein Strom von Erbrochenem füllte seinen Mund, riss das Glasröhrchen mit …
O Gott, dachte er, ich habe zu lange gewartet …
Das Surren war ein Sausen geworden, das Sausen war ein gellendes Geschrei geworden, das bis in die Sterne, bis vor Gottes Thron zu hören sein musste …
Dann krachte das Beil durch sein Genick.
Quangels Kopf fällt in den Korb.
Einen Augenblick lag er ganz still, als sei dieser kopflose Körper verblüfft über den Streich, den man ihm da gespielt. Dann bäumte der Leib sich auf, er wand sich zwischen Riemen und Stahlbügeln, die Gehilfen des Scharfrichters warfen sich auf ihn und versuchten, ihn niederzudrücken.
Die Venen in den Händen des Toten wurden dick und dicker, und dann fiel alles zusammen. Man hörte nur das Blut, das zischende, rauschende, dumpf niederfallende Blut.
Drei Minuten nach dem Fall des Beils verkündete der bleiche Arzt mit etwas zitternder Stimme den Tod des Hingerichteten.
Sie räumten den Kadaver fort.
Otto Quangel war nicht mehr.
72. Anna Quangels Wiedersehen
Die Monate kamen, und die Monate gingen, die Jahreszeiten wechselten, und Frau Anna Quangel saß noch immer in ihrer Zelle und wartete auf das Wiedersehen mit Otto Quangel.
Manchmal sagte die Aufseherin, deren Liebling Frau Anna jetzt war, zu ihr: »Ich glaube, Frau Quangel, die haben Sie ganz vergessen.«
»Ja«, antwortete die Gefangene 76 freundlich. »Es scheint beinahe so. Mich und meinen Mann. Wie geht es Otto?«
»Gut!«, antwortete die Aufseherin rasch. »Er lässt auch grüßen.«
Sie waren sich alle einig geworden, die gute, immer fleißige Frau den Tod des Mannes nicht erfahren zu lassen. Sie bestellten ihr regelmäßig Grüße.
Und dieses Mal meinte es der Himmel gnädig mit Frau Anna: kein müßiges Geschwätz, kein pflichtbewusster Pastor zerstörten ihr den Glauben an das Leben Otto Quangels.
Fast den ganzen Tag saß sie an ihrer kleinen Handstrickmaschine und strickte Strümpfe, Strümpfe für die Soldaten draußen, strickte tagaus, tagein.
Manchmal sang sie leise dabei. Sie war jetzt fest davon überzeugt, dass Otto und sie sich nicht nur wiedersehen, nein, dass sie auch lange miteinander noch leben würden. Entweder waren sie wirklich vergessen, oder man hatte sie im Geheimen begnadigt. Es konnte nicht mehr lange dauern, und sie waren frei.
Denn so wenig die Aufseherinnen davon auch sprachen, das hatte Anna Quangel doch gemerkt: es stand schlecht draußen mit dem Krieg, und die Nachrichten wurden von Woche zu Woche schlechter. Sie merkte es auch an dem sich rasch weiter verschlechternden Essen, an dem oft fehlenden Arbeitsmaterial, durch den zerbrochenen Teil ihrer Strickmaschine, dessen Ersatz wochenlang dauerte, dass alles immer knapper wurde. Aber wenn es schlecht mit dem Kriege stand, so stand es gut für die Quangels. Bald waren sie frei.
So sitzt sie und strickt. Sie strickt ihre Träume, Hoffnungen, die sich nie erfüllen werden, Wünsche, die sie früher nie gehabt, in die Strümpfe. Sie malt sich einen ganz anderen Otto aus, als der ist, an dessen Seite sie gelebt hat, einen heiteren, vergnügten, zärtlichen Otto. Sie ist fast zu einem jungen Mädchen geworden, dem das ganze Leben noch frühlingsfroh winkt. Träumt sie nicht manchmal sogar davon, noch Kinder zu haben? Ach, Kinder …!
Seit Anna Quangel das Zyankali vernichtete, als sie beschlossen hatte, nach schwerstem Kampf, auszuhalten bis zum Wiedersehen mit Otto, es möge ihr geschehen, was wolle – seitdem ist sie frei und jung und fröhlich geworden. Sie hat sich selbst überwunden.
Und nun ist sie frei. Furchtlos und frei.
Sie ist es auch in den immer schwereren Nächten, die der Krieg jetzt über die Stadt Berlin gebracht hat, wenn die Sirenen heulen, die Flieger in stets dichteren Schwärmen über der Stadt ziehen, die Bomben fallen, die Minen zerreißend schreien und Feuersbrünste überall aufglühen.
Auch in solchen Nächten bleiben die Gefangenen in ihren Zellen. Man wagt nicht, sie in Schutzräume zu führen, aus Furcht vor Meuterei. Sie schreien in ihren Zellen, sie toben, sie bitten und flehen, werden wahnsinnig vor Angst, aber die Gänge sind leer, keine Wache steht noch dort, keine erbarmende Hand schließt die Zellentüren auf, das Wachtpersonal sitzt in den Luftschutzräumen.
Anna Quangel ist ohne Furcht. Ihre kleine Rundmaschine tickert und tuckert, reiht Maschenkreis an Maschenkreis. Sie benutzt diese Stunden, in denen sie doch nicht schlafen kann, zum Stricken. Und beim Stricken träumt sie. Sie träumt von dem Wiedersehen mit Otto, und in einen solchen Traum bricht ohrenzerreißend die Mine ein, die diesen Teil des Gefängnisses in Schutt und Asche legt.
Frau Anna Quangel hat keine Zeit mehr gehabt, aus ihrem Wiedersehenstraum mit Otto aufzuwachen. Sie ist schon bei ihm. Sie ist jedenfalls dort, wo auch er ist. Wo immer das nun auch sein mag.
73. Der Junge
Aber nicht mit dem Tode wollen wir dieses Buch beschließen, es ist dem Leben geweiht, dem unbezwinglichen, immer von Neuem über Schmach und Tränen, über Elend und Tod triumphierenden Leben.
Es ist Sommer, es ist der Frühsommer des Jahres 1946.
Ein Junge, ein junger Mann fast schon, kommt über den Hof einer märkischen Siedlung gegangen.
Eine ältere Frau begegnet ihm. »Na, Kuno«, fragt sie. »Was gibt’s heute?«
»Ich will in die Stadt«, antwortet der Junge. »Ich soll unsern neuen Pflug abholen.«
»Na«, sagt sie, »ich schreibe dir noch auf, was du mir mitbringen kannst – wenn du’s kriegst!«
»Wenn’s nur da ist, dann kriege ich es auch schon, Mutter!«, ruft er lachend. »Das weißt du doch!«
Sie sehen sich lachend an. Dann geht sie ins Häuschen zu ihrem Mann, dem alten Lehrer, der längst das Pensionsalter hat und der noch immer seine Kinder lehrt – wie der Jüngste.
Der Junge zieht das Pferd Toni, ihrer aller Stolz, aus dem Schuppen.
Eine halbe Stunde später ist Kuno-Dieter Barkhausen auf dem Wege zur Stadt. Aber er heißt nicht mehr Barkhausen, rechtens und mit allen Formalitäten ist er von den Eheleuten Kienschäper adoptiert, damals, als es klar wurde, dass weder Karl noch Max Kluge aus dem Kriege heimkehren würden. Übrigens ist auch der Dieter bei dieser Gelegenheit ausgemerzt: Kuno Kienschäper klingt ausgezeichnet und ist völlig genug.
Kuno pfeift vergnügt vor sich hin, während der Braune Toni langsam in der Sonne den ausgefahrenen Feldweg entlangzuckelt. Soll er sich Zeit lassen, der Toni, zum Mittag sind sie immer wieder zurück.
Kuno sieht auf die Felder rechts und links, prüfend, fachmännisch beurteilt er den Saatenstand. Er hat viel gelernt hier auf dem Lande, und er hat – gottlob! – fast ebenso viel vergessen. Der Hinterhof mit der Frau Otti, nein, an den denkt er fast nie mehr, und auch nicht mehr an einen dreizehnjährigen Kuno-Dieter, der eine Art Räuber war, nein, das alles gibt es nicht mehr. Aber auch die Träume von der Motorenschlosserei sind aufgeschoben, vorläufig genügt es dem Jungen, den Trecker im Dorf bei der Pflügerei trotz seiner Jugend führen zu dürfen.
Ja, sie sind schön vorangekommen, der Vater, die Mutter und er. Sie sind nicht mehr von den Verwandten abhängig, sie haben im vorigen Jahr Land bekommen, sie sind selbstständige Leute mit Toni, einer Kuh, einem Schwein, zwei Hammeln und sieben Hühnern. Toni kann mähen und pflügen, er hat vom Vater das Säen gelernt und von der Mutter das Hacken. Das Leben macht ihm Spaß, er wird den Hof schon in die Höhe bringen, das tut er!
Er pfeift.
Am Straßenrand richtet sich eine verwahrloste, lange Gestalt auf, zerlumpt der Anzug, verwüstet das Gesicht. Das ist keiner der unseligen Flüchtlinge, das ist ein Verkommener, ein Penner, ein Lump. Die versoffene Stimme krächzt: »He, Jung, nimm mich mit in die Stadt!«
Kuno Kienschäper ist beim Klange dieser Stimme zusammengezuckt. Er möchte aus dem behaglichen Toni einen Galopp herausholen, aber dafür ist es zu spät, und so sagt er mit gesenktem Kopf: »Sitz auf – nee, nicht hier bei mir! Hinten kannst du aufsitzen!«
»Warum nicht bei dir?«, krächzt der Mann herausfordernd. »Bin dir wohl nicht fein genug?«
»Schafskopp!«, ruft Kuno mit angenommener Grobheit. »Weil du hinten auf dem Stroh weicher sitzt!«
Der Mann fügt sich brummend, kriecht hinten auf den Wagen, und Toni fängt jetzt an, ganz von selber zu traben.
Der Kuno hat den ersten Schreck darüber verwunden, dass er da seinen Vater, nein, ausgerechnet den Barkhausen aus dem Straßengraben auf den Wagen hat laden müssen, ausgerechnet er, ausgerechnet den! Aber vielleicht war das gar kein Zufall, vielleicht hat der Barkhausen ihm aufgelauert und weiß genau, wer ihn da fährt.