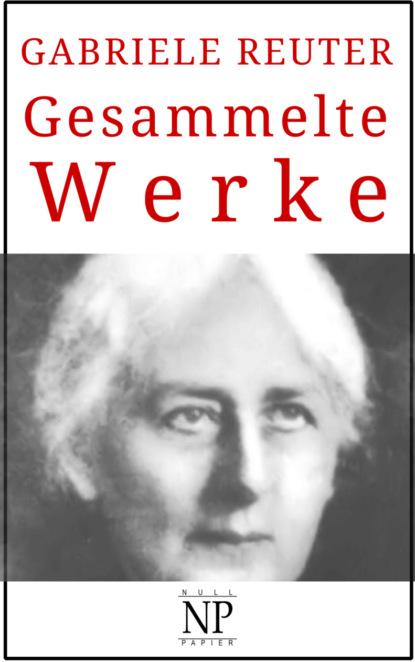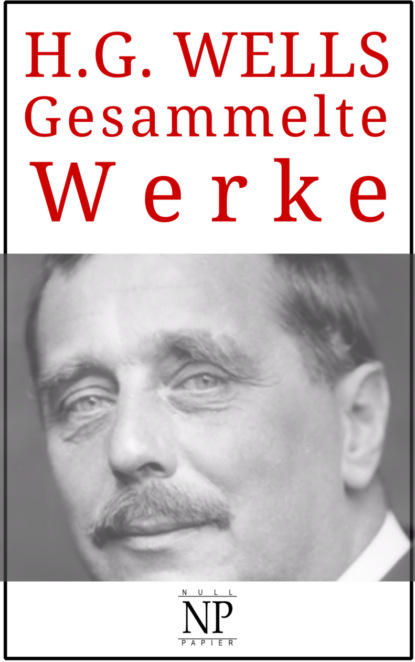Hans Fallada – Gesammelte Werke

- -
- 100%
- +
Bei unserem Lärmen hatten wir es ganz überhört, dass ein Auto vorgefahren war, und auch als zwei Herren eintraten, achteten wir kaum auf sie. Ich schrie einem Gegenüber, der gar nicht auf mich hörte, weiter irgendwelche Beteuerungen zu – und verstummte plötzlich, wie auf den Mund geschlagen, denn einer der beiden Herren, die jetzt an einem Nebentisch Platz nahmen, hatte mich mit einem freundlichen »Guten Abend!« begrüßt, und dieser Herr war Dr. Mansfeld. Den anderen Herrn kannte ich nicht.
Auch meine Zechkumpane verstummten, und auch, als sie sahen, dass nichts weiter erfolgte, sondern dass die Herren am Nebentisch, in ein Gespräch vertieft, ruhig ihr Bier tranken, kam die alte Lustigkeit nicht wieder auf. Einer nach dem anderen verdrückte sich, schließlich saß ich allein in diesem wüsten Tohuwabohu von Gläsern und Flaschen, und auch nach Elinor sah ich vergeblich aus: Sie kam nicht, das Chaos zu ordnen. Wahrscheinlich scharmutzierte sie mit dem jungen Maurer, der wohl ihr Galan war, vor der Tür.
Nach der wilden Ausgelassenheit eben hatte mich finstere Verdrossenheit überfallen, ich kaute auf meiner Lippe und schoss ab und zu einen argwöhnischen Blick nach dem Seitentisch, an dem man so gar keine Notiz von mir nahm. Mein Argwohn war erwacht; ich fragte mich, ob Dr. Mansfeld durch einen reinen Zufall, bei der Ausübung seiner Landpraxis, hierhergeraten sein könnte oder ob ihn etwa Magda hierherbeordert hatte. Ich zergrübelte meinen Kopf, ob ich etwa Magda damals in meiner Betrunkenheit den Namen des Ausflugsortes genannt oder doch so auf ihn hingedeutet hatte, dass er unschwer zu erraten war – ich wusste es nicht mehr. Der zweite Herr kam mir bekannt vor, aber ich wusste nicht, wohin ich ihn tun sollte …
Wieder hätte ich gerne etwas getrunken, die Kornflasche stand nahe genug vor mir, und doch wagte ich es nicht, vor den beiden Gästen am Nebentisch mir das Glas auch nur einmal vollzuschenken. Ich sagte mir wohl, dass angesichts dieses Tisches und meines wilden Benehmens vorhin nicht mehr das geringste zu verderben war, und doch wagte ich es nicht.
Schließlich betrat Elinor wieder den Schankraum. Ich rief sie zu mir und bat sie leise, die Zeche zu machen. Während sie auf einem Block viele Zahlen aufschrieb, gebückt vor mir stehend und mich dadurch gegen die Sicht vom Nebentisch deckend, schenkte ich mir erst zwei, drei Schnäpse ein, dann verkorkte ich die Flasche sorgfältig und schob sie in meine Aktentasche. Elinor warf einen raschen Blick auf mein Tun und flüsterte mit hochgezogenen Augenbrauen, zum Nebentisch deutend: »Freunde?« Ich zuckte nur die Achseln.
Die Rechnung war so hoch, dass ich mein Geld wirklich bis auf die letzte Mark hergeben musste und dass auch dann noch das Trinkgeld für Elinor höchst ungenügend ausgefallen war. Wieder sah sie mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und flüsterte: »Abgebrannt?«
Ich antwortete ebenso leise: »Ich weiß, wo es mehr gibt. Das nächste Mal, ma reine!« Wozu sie leicht nickte.
Ich musste jetzt aufstehen und gehen, unter den beobachtenden Blicken des Nebentisches. Ich fasste meine Aktentasche und vergewisserte mich durch einen musternden Blick, auf welchem Haken mein Hut hing, damit ich ihn beim Hinausgehen nicht unnötig suchen musste, und stand auf. Ich fühlte, es würde gehen. Ich musste mich langsam und sehr vorsichtig bewegen, dann würde es schon gehen. Schließlich brauchte ich nur vors Dorf und ins erste bergende Gebüsch zu kommen, ja, schließlich – genialer Einfall! – ich brauchte mich nur hier auf der Toilette einzuriegeln, und ich konnte schlafen, solange ich wollte. Frischen Proviant hatte ich ja bei mir.
Ich hatte zum Nebentisch, schon im Aufstehen, höflich »Guten Abend« gesagt, und nun war ich schon unter der Tür, einen Schritt entfernt von der Rettung, als hinter mir eine Stimme sagte: »Ach, einen Augenblick, Herr Sommer!«
Ich schrak so zusammen, dass ich fast gefallen wäre. »Wie bitte?«, rief ich unnötig laut.
Der Arzt hatte nach meinem Arm gegriffen und mich gehalten. »Habe ich Sie erschreckt? Das wollte ich nicht. Es tut mir leid.«
»Ach, nichts, nichts«, sagte ich verlegen. »Es war wohl nur der elende Läufer, ich bin über ihn gestolpert …« Und ich sah böse auf den glatt daliegenden Teppich.
»Ich wollte Sie nur fragen, Herr Sommer«, fing Dr. Mansfeld wieder an, »ob ich Ihnen vielleicht anbieten darf, in meinem Auto mit uns heimzufahren?« Er machte eine Pause, dann sagte er lächelnd: »Wir haben ein bisschen gefeiert, nicht wahr? Nun, das macht nichts, das tut jeder von uns einmal gerne. Aber der Rückweg würde Ihnen vielleicht ein bisschen schwerfallen, was? Also, Sie fahren mit uns.« Er fasste mich freundlich, aber fest unter den Arm. Der andere Herr hatte unterdes bezahlt und trat nun zu uns. »Darf ich Sie bekannt machen?«, fuhr der Arzt fort. »Herr Sommer – Herr Medizinalrat Dr. Stiebing, unser Kreisarzt.« Damit führte er mich aus dem Lokal und auf das Auto zu. Ich aber folgte ihm wie ein Schaf seinem Schlächter. Der Kreisarzt!
Das war kein Zufall mehr, das war eine mir listig gestellte Falle! Verdammte Magda! Sie wollte mich reinlegen, sie handelte schnell, das musste ich zugeben. Aber auch ich war klug, ich musste mich verstellen, listig sein, Scharfsinn mit Scharfsinn übertrumpfen. »Nun«, lachte ich plötzlich heiter, »zwei Ärzte, die werden ja wohl mit einem armen Berauschten fertig werden, was? Machen Sie es gnädig mit mir, meine Herren!« Damit setzte ich mich hinten in den Wagen, während die beiden anderen Herren, ebenfalls lachend, vorn Platz nahmen.
Wir wollten schon losfahren, als Elinor aus dem Hause gelaufen kam. Sie trug in den Händen ein hässliches, in Zeitungspapier gewickeltes Paket. Sie reichte es mir in den offenen Wagen. Laut sagte sie: »Das sind Ihre Schuhe, die Sie neulich nachts hier vergessen haben!« Höhnisch lachend sah sie mich mit ihrem weißen, großen Gesicht und den farblosen Augen an. Ihr Mund war sehr rot.
Nach einem betretenen Schweigen fragte der Arzt: »Können wir jetzt fahren?«
Ich antwortete: »Ja«, und der Wagen fuhr los.
12
Ich bin völlig außerstande, meine Stimmung während dieser Fahrt zu schildern. Abgrundtiefe Verzweiflung wechselte mit einer lähmenden Apathie, die mich selbst in diesem Zustande noch erschreckte. Es war, als läge ich in einem schweren Schreckenstraum gefangen, jeden Augenblick nahe dem Erwachen, und konnte doch nicht wach werden, geriet in immer tiefere, immer grausigere Schrecknisse. Neben mir auf dem Sitz lag das Paket mit den Schuhen, das Zeitungspapier hatte sich geöffnet, und ich sah sie da liegen, mit verwischtem Staub beschmutzt, eine Sohle sah mich an – einfach abscheulich. Abscheulich diese Tat der hübschen Elinor, würdig einer Königin des Schnapses.
›Ja‹, dachte ich, ›so narrt und quält der Alkohol seine Jünger. Solcher Überraschungen ist nur er fähig. Man meint, sicher zu sein, sich gut verstellt, das Schlimmste vermieden zu haben, und plötzlich steckt er seine grinsende Teufelsfratze hervor, zerfleischt mit seinen Klauen deine Brust, lässt dich erbeben, vernichtet deine Würde … La reine d’alcool – sehe ich dich je wieder, bekommst du keine gute Stunde mit mir, Elinor!‹
Ich hielt es nicht mehr aus. Mit einem Blick vergewisserte ich mich, dass die beiden Herren vor mir in ein eifriges Gespräch vertieft waren; ich zog die Flasche aus der Tasche, entkorkte sie vorsichtig und tat ein paar kräftige Schlucke. Aber ich hatte nicht an den Rückspiegel über dem Führersitz gedacht.
»Nicht zu viel jetzt und nicht zu hastig, mein lieber Herr Sommer«, sagte Dr. Mansfeld und hob vom Steuer eine mahnende Hand. »Wir hätten nachher gerne noch ein vernünftiges Wort mit Ihnen gesprochen!«
Dieser Schurke, dieser glatte medizinische Schurke! Jetzt, da er mich in seinem Wagen hatte, ließ er die Maske fallen: Nicht nach meinem Heim wurde ich gefahren, sondern zu einer ärztlichen Besprechung, bei der ganz zufällig auch der Medizinalrat als Kreisarzt zur Hand war!
Von da an war ich ganz ruhig und gesammelt. Der eben getrunkene Schnaps verlieh mir neue Kraft und Konzentration. Ich hatte ein festes Ziel vor Augen: diese Unterredung fürs Erste unter allen Umständen zu vereiteln. Später, unter für mich günstigeren Umständen, gerne, aber heute, so überlistet, auf Bestellung meiner Gnädigsten: ›Da muss ich schon danken, meine Liebe!‹
Das Auto fuhr und fuhr, schon waren wir im Außenbezirk unserer Stadt, und noch immer hatte sich keine Möglichkeit geboten, als Teilnehmer an dieser Fahrt auszuscheiden. Dann aber kam aus dem Fuhrhof von Hases einer seiner großen Lastzüge mit zwei Anhängern etwas überraschend hervor. Schon während der Doktor den Wagen auf die linke Straßenseite hinüberriss, dabei scharf bremsend, hatte ich leise die Wagentür geöffnet, nun, da der Lastzug passiert war und der Arzt schon wieder Gas gab, sprang ich leicht ab, einen Augenblick taumelte ich, rannte vorwärts neben dem Wagen, drohte zu fallen und hatte mich gefangen.
Ich stand, winkte mit der Hand dem Wagen nach, den Passanten vorgebend, dieses plötzliche Aussteigen sei mit Wissen der Insassen geschehen, und schritt dann rasch, rechts von der Straße abbiegend, am Zaun des Fuhrhofes hoch, zu einer kleinen verfallenen Kolonie, die man in der Stadt nur »Klein-Russland« nannte. Ich schüttelte mich innerlich vor Lachen, dass die beiden weisen Ärzte von ihrer Expedition nichts heimbrachten als die Schuhe des Trinkers.
13
Am unangenehmsten in meiner augenblicklichen Situation war es, dass ich praktisch ohne einen Pfennig Geld auf der Straße stand. Nach Haus an meinen Schreibtisch, wo wenigstens etwas lag, konnte ich nicht gehen, denn ich musste mit Bestimmtheit annehmen, dass die Ärzte, sobald sie mein Fehlen merkten, dort zuerst nach mir sehen und Madame Magda Bericht erstatten würden. Für einen Bankbesuch war es zu spät, die Schalter waren schon seit zwei Stunden geschlossen. Eben, als ich dies auf meiner Uhr festgestellt hatte, fiel mir ein, dass ich ja noch diese Uhr besaß, dazu einen schweren goldenen Siegelring und schließlich einen auch ganz durablen Ehering, der nach meinem heutigen Auftritt mit Magda auch seinen eigentlichen Sinn verloren hatte.
Ich war also keinesfalls von allen Mitteln entblößt, und getrost lenkte ich meine Schritte in die eine enge und schmutzige Gasse, die durch »Klein-Russland« führte. Diese Kolonie war in den Elendsjahren nach dem Weltkrieg aus einem Lager für russische Gefangene entstanden. In der Hauptsache wohnten dort jetzt Polen, auch andere Ausländer. Die ehemaligen Baracken waren durch mancherlei An- und Umbauten verändert, aber nicht verschönert worden. Dazwischen standen kleine rohe Steinhäuschen, die schon wieder verfielen, ehe sie noch recht fertig geworden waren. Zögernd ging ich die Gasse entlang, selbst sehr unsicher, was ich hier eigentlich sollte und wollte, als mein Blick auf ein Fenster in einem solchen Steinkasten fiel, in dem das bekannte rote Schild hing, das meist Vermietungen anzeigt. Ich trat näher und las, dass hier tatsächlich ein behaglich möbliertes Zimmer an einen anständigen Herrn zu vermieten sei.
Eine Klingel gab es nicht an diesem Haus, ich trat durch eine offene Tür und geriet sofort in eine Küche, die ganz vom Wrasen kochender Wäsche erfüllt war. Ich konnte niemanden sehen, so rief ich mit lauter Stimme ein »Hallo!«, und aus dem Wrasen tauchte ein langer, vornübergebeugter, aber noch junger Mann auf, gelblich bleich, mit einem weichen dunklen Vollbart und etwas hellerem bräunlichem Haar, das in der Strähne über der Stirn einen goldigen Schein hatte. Dieser Mann musterte mich mit einigem Erstaunen und fragte dann sehr höflich, mit sanfter Stimme, was mir zu Diensten stünde.
»Ich möchte mir das Zimmer ansehen, das zu vermieten ist.«
»Für Sie selbst?«, fragte der Mann und rieb hüstelnd seine Hände aneinander.
Ich bejahte.
»Es wird kein Zimmer für den Herrn sein, nicht fein genug für den Herrn. Es ist ein Arbeiterzimmer, mein Herr.«
»Immerhin, zeigen Sie es mir«, beharrte ich.
Er ging mir schweigend voran, eine Treppe hinauf, über einen unausgebauten Boden, öffnete die Tür zu einem einfenstrigen Zimmerchen mit schrägen Wänden, das im Giebel ausgebaut war. In seiner Einrichtung ähnelte es fast ganz dem primitiven Zimmer von Elinor, und unwillkürlich trat ich an das Fenster, um zu sehen, ob auch hier ein schräges Pappdach Fluchtmöglichkeiten bei überraschendem Besuch böte.
Nein, dieses Pappdach fehlte hier, dafür aber gab es einen ganz überraschenden Ausblick auf meine Vaterstadt. Sie lag vor mir, ein wenig unter mir, mit ihren rotbraunen Dächern, ihren drei spitzen Kirchtürmen und ihrem einen rundköpfigen Rathausturm. Grün umlaubt schlängelte sich die Schmie[39] hindurch, verschwand hier und blitzte dort auf, und indem ich ihren Lauf mit dem Auge verfolgte, sah ich in der Ferne, schon zwischen dem Grün der Gärten und Felder, von bläulichem Dunst verschleiert, ein Dach, mein Dach.
»Es ist eine schöne Aussicht«, sagte ich nach einer Weile.
Der Mann hinter mir hüstelte. »Ein Arbeiter«, sagte er, »fragt nicht nach der Aussicht, er fragt, ob das Bett auch gut ist. Das Bett ist gut, Herr.«
»Was soll das Zimmer kosten?«, fragte ich.
»Sieben Mark die Woche«, sagte der Mann, »und wir wechseln jede Woche die Wäsche.«
»Ich möchte hier auch essen«, sagte ich, »ich will in aller Stille hier ungestört zwei bis drei Wochen wohnen und an einer Arbeit schreiben. Ich werde das Haus kaum verlassen. Lässt sich das einrichten? Ich stelle keine großen Ansprüche.«
»Unser Essen ist für den Herrn zu einfach«, sagte der Mann. »Aber ich kann für Sie Essen aus einem Gasthaus holen lassen, wenn Ihnen das recht ist.«
»Gut«, sagte ich, »ich nehme das Zimmer. Mein Koffer kommt morgen. Lassen Sie mir dann Abendessen holen.« Und ich setzte mich an den Tisch.
»Ich bitte um eine kleine Anzahlung, mein Herr«, sagte mein Wirt und zog an seinen Händen, dass die Knöchel knackten. »Wir sind arme Leute, mein Herr …«
»Setzen Sie sich«, sagte ich zu meinem Wirt. »Ach, bitte, ich sehe da auf dem Waschtisch ein Wasserglas, wenn Sie das bitte holen wollten.«
Mein Wirt tat es und nahm auf meine nochmalige Aufforderung am Tische Platz.
»Wie heißen Sie?«
»Polakowski«, antwortete er. »Aber wir sind keine Polen. Meine Eltern schon sind aus Ostpreußen zugewandert, dort gibt es so komische Namen …«
»Ich kümmere mich nicht darum, ob Ihr Name komisch ist oder nicht, Herr Polakowski«, sagte ich gönnerhaft. »Jetzt wollen wir erst einmal anstoßen.« Ich goss ihm das Glas halb voll – trotz seines Protestes – und griff nach der Flasche. »Ich kann ja auch einmal aus der Flasche trinken«, sagte ich lachend. »In unserer Jugend haben wir das alle getan.«
Er lächelte matt und nahm ein Schlückchen, während ich kräftig trank.
»Ich muss Sie bitten, Herr Polakowski«, sagte ich dann geläufig, »dass Sie mir auch eine Flasche Korn mit dem Abendessen mitbringen lassen, aber keinen Fusel, bitte, sondern den besten, der für Geld zu haben ist.«
Ich sah, wie er die Lippen bewegte, und ahnte schon, was er sagen wollte.
»Was nun die Anzahlung angeht, so muss ich Ihnen sagen, dass ich mich ganz plötzlich zu dieser Arbeit entschlossen habe.«
Ich fing den Blick meines Wirtes auf, der nachdenklich meine offene und völlig leere Aktentasche betrachtete.
Ich lachte. »Nun, ich will Ihnen die Wahrheit gestehen, Herr Polakowski. Das von der Arbeit, die ich hier in aller Stille schreiben will, ist natürlich Schwindel. Die Wahrheit ist, dass ich mich heute Nachmittag ziemlich heftig mit meiner Frau verzankt habe. Und um die etwas zu ängstigen, will ich für ein oder zwei Wochen verschwinden. Verstehen Sie, ich will sie ein bisschen auf den Proppen setzen!«
Herr Polakowski nickte.
»Ich will ihr begreiflich machen, wie das ist ohne Mann, nicht wahr?«
Wieder nickte Herr Polakowski.
»Sie soll einmal fühlen lernen, wie nützlich ich ihr bin, wie unentbehrlich!«
Wieder nickte Herr Polakowski, dann sagte er mit seiner sanften, fast flüsternden Stimme: »Trotzdem, mein Herr, ohne Anzahlung kann ich Sie nicht aufnehmen. Wir sind sehr arme Leute hier in Klein-Russland, mein Herr, und ein Abendessen aus einem guten Gasthof und eine Flasche Korn vom besten kosten viel Geld.«
»Sie werden Geld, soviel Sie brauchen, morgen früh bekommen, Herr Polakowski«, sagte ich überredend. »Morgen früh um neun Uhr stehe ich auf meiner Bank und hole Geld ab.«
»Nein«, sagte mein Wirt. »Es tut mir leid, mein Herr, ich hätte Sie gerne als Gast gehabt, einen gebildeten Mann, der seine Frau ein bisschen ängstigen will – nach Herrenart. Wir, wir schlagen unsere Frauen, das ist einfacher und billiger.«
»Nun ja, nun ja«, lachte ich ein bisschen verlegen. »Ich weiß nur nicht, ob ich bei einer Schlägerei mit meiner Frau nicht den Kürzeren ziehen würde, ich fürchte, sie ist die Stärkere.« Ich lachte und trank. »Aber da es Ihnen so um eine Anzahlung zu tun ist, will ich Ihnen einen Ring zum Pfand geben.« Ich zog erst den Siegel-, dann den Ehering vom Ringfinger der rechten Hand. Einen Augenblick schwankte ich, dann gab ich Polakowski den Ehering. »Es wäre mir lieb, wenn Sie ihn in Pfand behielten, als Sicherheit bis morgen früh, und ihn nicht weitergäben.«
Herr Polakowski nahm den Ring aus meiner Hand. »Wir sind sehr arme Leute, mein Herr«, sagte er wieder mit seiner flüsternden Stimme. »Wir haben keine drei Mark im Hause. Aber ich werde den Ring bei einem ganz sicheren Mann in Pfand geben, und morgen Mittag lösen wir ihn dann wieder aus.«
»Schön, schön«, antwortete ich plötzlich gelangweilt und doch auch wieder durch all diese Umständlichkeiten gereizt. »Aber sehen Sie jetzt auch zu, dass Essen und Korn möglichst bald kommen, vor allem der Korn. Sie sehen, in der Flasche ist fast nichts mehr, und wie Sie wissen, muss man Kummer ersäufen.«
»Es wird alles ganz schnell gehen, mein Herr«, flüsterte mein Wirt sanft und schloss die Tür.
Ich aber warf mich auf das Bett und trank.
So wurde ich mit Polakowski bekannt, einem der gemeinsten Schurken und Heuchler, die ich in meinem Leben kennengelernt habe.
14
Für diese Nacht hatte ich mir den festen Plan gemacht, nach Mitternacht in mein Heim zu gehen, dort einen Koffer mit Wäsche, Kleidern und Toilettenzeug zu packen und an Geld zu holen, was dort in meinem Schreibtisch lag. Denn ich hatte wirklich vor, einige Wochen bei Polakowski in aller Verborgenheit zu leben. Mir schwebte vor, mich dort selbst in aller Stille des Alkohols zu entwöhnen; den ersten Tag wollte ich noch das gewohnte Quantum trinken, den folgenden Tag um ein drittel weniger und so immer weiter, bis ich nach etwa zwei oder drei Wochen als nüchterner Mann vor Magda und die Ärzte treten und fragen konnte: »Was wollt ihr nun eigentlich von mir?!«
Ich hielt es für sehr möglich, dass mich Magda bei dieser nächtlichen Packerei überraschte, aber ein Zusammentreffen mit ihr scheute ich nicht, nein, ich wünschte es eher. In der Stille der Nacht würde ich ihr ungestört einige bittere Wahrheiten über die Gemeinheit sagen können, einem Mann, mit dem sie immerhin eine fünfzehnjährige Ehe verband, hinterlistig Ärzte auf den Hals zu hetzen. Sie hatte die Kameradschaft zwischen uns gebrochen, und ich zweifelte je länger, je weniger daran, dass sie letzten Endes nur nach einer Vormundschaft über mich und nach meinem Besitz trachtete. Das alles wollte ich ihr ganz unverblümt sagen.
Leider wurde aus meinem schönen Plan nichts. Wieder einmal spielte mir der Alkohol einen bösen Streich. Nicht, dass er mich, wie schon einige Male vorher, in einen betäubten, traumlosen Schlaf niederwarf, der mich die richtige Stunde versäumen ließ, nein, diesmal hatte ich ein viel schlimmeres Erlebnis: Mein Körper verweigerte mir den Dienst, mein Magen streikte.
Ich hatte noch, mit einigem Widerwillen wohl, aber aus Pflichtgefühl, einen Teil des geholten ganz ordentlichen Abendessens zu mir genommen und hinterher kräftig getrunken. Ich hatte mich wieder aufs Bett gelegt und war bereit, in einem dämmernden Halbschlummer die Stunde meines Fortgehens heranzuwarten; da fing mein Magen an zu würgen, er empörte sich, ich musste hoch, ich musste endlos und unter qualvollen Schmerzen erbrechen. Mein ganzer Körper war mit Schweiß bedeckt, meine Hände und meine Knie zitterten, mein Herz pochte laut und schmerzhaft, zögernd, als wollte es jeden Augenblick aussetzen. In meinen Augen standen Tränen, es flimmerte vor ihnen, durch mein Hirn zogen Schleier, oft war ich wie bewusstlos.
Endlich lag ich wieder auf meinem Bett, zu Tode erschöpft, von einer wahnsinnigen Angst gepackt: Nahte jetzt schon das Ende? So schnell schon? Ich hatte doch noch gar nicht lange und gar nicht übermäßig viel getrunken? Wurde man so schnell zu einem Trinker? So rasch also baute der Alkohol einen Körper ab? Nein, ich wollte noch nicht sterben! Ich hatte diese Trinkerzeit immer nur als ein Durchgangsstadium angesehen; ich war überzeugt gewesen, dass ich mit ihr jederzeit Schluss machen könnte, ohne Schädigung für mich – und nun schon sollte alles zu Ende sein? Nein, das war unmöglich! Ich wollte nicht, ich würde wieder gesund sein, bald schon, vielleicht morgen schon; dieses gallenbittere Brechen musste eine andere Ursache haben! Sicher war etwas an dem Abendessen gewesen!
Es ist seltsam, dass ich auch in diesem Zustand schwerster Vergiftung mit keinem Gedanken dem Alkohol abschwor. Im Gegenteil, ich vermied es ängstlich, an ihn auch nur zu denken. Er konnte nicht die Ursache sein, ihn konnte ich nicht aufgeben. Er war mein einziger guter Freund in diesen Tagen der Verlassenheit und Erniedrigung! Und kaum hatte ich mich ein wenig erholt, kaum gingen Atem und Herz etwas ruhiger, da griff ich wieder zur Flasche, trank von Neuem, die Träume zu rufen, das Vergessen zu rufen, einzugehen in das süße Nichts, in dem man weder Sorgen noch Freuden kennt, in dem man weder Vergangenheit noch Zukunft hat.
Eine Weile tat der Schnaps auch seine Schuldigkeit; entspannt und ein wenig glücklich lag ich da. Dann jagte mich wieder das Erbrechen hoch, ein noch viel qualvolleres, würgenderes Erbrechen, da der Magen nun nichts mehr enthielt als die paar Schlucke Schnaps.
So verbrachte ich diese Nacht, zwischen Trinken und Brechen; schließlich konzentrierte ich meinen ganzen Willen nur darauf, mit aller Kraft das Brechen möglichst lange zurückzuhalten, damit der Alkohol doch einige Minuten Zeit hätte, durch die Schleimhäute des Magens in den Körper überzugehen, ehe ihn neues Würgen heraustrieb. Es war so schade um den schönen Schnaps!
Endlich fiel ich gegen Morgen in einen unruhigen Schlaf der Erschöpfung, durch den wüste, mich quälende Traumbilder gaukelten. Polakowski weckte mich aus ihm, er stand unter der Tür und bemerkte hüstelnd, dass es gleich neun sei, ob er den Kaffee bringen solle? Ich sagte ihm unwillig, dass ich auf Kaffee verzichte, er solle mir sofort eine neue Flasche holen lassen.
Ohne auf meine Worte zu achten, fing er an, die wüste Unordnung im Zimmer zu beseitigen, öffnete auch das Fenster, durch das frische Luft und Sonne eindrangen.
Erschöpft, matt, wehrlos blinzelte ich ins Licht. »Machen Sie doch zu, Polakowski«, bat ich ärgerlich. »Ich habe eben die Flasche leer getrunken, sorgen Sie sofort für eine neue!«
»Sie wollten doch um neun auf Ihre Bank gehen, mein Herr«, erinnerte mich Polakowski auf seine leise, flüsternde Art. »Es ist neun.«
»Ich kann jetzt nicht gehen«, sagte ich ärgerlich. »Sie sehen doch, dass ich krank bin, Polakowski. Ich werde morgen gehen oder heute Nachmittag. Jetzt holen Sie erst den Schnaps.«
»Dann muss ich den Ring verkaufen, mein Herr«, sagte Polakowski. »Der Jude hat mir nur fünfzehn Mark drauf geben wollen; wenn ich ihn verkaufe, bekomme ich fünfundzwanzig Mark.«
»Fünfundzwanzig Mark!«, rief ich empört. »Der Ring hat neu neunzig Mark gekostet!«
»Jetzt ist es ein alter Ring, und der Jude will auch leben, Herr«, flüsterte Polakowski gleichmütig. »Wenn ich den Ring für fünfundzwanzig Mark verkaufen darf, ist der Korn sofort hier.«
»Und wie können fünfzehn Mark schon alle sein?«, rief ich erbittert. »Ein Abendessen und eine Flasche Korn – das macht doch keine fünfzehn Mark!«
»Und die Zimmermiete, mein Herr?«, fragte Polakowski einschmeichelnd. »Soll ich armer Mann gar nichts haben? Ich muss Ihnen übrigens zwölf Mark für die Stube rechnen, Herr … Ich weiß, ich weiß«, sagte er eilig und knackte wieder einmal besonders laut und ekelhaft mit seinen Gelenken. »Ich habe sieben Mark gesagt, und ich bin ein Mann von Wort. Aber Sie machen viel Wirtschaft, Herr, und Sie richten das Zimmer hin, und Sie gehen mit Kleidern und Schuhen ins Bett, das ruiniert die Wäsche! Das kostet alles Geld, und wir sind sehr arme Leute …«