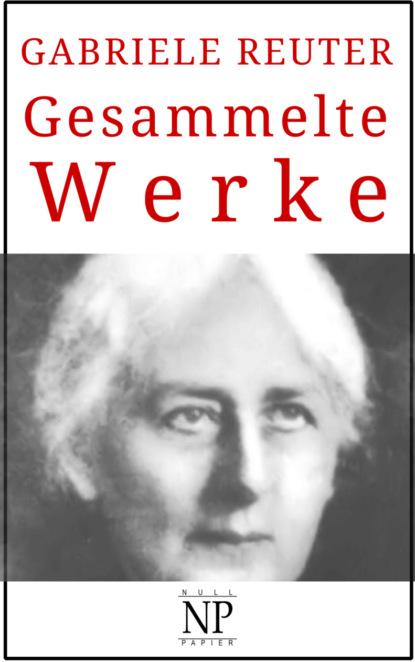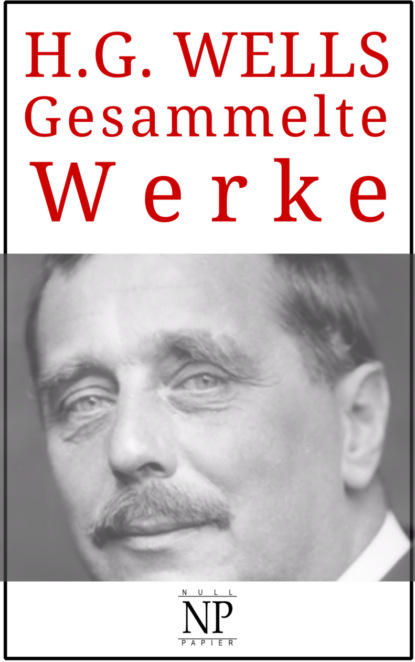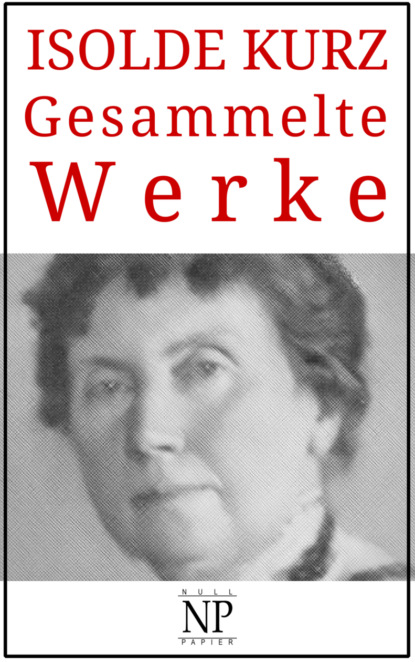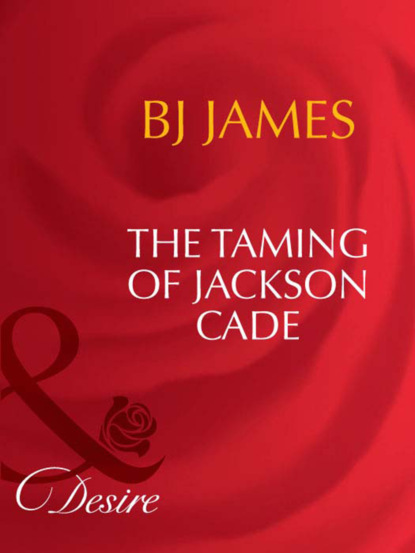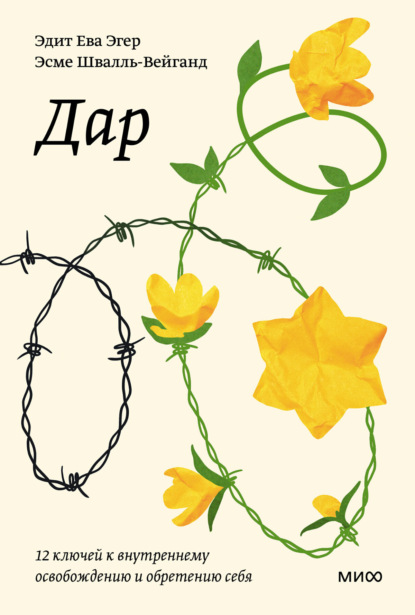Hans Fallada – Gesammelte Werke
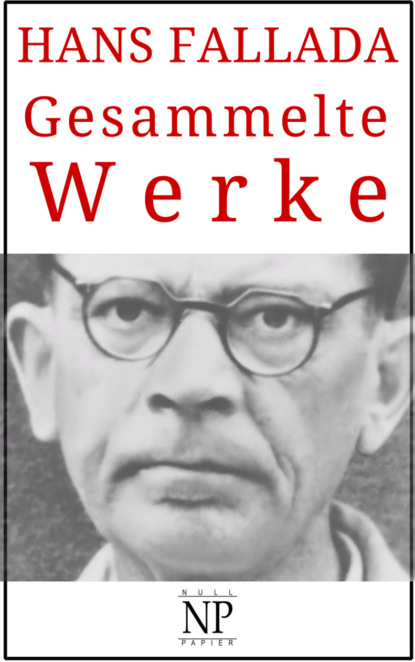
- -
- 100%
- +
Mir aber machte es Kummer, dass ich mich so von ihm beschenken ließ, dass ich seine Gesellschaft, sein liebenswürdiges Geplauder hinnahm, ohne irgendwie meine tiefe Dankbarkeit zu zeigen. Wer war ich schon? Ein kleiner, mittelmäßiger, entgleister Kaufmann! Ja, keine drei Tage, und ich gehörte zu den ergebensten Bewunderern Hans Hagens. Nicht zu seinen blindesten – ich durchschaute ihn schnell genug. Ich schlief schlecht, ich hatte jede Nacht viele Stunden, über Hans Hagen nachzudenken, ich war es müde, immer nur über Magda und mein trauriges Schicksal zu grübeln. Ja, ich zerbrach mir den Kopf, wie ich ihm danken könnte, aber ich hatte ja nichts, gar nichts. Ich war der Allerärmste im Bau. So bin ich für immer in Hans Hagens Schuld geblieben.
46
Es gehörte zu den Unbegreiflichkeiten unserer Verwaltung, dass sie in dieser Schar von sechsundfünfzig abgelebten, tierischen und verbrecherischen Männern auch zwei junge Burschen leben ließ, einen Siebzehn- und einen Achtzehnjährigen. Man hätte denken sollen, dass dieses Haus, dessen Wände ständig von Zoten, Flüchen, Streitereien widerhallten, dessen Atmosphäre von Hass und Niedertracht getränkt war, alles andere als ein geeigneter Erziehungsort für Jugendliche war, vor denen noch ein ganzes Leben lag. Aber sie waren unter uns, nicht nur vorübergehend, sondern für die Dauer, sie teilten unseren Schlafsaal, unseren Tisch und unsere Arbeit. Ich zweifele auch nicht daran, dass sie unsere Art zu denken und zu fühlen teilten, und wenn sie etwas von uns Älteren unterschied, so dies, dass ihre Schlechtigkeit wohl von einem Schimmer der Jugend verklärt, aber berechnender und feiler war als die unsere.
Es waren beides hübsche Jungen; der eine, Kolzer mit Namen, scheidet hier bei meinem Bericht über Hans Hagens seltsame Lebensumstände ganz aus, vielleicht spreche ich später in anderem Zusammenhang noch von ihm. Der andere, der Achtzehnjährige, Schmeidler hieß er, gehörte zu Hans Hagens engstem Kreis. Weiter gehörte zu diesem engsten Kreis noch der schon oben erwähnte Liesmann, der finstere wortkarge Schläger mit dem schwarzen Lederlappen vor dem rechten Auge, und, auch zu diesem Kreis gehörig, eine lange, seltsame, etwas donquichottehafte Figur von neunundzwanzig Jahren, ein halber Pole, Brachowiak mit Namen.
All diesen Dreien war, im Gegensatz zu Hans Hagen, gemeinsam, dass sie seit ihrem sechsten Jahre in öffentlichen Anstalten gewesen waren. Sie waren im Waisenhaus untergebracht gewesen und in der Fürsorgeerziehung, sie hatten ins Gefängnis gemusst und waren schließlich in diesem Hause gelandet. Obwohl sie sich immer gegen seinen Zwang auflehnten und über ihn murrten, fühlten sie sich doch nur wohl in solchen Häusern, ihre vergiftete Atmosphäre war ihnen Lebensatem. Alle drei waren schon mehrfach probeweise in die Freiheit entlassen worden, und alle drei hatten sich in ihr nicht bewährt: Schon nach vier, sechs Wochen waren sie wieder in die festen Häuser zurückgekehrt, meist zuerst in ein Gefängnis, da sie draußen jede Arbeit scheuten und nur von Diebstahl leben wollten.
Mit einem ungläubigen Erstaunen hörte ich zuerst, dass Liesmann, den ich ständig in des strahlenden Hagen Nähe sah, der sein vertrautester Freund war, mit dem alles geteilt wurde, dass also Liesmann derjenige war, mit dem sich der König Hagen so wild geschlagen hatte, dass ihm das acht Wochen strengen Arrest eingetragen hatte. Aber ich musste es glauben, ich hörte es vom Oberpfleger selbst, dass, von kleineren Schlägereien abgesehen, Hagen sich schon dreimal »erfolgreich« mit Liesmann geprügelt hatte: Einmal hatte er ihm die Kinnlade ausgerenkt, einmal die Hand durchstochen und beim letzten Mal ihm das Auge so verletzt, dass Liesmann die Sehkraft darauf fast völlig eingebüßt hatte.
Ja, ich musste es schon glauben, denn Hagen selbst war es, der einmal die schwarze Klappe von Liesmanns Auge fortzog, mir das starre, finstere Auge zeigte und sagte: »Da habe ich dem Hein reingeschlagen. – Kannst du jetzt schon wieder ein bisschen sehen, Heini?« Rührend besorgt klang das.
»So, als hätte ich zu lange in die Sonne gesehen …«, antwortete Liesmann friedlich.
Ja, sie waren die besten Freunde, sie sorgten füreinander. Liesmann ging los und schaffte Tabak an, er erpresste die Schwächeren bedenkenlos, schlug sie, und den Raub teilten sie sich dann. Sie sorgten füreinander, und dann schlugen sie sich, schlugen sich nicht nur soso, sondern auf Tod und Leben, auf »du musst verrecken«, von einer blinden, wütenden Eifersucht angetrieben. Denn da war dieser kleine, hübsche, achtzehnjährige Bengel Schmeidler, diese männliche Hure, die im Allgemeinen friedlich zwischen den beiden geteilt wurde. Und dann hatte der Georg, der Otsche Schmeidler, den einen von beiden ein bisschen bevorzugt, so entbrannte der Kampf.
Es war alles wie draußen, wie in der schönen Freiheit, es hätte ja nicht der Hans Hagen sein müssen, wenn er sich nicht auch in diesem Totenhaus die Genüsse der Liebe verschafft hätte, einer verderbten, finsteren Liebe, aber doch der Liebe, mit allen ihren Wonnen und Gefahren. Dieser Junge mit dem blonden gewellten Haar, den blauen Augen, einem fast griechischen Profil mit steiler Nase und festem Kinn, da lief er zwischen diesen Männern umher, im kurzen Hemd tüffelte er morgens in den Waschsaal, seine schlanken weißen Glieder befleckte noch keine Schweinsbeule – sie wendeten die Köpfe nach ihm, in ihre Augen kam ein Leuchten, ihr Herz pochte schneller – im trostlosen Haus war dieser Tag wieder nicht ganz trostlos! Die Liebe, auf dem Müllhaufen eine Blume, sie verwirrte dieses Haus; andere Männer strichen lüstern am Rande dieses Kreises und wagten sich nur nicht zu nähern, weil sie die rohe Gewalt Liesmanns und die listigen Jiu-Jitsu-Griffe Hagens fürchteten.
Schmeidler aber, das Kind, die Hure, ließ auch diese fernen, stummen Verehrer nicht außer Acht. Er »kochte sie ab«, er nahm ihren letzten Tabak, für ein Lächeln bekam er Brot, für einen raschen zärtlichen Griff das beste Stück aus dem eben angekommenen Fresspaket. Oh, er sorgte auch für den gemeinsamen Haushalt, der Otsche Schmeidler, er ließ sich nicht nur aushalten, er steuerte auch bei. Und seine beiden Freunde waren großzügig, sie waren Lebemänner, sie drückten ein Auge zu, kurz gesagt, auch der charmante Hans Hagen war ein Zuhälter, nichts mehr und nichts weniger. Er ließ seine Jungenshure laufen, wenn sie nur anschaffte. Habe ich nicht gesagt, dass wir in einer Hölle lebten? Es fehlte nichts in dieser Hölle, auch die Liebe nicht, aber auch die Liebe war verderbt, sie stank!
47
Ich hätte nie so viel von diesem seltsamen Verhältnis erfahren, wäre ich nicht bei unseren kärglichen Mahlzeiten der Tischnachbar von Emil Brachowiak gewesen. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Menschen gerne zu ihrem Vertrauten einen stillen, schweigsamen Menschen erwählen, und ich redete während der ersten Wochen meines Aufenthaltes in der Heilanstalt fast nichts. So machte mich Brachowiak zu seinem Vertrauten, in mein Ohr ergoss er täglich seinen Liebeskummer, ja er wollte mich sogar zu seinem Liebesboten machen. Wie manche Stunde sind wir beide nach dem Abendessen auf dem langen Korridor nebeneinander auf und ab gegangen, und er hat unermüdlich auf mich eingeredet.
Ich habe ihn weinen und vor Glück lachen sehen. Draußen wurde es schon dämmerig, an den Wänden lehnten verloren die Kranken; wenn sie an ihren Pfeifen sogen, leuchtete die Glut rot auf; in einer Zelle geheimnisten Hagen, Liesmann und Schmeidler miteinander, und der Ausgestoßene redete immer fieberhafter auf mich ein, ob er dem Medizinalrat »die ganze Schweinerei« aufdecken, also Lampen machen oder besser noch einen Brief an Otsche schreiben sollte.
»›Otsche‹, werde ich ihm schreiben, ›ich habe so viel für dich getan. Zweieinhalb Pakete Tabak habe ich dir geschenkt und einen kleinen goldenen Ring, den ich in der Fabrik gefunden habe. Du hast den Ring gleich an Hagen weitergegeben, ich weiß das wohl, und der hat ihn an einen Polen im Haus verscheuert, für anderthalb Pfund Speck, die aus der Küche gestohlen worden sind. Aber ich will nicht darüber klagen, wenn du wieder nett zu mir bist. Seit gestern früh hast du mir nicht einmal Guten Tag gesagt, du siehst mich nicht mehr an. Du bist wieder gut zu mir, oder ich gehe zum Arzt und mache Lampen. Ich berichte dem Arzt alles, was du mir von den Schweinereien erzählt hast, die Liesmann und Hagen mit dir getrieben haben!‹ So werde ich ihm schreiben.«
»Ich an deiner Stelle würde keine Lampen machen, unter keinen Umständen«, antwortete ich. »Du fällst nur selbst mit rein.«
»Ja schön, aber willst du dem Otsche den Brief bringen, heute Abend noch?«
Aber nein, das wollte ich nicht, aktiv wollte ich an dieser Sache nicht beteiligt sein. Es schadete auch nichts, denn Brachowiak fand leicht einen anderen Boten, und dann berichtete er mir am nächsten Morgen mit vor Entrüstung zitternder Stimme, dass Otsche Schmeidler ihm eine Antwort gesandt habe …
»Nun, was denn für eine Antwort?«, fragte ich. »Will er wieder gut sein?«
»Ich soll ihn am Arsche lecken«, schrie wütend der Brachowiak. »Dieser Rotzjunge, dieser Hurenkerl lässt mir das sagen! Aber warte, Bürschchen, jetzt bin ich endgültig mit dir fertig. Nichts bekommst du mehr von mir, keine einzige Pfeife Tabak mehr!«
Ach, er konnte gut so reden, der Brachowiak, ich wusste es wohl, er hatte kein Fäserchen Tabak mehr, Otsche hatte ihn völlig abgekocht, und Otsche wusste das auch.
Was aber sagte Hagen zu alledem, unser König, dieser liebenswürdige und charmante junge Mann, der immer wenigstens den Schein von Sauberkeit aufrechterhielt? Emil Brachowiak war ja so schamlos in seinem Liebeskummer, er wusste von dem Verhältnis Hagens zu Schmeidler, er sah den Jungen stets in der nächsten Umgebung des Königs, Otsche hatte ihm selbst von den Schweinereien erzählt, die sie miteinander trieben – aber trotzdem lief Brachowiak zu Hagen und klagte ihm, genau wie mir, sein Leid. Und Hagen hörte sich das an, er war liebenswürdig und nett, er sprach trostreiche Worte und sagte seine Vermittlung bei Schmeidler zu. Und hinter dem Rücken Brachowiaks lachten sie über den ausgeplünderten, nutzlosen Narren – oh, welche wahrhaft höllische Atmosphäre von Falschheit und Niedertracht!
Brachowiak war ein geschickter und fleißiger Arbeiter, er bekleidete eine Art Vertrauensposten in der Fabrik, er kam auch viel mit Zivilarbeitern zusammen und verstand sich auf Schmeicheln und Betteln; in kurzer Zeit hatte er wieder Tabak.
»Diesmal bleibe ich fest, diesmal kriegt er nichts ab, nicht eine Pfeife voll!« Und Brachowiak ging den langen Korridor auf und ab, rauchte aus seiner langstieligen Pfeife und blies dem Schmeidler den Rauch ins Gesicht, ohne ihn auch nur zu sehen.
Brachowiak hatte sich krankgemeldet, er ging nicht zur Arbeit, sondern mit mir zur Freistunde, und – siehe da! – dieses Mal war im Grasgarten auch Schmeidler aufgetaucht, Schmeidler ganz allein, ohne Hagen und Liesmann – ein seltener Anblick.
»Ich sehe den Kerl gar nicht an!« versicherte Brachowiak, als wir an Schmeidler vorbeigingen, der auf den Treppenstufen in der Sonne saß. Der leichte Sommerwind bewegte sein blondes Haar, er sah jung, er sah frisch, er sah unverdorben aus.
Als wir zum zweiten Mal vorbeikamen, sagte Brachowiak: »Eben hat er mich schon angelächelt, der Otsche!«
»Bleiben Sie fest«, warnte ich ihn. »Es ist dem Bengel doch nur um Ihren Tabak zu tun. – Übrigens könnten Sie mir auch einmal Tabak schenken für eine Zigarette!«
»Ich habe meinen Tabak gar nicht unten«, sagte Brachowiak rasch. »Nein, der Kerl kriegt nicht ein bisschen. Der will mich ja doch nur wieder abkochen.«
Aber beim dritten Mal sagte Schmeidler ganz freundlich zu uns: »Wollen wir nicht einen Skat spielen?« Und er zog schon die schmutzigen Karten, auf denen die Bilder kaum zu erkennen waren, aus der Tasche.
Brachowiak war willig genug, so sagte auch ich nicht Nein, aber ich stieß ihn an, und er nickte beruhigend, fest entschlossen mit dem Kopf. So spielten wir denn unseren Skat, Schmeidler mit auffallendem Glück, Brachowiak ebenso auffallend schlecht. Schmeidler wurde der Gewinner, ich der zweite Mann.
Schon rief der Junge: »Das kostet aber ein bisschen Tabak, Emil«, lachte ihn an, und schon zog Brachowiak seinen Tabak hervor (den er doch gar nicht bei sich hatte!), füllte die Dose des Jungen reichlich, und ich, als auch ich meine Hand hinhielt, bekam kaum genug für eine Zigarette. Dann gingen die beiden im Grasgarten umher, Arm in Arm, eng aneinandergelehnt. Ich war vergessen.
An diesem Abend weinte Emil Brachowiak wieder: Schmeidler hatte ihn völlig abgekocht und wollte wieder nichts mehr von ihm wissen. Und am nächsten Tage machte Emil Brachowiak wirklich Lampen, nicht beim Medizinalrat, aber doch beim Oberpfleger.
Aber es erfolgte nichts, nicht das Geringste. Warum nicht, das weiß ich nicht. Die Verwaltung hatte alle Machtmittel in den Händen, sie konnte die Schuldigen bestrafen, sie auseinanderlegen, die Jugendlichen, diese Quelle ständiger Beunruhigung, in andere Anstalten verbringen. Sie tat nichts, wie sie nichts gegen unseren Hunger tat.
Ich nehme an, weil es ihr ganz gleichgültig war, wie wir lebten und in welchem Schmutz wir verkamen. Unter sechsundfünfzig waren eben keine sechs, die je die Freiheit wiedersehen würden. Alle, fast alle waren dazu verurteilt, immer in diesem Haus zu leben. Es war ganz gleichgültig, wie sie das taten, es kam nicht mehr darauf an. Sie hatten zu arbeiten, solange noch ein bisschen Leistung aus ihren ausgemergelten Körpern auszupressen war, und alles andere interessierte nicht! Mochten sie glücklich sein oder verrecken, draußen war das Leben, und dies war das Haus der Toten!
48
Ich habe es schon gesagt, ich habe diesen Hans Hagen nur kurze Zeit erlebt. Ich bedauere das, ich wäre gerne länger mit ihm zusammen gewesen. Er war grundschlecht, aber er war so schön, sein Gesicht strahlte wie das Luzifers, des gefallenen Engels. Für uns war er wirklich Luzifer, der Lichtbringer, gewesen, er hatte in unser ödes, graues Leben Licht hineingetragen, Bewegung, sogar Lachen. Ich habe ihn sehr bewundert – niemand ist seitdem mehr gekommen, der ihn ersetzt, der auch nur ein wenig von seinem Charme und seiner Lebendigkeit besessen hätte. Vielleicht bin ich in diesem traurigen Haus schon sehr tief gesunken, aber ich wage es, zu sagen: Mag ein Mensch schon schlecht sein, wenn er nur Leben in sich hat und Glanz, alles besser als dieses graue, verschlissene, zerlumpte Dasein, das wir jetzt Tag für Tag – ohne irgendeine Aussicht auf Helle – herunterleben.
Es war schon gemurmelt worden: »Der Hagen kommt fort«, aber niemand hatte so recht daran geglaubt. Wohin sollte er denn kommen? In die Freiheit? Das hätten weder Arzt noch Verwaltung zugelassen. Dieser König des Totenhauses, der hier nur Übles angestiftet hatte, dieser brutale Schläger, der seinem besten Freunde die Kinnlade ein- und das Auge ausschlug, wie sollte er sich draußen in der Freiheit bewähren? Sein Vater hatte die Hand von ihm abgezogen – wovon würde er leben? Nie würde dieser Mensch, der ja nichts gelernt hatte, als einfacher Arbeiter leben wollen. Dafür war seine Genusssucht viel zu stark. Nein, Hans Hagen, einunddreißig Jahre alt, von glänzenden Gaben, vielgebildet und ein bestrickender Unterhalter, war dazu verurteilt, den ganzen Rest seines Lebens in solchen Häusern zu verbringen, nie wieder würde er als freier Mensch über die Straßen einer Stadt gehen, kein Mädchen würde ihm lächeln, keine rechte Arbeit von ihm getan werden.
»Da geht der Hans!«, sagte der Kalfaktor zu mir, und da sah ich ihn unten auf dem Hof, ein Zivilbeamter führte ihn am Kettchen, er trug die Anstaltstracht: eine schilfleinene Joppe und eine braune manchesterne Hose. Der Kalfaktor erzählte mir noch, dass der Oberpfleger so gemein gewesen war, ihm nicht einmal das Tragen von Zivil zu erlauben. Auch war dem Hans Hagen verboten worden, das Brot und den Tabak, den er noch besaß, dem Otsche Schmeidler zu schenken, ebenso wie er seinem vielgeschlagenen Freunde Liesmann nicht seinen Rasierapparat und seine selbstgemachten Sandalen schenken durfte.
»Da geht der Hans!« Wohin? In eine andere Anstalt natürlich, hier hat er sechs Jahre lang Schwierigkeiten gemacht, mögen sich nun andere mit ihm plagen! Sein Ruf reist ihm in seinen Akten voraus, das wird ihn nicht hindern, wieder das ganze Haus zu charmieren, sein König zu werden, Tribute zu empfangen und kleine Verschwörungen anzuzetteln, die ihm selbst nie gefährlich werden.
Und ich sehe ihn älter werden, den Hans Hagen, sein schön gewelltes schwarzes Haar wird dünn und grau; andere, Jüngere sind ihm jetzt an Kraft überlegen. Er muss List gebrauchen, wo er früher nur seine gerissenen Jiu-Jitsu-Griffe einsetzte, und eines Tages verfängt auch die List nicht mehr. Der Schimmer der Jugend ist verflogen, er ist alt, ein abgetaner König. Aber immer noch stehen vor seinem Blick die starken Eisengitter der Gefängnisse, ein Menschenleben hat er nur durch sie hinausschauen können in die Freiheit. Umsonst haben für ihn die Mädchen gelacht, umsonst haben für ihn die schimmernden Jachten ihre weißen Flügel entfaltet – im Totenhaus hat er gelebt, im Totenhaus wird er sterben. Armer Hans Hagen – so jung, so schön, so schillernd!
Armer Hans Hagen? Ach, wir Armen alle! Bei uns allen fing es mit etwas Kleinem an, bei mir war es eine Flasche Rotwein, die, ein vergessenes Geschenk, gerade zur schlimmen Stunde im Büfett stand – bei ihm wird es ähnlich gewesen sein. Es fängt immer mit etwas Kleinem an, und dann verstrickt es uns, es wächst riesengroß auf über uns – und durch Gitter sehen wir nur noch die Freiheit. Die Turmuhr schlägt die Stunden, Hunderte, Tausende, Zehntausende – umsonst! Der Wind weht aus Nord, aus Ost, aus Süd und West, er weht weich und bitterkalt – nicht für uns mehr, nie für uns! Ach, dass wir wissend gewesen wären! Armer Hans Hagen!
Ich muss noch einige wenige Worte sagen über die Hinterbliebenen von Hans Hagen, ich kann sie nicht anders nennen. Denn für uns alle war er mit seinem Fortgang gestorben, wir würden ihn nie wiedersehen, nie eine Zeile von ihm zu lesen bekommen.
Wochenlang sahen wir Liesmann und Schmeidler jede Stunde, die sie sich von ihrer Arbeit freimachen konnten, stumm beieinander am Gangende stehen. Der frische Junge sah sehr bleich aus, seine Augen waren oft rotgeweint. Liesmann war noch finsterer und aggressiver als je; beim geringsten Wort, das ihm nicht gefiel, schlug er ohne jede Warnung los, und so brutal wie nur möglich. Es war rührend, wie die beiden füreinander sorgten, sie halfen sich in allem, im Rauchen, im Essen. Und beide immer fast stumm nebeneinander, vereint durch den einen gemeinsamen Gedanken an den, der gegangen war. An den freien Sonntagnachmittagen, wenn ich mit dem finsteren Zeise und dem Querulanten Reddemin meinen Skat spielte, saßen sich die beiden gegenüber, Schmeidler und Liesmann, und spielten »Mensch ärgere dich nicht«. Sie spielten es stundenlang, ohne ein Wort zu wechseln, nur manchmal lachte der Junge auf, wenn es ihm gelungen war, seinen Gegner ganz auf den Anfang zurückzuwerfen. Sie mussten knapp mit Tabak sein, die Pfeife wechselte ständig zwischen dem einen und dem anderen Munde.
Aber schon damals, als noch das beste Einvernehmen zwischen den beiden herrschte, als sie die gemeinsame Trauer um Hans Hagen einigte, überkam mich ein Gefühl von Angst, wenn ich in das maßlos bittere, kantige, scharfe Gesicht des Liesmann schaute, das noch mehr durch den schwarzen Lappen vor dem Auge entstellt war. Es konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Auf die Dauer konnte ein Junge von dem feilen Charakter Schmeidlers einem so abstoßenden, harten Gefährten wie Liesmann nicht treu bleiben, er würde auch die Entbehrungen nicht tragen mögen, zu denen ihn solche Treue verurteilte.
Und dann kam alles, wie es kommen musste. Es war aber nicht der sehnsüchtige Brachowiak, den sich Otsche erwählte, sondern zu meiner grenzenlosen Überraschung der intrigante Schuster Buck, bei dem ich auf diese Weise eine ganz neue und wiederum nicht sehr einnehmende Seite seines Wesens kennenlernte. Die Folgen waren ein völlig zerschlagener Schuster, ein Otsche mit einem gebrochenen Bein und ein Liesmann, der nun seinerseits für acht Wochen den Arrest bezog. Als er wieder zu uns zurückkam – ihn hatte keiner mit Sondergaben versorgt –, war Schmeidler aus unserer Mitte verschwunden – in irgendein Jugenderziehungsheim, in das er längst gehört hätte.
49
Ich kehre nun zu meinen eigenen Erlebnissen zurück. Es ist noch immer der Ankunftstag in der Heil- und Pflegeanstalt; eben habe ich die Freistunde hinter mich gebracht, habe ersten Einblick getan und erste Bekanntschaften geschlossen und stehe nun wieder auf dem langen, düsteren Korridor, der auch am schönsten, hellsten Sommertag düster bleibt. Stunde um Stunde wandere ich dort auf und ab, unbeschäftigt, zerquält und doch stumpf. Froh bin ich, wenn der Oberpfleger oder ein Wachtmeister einmal vorüberkommt, mit einem Kranken, die Wäsche zur Kammer tragen, oder mit einem Stoß alter Akten. Es geschieht doch was! Es geht mich nichts an, was geschieht, und eigentlich geschieht auch gar nichts, aber ich werde von mir und meinem so ungewissen Schicksal abgelenkt: Ich mag, ich kann mit mir nichts mehr zu tun haben!
Manchmal stelle ich mich auch an das eine mir zugängliche Fenster – das andere ist durch den Glaskasten verbaut – und starre hinaus, über die stachelbewehrte Mauer hinweg, in die Freiheit, die dort sonnenglitzernd »draußen« liegt. Vor mir ragen, wiederum »draußen«, hohe Bäume. Linden sind es wohl; sie beschatten eine Chaussee, auf der Autos eilig vorbeirasen, ich sehe Mädchen auf ihren Rädern in hellen Kleidern vorbeitreten – aber ich wende den Kopf fort und trete wieder tiefer in den düsteren Gang hinein. Das Leben da draußen quält mich, es gehört nicht mehr zu mir, ich bin davon abgetrennt, nichts wissen will ich mehr von ihm! Fahrt alle vorüber und fort, werde das Land leer von euch! Die Bäume sollen verdorren, der Sand über Wiesen und Äcker wehen, Wüste müsste um ein solches Totenhaus sein, dürre, tote Wüste.
Manchmal trete ich auch in einen der beiden Tagesräume ein, in den großen oder in den kleinen, und sitze da fünf oder zehn Minuten bei meinen Leidensgefährten. Leidensgefährten? Sie können nicht so leiden wie ich, ihr Schicksal hat sich schon entschieden, es ist die Ungewissheit, die mich so quält! Manche schlafen, den Kopf auf den Tisch gelegt (denn das Schlafen auf den Betten ist verboten!), andere dösen stumpf vor sich hin, ein kleines, völlig schief gebautes, noch junges Menschenbündel, das auf beiden Augen schielt (aber auf jedem anders!), mit einem birnenförmigen Kopf, hat ein unglaubhaft schmutziges Spiel Karten vor sich und legt langsam eine Karte nach der anderen vor sich hin, betrachtet sie sehr lange und grinst blöde dabei. Einer hat eine Zeitung vor sich, über die er hinwegstarrt. Und einer hat sich sogar die Hose ausgezogen und untersucht mit schmerzverzogener Miene die eitrigen und blutigen Furunkel an seinem Bein – an unserem Esstisch!
Ich fliehe vor Ekel und stehe wieder auf dem Korridor. Ich lese die Namenstafeln an den Zellen; ich lese da: Gother, Gramatzki, Deutschmann, Brandt, Westfahl, Burmester, Röhrig, Klinger. Und im Weitergehen wiederhole ich es mir, wiederhole es wie die Vokabeln, die ich als Junge lernte: Gother, Gramatzki, Deutschmann, Brandt … Wiederhole es immer wieder, bis es sitzt. Und gehe zur nächsten Tafel über … So lerne ich, bringe die Zeit hin, diese endlose Zeit, zweieinhalb endlose Stunden! Was sind draußen zweieinhalb Stunden? Aber was sind sie hier! Aber schließlich rücken die Hausarbeiter aus ihren Arbeitszellen ein, die Mattenflechter und Bürstenmacher; Türen werden geschlagen, Rufe werden laut, im Waschraum läuft Wasser, Pfeifen werden angebrannt. Gott sei Dank, Leben, ein bisschen Leben!
Und schon ertönt der Ruf: »Die Fabrik rückt ein!« und gleich darauf der andere: »Essenholer antreten!«
Wenig später sitzen wir in dem nun wieder voll besetzten Tagesraum; die in der Fabrik waren, sollen Neuigkeiten berichten und erzählen umständlich, dass sie diesmal Kisten zu tragen hatten, die anderthalb Zentner wogen, gestern waren es Kisten, die nur einen Zentner zwanzig Gewicht hatten. Sofort wird mit wütender Erbitterung ein Streit darüber geführt, wie sich diese Gewichtsdifferenz erklären lasse.
Um unser Essen brauchen wir uns dabei nicht zu kümmern, es isst sich von selbst, es ist Wasser mit einigen Kohlrabistücken. Ich bin noch so fein, dass ich diese Stücke, die vollkommen holzig sind, neben meine Schüssel lege. Eine große, verarbeitete Hand fährt über den Tisch, reißt die Stücke mit und schiebt sie in ein weit geöffnetes Maul.