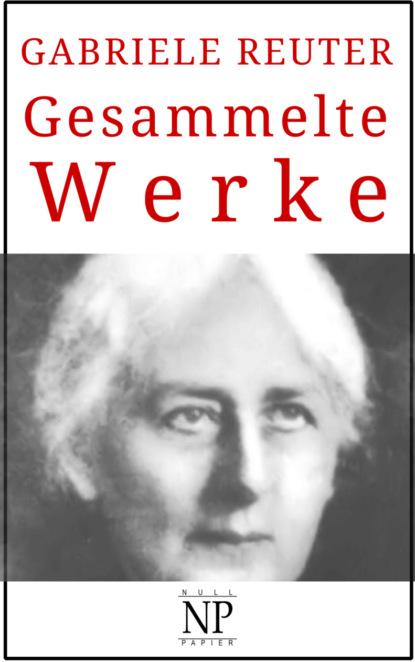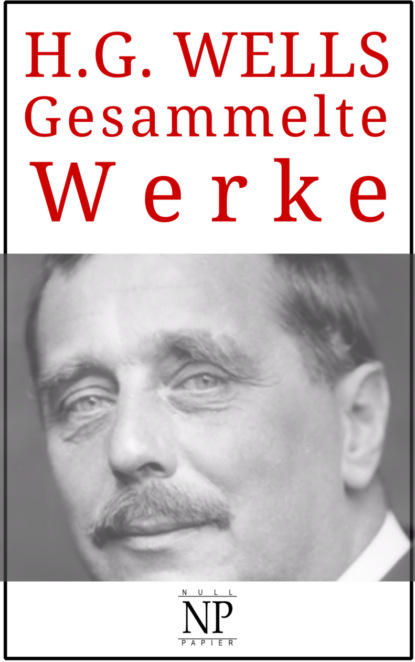Hans Fallada – Gesammelte Werke

- -
- 100%
- +
Sie folgte ihm auf den Korridor hinaus. Sie war jetzt wieder etwas verwirrt und verängstigt, ihr Gastgeber war so völlig verändert. Aber sie sagte sich ganz richtig, dass der alte Herr seine Stille über alles liebte und kaum noch den Umgang mit Menschen gewohnt war. Er war jetzt ihrer müde, er sehnte sich nach seinem Plutarch zurück, wer das immer auch sein mochte.
Der Rat öffnete eine Tür vor ihr, schaltete das Licht ein. »Die Jalousien sind geschlossen«, sagte er. »Es ist hier auch verdunkelt, lassen Sie das bitte so, es könnte Sie sonst einer aus dem Hinterhaus sehen. Ich denke, Sie werden hier alles finden, was Sie brauchen.«
Er ließ sie einen Augenblick dies helle, fröhliche Zimmer betrachten mit seinen Birkenholzmöbeln, einem vollbesetzten, hochbeinigen Toilettentischchen und einem Bett, das noch einen »Himmel« aus geblümtem Chintz besaß. Er sah das Zimmer an wie etwas, das er lange nicht gesehen und nun wiedererkannte. Dann sagte er mit tiefem Ernst: »Es ist das Zimmer meiner Tochter. Sie starb im Jahre 1933 – nicht hier, nein, nicht hier. Ängstigen Sie sich nicht!«
Er gab ihr rasch die Hand. »Ich schließe das Zimmer nicht ab, Frau Rosenthal«, sagte er, »aber ich bitte Sie, sich jetzt sofort einzuriegeln. Sie haben eine Uhr bei sich? Gut! Um zehn Uhr abends werde ich bei Ihnen klopfen. Gute Nacht!«
Er ging. In der Tür wandte er sich noch einmal um. »Sie werden in den nächsten Tagen sehr allein sein mit sich, Frau Rosenthal. Versuchen Sie, sich daran zu gewöhnen. Alleinsein kann etwas sehr Gutes bedeuten. Und vergessen Sie nicht: Es kommt auf jeden Überlebenden an, auch auf Sie, gerade auf Sie! Denken Sie an das Abriegeln!«
Er war so leise gegangen, so leise hatte er die Tür geschlossen, dass sie erst zu spät merkte, sie hatte ihm weder gute Nacht gesagt noch gedankt. Sie ging rasch zur Tür, aber schon während des Gehens besann sie sich. Sie drehte nur den Riegel zu, dann ließ sie sich auf den nächsten Stuhl nieder, ihre Beine zitterten. Aus dem Spiegel des Toilettentischchens schaute sie ein bleiches, von Tränen und Wachen gedunsenes Gesicht an. Sie nickte langsam, trübe diesem Gesicht zu.
Das bist du, Sara, sagte es in ihr. Lore, die jetzt Sara genannt wird. Du bist eine tüchtige Geschäftsfrau gewesen, immer tätig. Du hast fünf Kinder gehabt, eines lebt nun in Dänemark, eines in England, zwei in den USA, und eines liegt hier auf dem Jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee. Ich bin nicht böse, wenn sie dich Sara nennen. Aus der Lore ist immer mehr eine Sara geworden; ohne dass sie es wollten, haben sie mich zu einer Tochter meines Volkes gemacht, nur zu seiner Tochter. Er ist ein guter, feiner alter Herr, aber so fremd, so fremd … Ich könnte nie richtig mit ihm reden, wie ich mit Siegfried gesprochen habe. Ich glaube, er ist kalt. Trotzdem er gütig ist, ist er kalt. Selbst seine Güte ist kalt. Das macht das Gesetz, dem er untertan ist, diese Gerechtigkeit. Ich bin immer nur einem Gesetz untertan gewesen: die Kinder und den Mann liebzuhaben und ihnen vorwärtszuhelfen im Leben. Und nun sitze ich hier bei diesem alten Mann, und alles, was ich bin, ist von mir abgefallen. Das ist das Alleinsein, von dem er sprach. Es ist jetzt noch nicht halb sieben Uhr morgens, und vor zehn Uhr abends werde ich ihn nicht wiedersehen. Fünfzehn und eine halbe Stunde allein mit mir – was werde ich alles erfahren über mich, das ich noch nicht wusste? Mir ist angst, mir ist so sehr angst! Ich glaube, ich werde schreien, noch im Schlafe werde ich schreien vor Angst! Fünfzehn und eine halbe Stunde! Die halbe Stunde hätte er noch bei mir sitzen können. Aber er wollte durchaus in seinem alten Buch lesen. Menschen bedeuten ihm trotz all seiner Güte nichts, ihm bedeutet nur seine Gerechtigkeit etwas. Er tut es, weil sie es von ihm verlangt, nicht um meinetwillen. Es hätte erst Wert für mich, wenn er’s um meinetwillen täte!
Sie nickt diesem gramentstellten Gesicht Saras im Spiegel langsam zu. Sie sieht sich nach dem Bett um. Das Zimmer meiner Tochter. Sie starb 1933. Nicht hier! Nicht hier!, schießt es ihr durch den Kopf. Sie schaudert. Wie er es sagte. Sicher ist die Tochter auch durch – die gestorben, aber er wird nie darüber sprechen, und ich werde ihn auch nie zu fragen wagen. Nein, ich kann nicht in diesem Zimmer schlafen, es ist grauenvoll, unmenschlich. Er soll mir die Kammer seiner Bedienerin geben, ein Bett noch warm vom Leib eines wirklichen Menschen, der darin schlief. Ich kann hier nie schlafen. Ich kann hier nur schreien …
Sie tippt die Döschen und die Schächtelchen auf dem Toilettentisch an. Vertrocknete Cremes, krümeliger Puder, grün belaufene Lippenstifte – und sie ist seit 1933 tot. Sieben Jahre. Ich muss etwas tun. Wie es jagt in mir – das ist die Angst. Jetzt, da ich auf dieser Insel des Friedens angelangt bin, kommt meine Angst hervor. Ich muss etwas tun. Ich darf nicht so allein sein mit mir.
Sie kramte in ihrer Tasche. Sie fand Papier und Bleistift. Ich werde den Kindern schreiben, Gerda in Kopenhagen, Eva in Ilford, dem Bernhard und dem Stefan in Brooklyn. Aber es hat keinen Sinn, die Post geht nicht mehr, es ist Krieg. Ich werde an Siegfried schreiben, irgendwie schmuggle ich den Brief schon durch nach Moabit. Wenn diese alte Bedienerin wirklich zuverlässig ist. Der Rat braucht nichts zu merken, und ich kann ihr Geld oder Schmuck geben. Ich habe noch genug …
Sie holte auch das aus der Handtasche, sie legte es vor sich hin, das in Pakete gepackte Geld, den Schmuck. Sie nahm ein Armband in die Hand. Das hat mir Siegfried geschenkt, als ich die Eva bekam. Es war meine erste Geburt, ich habe viel aushalten müssen. Wie er gelacht hat, als er das Kind sah! Der Bauch hat ihm gewackelt vor Lachen. Alle mussten lachen, wenn sie das Kind sahen mit seinen schwarzen Ringellöckchen über den ganzen Schädel und seinen Wulstlippen. Ein weißes Negerbaby, sagten sie. Ich fand Eva schön. Damals schenkte er mir das Armband. Es hat sehr viel gekostet; alles Geld, das er in einer Weißen Woche verdient hatte, gab er dafür. Ich war sehr stolz, eine Mutter zu sein. Das Armband bedeutete mir nichts. Jetzt hat Eva schon drei Mädels, und ihre Harriet ist neun. Wie oft sie an mich denken mag, da drüben in Ilford. Aber was sie auch denken mag, sie wird sich nie vorstellen, wie ihre Mutter hier sitzt, in einem Totenzimmer beim blutigen Fromm, der nur der Gerechtigkeit gehorcht. Ganz allein mit sich …
Sie legte das Armband hin, sie nahm einen Ring. Sie saß den ganzen Tag vor ihren Sachen, sie murmelte mit sich, sie klammerte sich an ihre Vergangenheit, sie wollte nicht daran denken, wer sie heute war.
Dazwischen kamen Ausbrüche wilder Angst. Einmal war sie schon an der Tür, sie sagte zu sich: Wenn ich nur wüsste, sie quälen einen nicht lange, sie machten es schnell und schmerzlos, ich ginge zu ihnen. Ich ertrage dieses Warten nicht mehr, und wahrscheinlich ist es ganz zwecklos. Eines Tages kriegen sie mich doch. Wieso kommt es auf jeden Überlebenden an, wieso grade auf mich? Die Kinder werden seltener an mich denken, die Enkel gar nicht, Siegfried dort in Moabit wird auch bald sterben. Ich verstehe nicht, was der Kammergerichtsrat damit gemeint hat, ich muss ihn heute Abend danach fragen. Aber wahrscheinlich wird er nur lächeln und irgendetwas sagen, mit dem ich gar nichts anfangen kann, weil ich ein richtiger Mensch bin, heute noch, aus Fleisch und Blut, eine alt gewordene Sara.
Sie stützte sich mit der Hand auf den Toilettentisch, sie betrachtete düster ihr Gesicht, das von einem Netz von Fältchen überzogen war. Fältchen, die Sorge, Angst, Hass und Liebe gezogen hatten. Dann kehrte sie wieder zu ihrem Tisch zurück, zu ihren Schmucksachen. Sie zählte, nur um die Zeit hinzubringen, die Scheine immer wieder durch; später versuchte sie, alle Scheine nach Serien und Nummern zu ordnen. Dann und wann schrieb sie auch einen Satz in dem Brief an ihren Mann. Aber es wurde kein Brief, nur ein paar Fragen: Wie er denn untergebracht sei, was er zu essen bekomme, ob sie nicht für seine Wäsche sorgen könne? Kleine, belanglose Fragen. Und: Ihr ging es gut. Sie war in Sicherheit.
Nein, kein Brief, ein sinnloses, unnötiges Geschwätz, dazu auch unwahr. Sie war nicht in Sicherheit. Noch nie hatte sie sich in den letzten grauenvollen Monaten so in Gefahr gefühlt wie in diesem stillen Zimmer. Sie wusste, sie musste sich hier verändern, sie würde sich nicht entwischen können. Und sie hatte Angst vor dem, was aus ihr werden konnte. Vielleicht musste sie dann noch Schrecklicheres erleiden und ertragen, sie, die schon ohne ihren Willen aus einer Lore zu einer Sara geworden war. Sie wollte nicht, sie hatte Angst.
Später legte sie sich doch auf das Bett, und als ihr Gastgeber um zehn Uhr gegen ihre Tür klopfte, schlief sie so fest, dass sie ihn nicht hörte. Er öffnete die Tür vorsichtig mit einem Schlüssel, der den Riegel zurückschob, und als er die Schlafende sah, nickte er und lächelte. Er holte ein Tablett mit Essen, setzte es auf den Tisch, und als er dabei die Schmucksachen und das Geld beiseiteschob, nickte und lächelte er wieder. Leise ging er aus dem Zimmer, drückte den Riegel wieder herum, ließ sie schlafen …
So kam es, dass Frau Rosenthal in den ersten drei Tagen ihrer »Schutzhaft« keinen einzigen Menschen zu sehen bekam. Sie verschlief stets die Nacht, um zu einem schrecklichen, angstgequälten Tag zu erwachen. Am vierten Tage, halb von Sinnen, tat sie dann etwas …
11. Es ist immer noch Mittwoch
Die Gesch hatte es doch nicht über sich gebracht, den kleinen Mann auf ihrem Sofa nach einer Stunde zu wecken. Er sah so bemitleidenswert aus, wie er dalag in seinem Erschöpfungsschlaf, die Flecke auf seinem Gesicht fingen jetzt an, rotblau anzulaufen. Er hatte die Unterlippe vorgeschoben wie ein trauriges Kind, und manchmal zitterten seine Lider, und seine Brust hob sich in einem schweren Seufzer, als wolle er gleich jetzt in seinem Schlaf losweinen.
Als sie ihr Mittagessen fertig hatte, weckte sie ihn und gab ihm zu essen. Er murmelte etwas wie einen Dank. Er aß wie ein Wolf und warf dabei Blicke auf sie, aber er sprach mit keinem Wort von dem, was geschehen war.
Schließlich sagte sie: »So, mehr kann ich Ihnen nicht geben, sonst bleibt für Gustav nicht genug. Legen Sie sich nur auf das Sofa und schlafen Sie noch ein bisschen. Ich werde dann selbst mit Ihrer Frau …«
Er murmelte wieder etwas, unkenntlich, ob Zustimmung oder Ablehnung. Aber er ging willig zum Sofa, und eine Minute später war er wieder fest eingeschlafen.
Als am späten Nachmittag Frau Gesch die Flurtür der Nachbarin gehen hörte, schlich sie leise hinüber und klopfte. Eva Kluge öffnete sofort, aber sie stellte sich so in die Tür, dass sie den Eintritt verwehrte. »Nun?«, fragte sie feindlich.
»Entschuldigen Sie, Frau Kluge«, fing die Gesch an, »wenn ich Sie noch mal störe. Aber Ihr Mann liegt drüben bei mir. So ’n Bulle von der SS hat ihn heute früh angeschleppt, Sie können kaum weg gewesen sein.«
Eva Kluge verharrte in ihrem feindlichen Schweigen, und die Gesch fuhr fort: »Sie haben ihn ganz schön zugerichtet, da ist kein Fleck an ihm, der nicht was abgekriegt hat. Ihr Mann mag sein, wie er will, aber so können Sie ihn nicht vor die Tür setzen. Sehen Sie ihn sich bloß mal an, Frau Kluge!«
Sie sagte unbeugsam: »Ich habe keinen Mann mehr, Frau Gesch. Ich hab’s Ihnen gesagt, ich will nichts mehr davon hören.«
Und sie wollte in ihre Wohnung zurück. Die Gesch sagte eifrig: »Seien Sie nicht so eilig, Frau Kluge. Schließlich ist es Ihr Mann. Sie haben Kinder mit ihm gehabt …«
»Darauf bin ich besonders stolz, Frau Gesch, darauf besonders!«
»Man kann auch unmenschlich sein, Frau Kluge, und was Sie tun wollen, das ist unmenschlich. So kann der Mann nicht auf die Straße.«
»Und war das, was er mit mir all die Jahre getan hat, etwa menschlich? Er hat mich gequält, er hat mir mein ganzes Leben kaputtgemacht, schließlich hat er mir noch meinen Lieblingsjungen weggenommen – und zu so einem soll ich menschlich sein, bloß weil er Dresche von der SS bekommen hat? Ich denke gar nicht daran! Den ändern auch noch so viele Schläge nicht!«
Nach diesen heftig und böse ausgestoßenen Worten zog Frau Kluge der Gesch einfach die Tür vor der Nase zu und schnitt ihr so jedes weitere Wort ab. Sie war einfach nicht fähig, noch weiteres Gerede auszuhalten. Bloß um allem Gerede zu entgehen, hätte sie den Mann womöglich doch noch wieder in die Wohnung aufgenommen und es immer und ewig bereut!
Sie setzte sich auf einen Küchenstuhl, starrte in die bläuliche Gasflamme und dachte an diesen Tag zurück. Gerede, nichts wie Gerede. Seit sie dem Vorsteher des Amtes eröffnet hatte, sie wolle aus der Partei austreten und das sofort, hatte es nur noch Gerede gegeben. Sie war von ihrem Bestellgang befreit worden, aber dafür war sie ununterbrochen vernommen worden; vor allem wollten sie durchaus von ihr erfahren, warum sie denn aus der Partei auszutreten wünschte. Was für Gründe sie denn habe. Sie hatte starr und unverändert geantwortet: »Das geht keinen was an. Darüber sprech ich nicht, warum ich raus will. Und das heute noch!«
Aber je mehr sie sich weigerte, umso hartnäckiger wurden die. Alles andere schien sie nicht zu interessieren, nur das ›Warum‹ wollten sie erfahren. Gegen Mittag waren dann noch zwei Zivilisten mit Aktentaschen aufgetaucht und hatten sie ununterbrochen befragt. Ihr ganzes Leben sollte sie erzählen, von den Eltern, den Geschwistern, ihrer Ehe …
Erst war sie ganz bereitwillig gewesen, froh, dem endlosen Gefrage über die Gründe ihres Austritts zu entgehen. Aber dann, schon als sie von ihrer Ehe berichten sollte, war sie wieder bockbeinig geworden. Nach der Ehe würden die Kinder drankommen, und sie würde nicht von Karlemann erzählen können, ohne dass diese gewitzten Füchse merkten, dass da etwas nicht stimmte.
Nein, auch darüber sagte sie nichts aus. Auch das war privat. Ihre Ehe und ihre Kinder gingen niemanden etwas an.
Aber diese Leute waren zähe. Sie wussten viele Wege. Der eine griff in seine Aktentasche und fing an, in einem Aktenstück zu lesen. Sie hätte gerne gewusst, was er da las: Es konnte doch über sie nicht solch ein Aktenstück bei der Kriminalpolizei geben, denn dass diese Zivilisten irgendwas Polizeiliches waren, das hatte sie unterdes doch gemerkt.
Dann fingen sie wieder an zu fragen, und nun erwies es sich, dass in dem Aktenstück etwas über Enno stehen musste. Denn nun wurde sie über seine Krankheiten, seine Arbeitsscheu, seine Wettleidenschaft und über seine Weiber ausgefragt. Es fing wieder ganz harmlos an, dann plötzlich sah sie die Gefahr, schloss fest den Mund und sagte nichts mehr.
Nein, auch das war privat. Es ging keinen was an. Was sie mit ihrem Mann hatte, das war ihre Sache allein. Übrigens lebte sie getrennt von dem Manne.
Da war sie wieder erwischt. Seit wann sie getrennt von ihm lebe? Wann hatte sie ihn zum letzten Male gesehen? Hing ihr Wunsch nach Austritt aus der Partei etwa mit dem Manne zusammen?
Sie schüttelte nur den Kopf. Aber sie dachte mit Schaudern daran, dass sie sich wahrscheinlich nun den Enno vornehmen würden, und aus dem schlappen Kerl würden sie in einer halben Stunde alles ausgequetscht haben! Dann stand sie mit ihrer Schande, von der bisher sie allein wusste, vor allen nackt und bloß da. Dann schrieben sie womöglich über sie, und auf der Partei würden sie endlos über die Mutter schwätzen, die solch einen Sohn geboren hatte.
»Privat! Rein privat!«
Die Briefträgerin, die in Gedanken verloren das Zittern und Beben des blauen Gasflämmchens beobachtet hat, fährt zusammen. Sie hat vorhin einen schweren Fehler begangen, sie hatte ja Gelegenheit, den Enno für ein paar Wochen zu verstecken. Sie brauchte ihm nur für ein paar Wochen Geld zu geben und die Weisung, sich bei einer seiner Freundinnen zu verstecken.
Sie klingelt bei der Gesch. »Hören Sie, Frau Gesch, ich habe es mir noch mal überlegt, ich möchte wenigstens ein paar Worte mit meinem Manne sprechen!«
Jetzt, wo die andere ihr den Willen tut, wird die Gesch böse. »Das hätten Sie sich eher überlegen müssen. Jetzt ist Ihr Mann fort, schon gute zwanzig Minuten. Nun kommen Sie zu spät!«
»Wo ist er denn hin, Frau Gesch?«
»Wie soll ich das denn wissen? Wo Sie ihn rausgeschmissen haben! Bei eine von seinen Weibern wohl!«
»Wissen Sie nicht, zu welcher? Bitte, sagen Sie es doch, Frau Gesch! Es ist wirklich sehr wichtig …«
»Auf einmal!« Und widerwillig setzt die Gesch hinzu: »Er hat was von ’ner Tutti gesagt …«
»Tutti?«, fragt sie. »Das soll doch Trude, Gertrud bedeuten … Wissen Sie den anderen Namen nicht, Frau Gesch?«
»Er hat ihn ja selber nicht gewusst! Er hat nicht mal genau gewusst, wo sie wohnt, er hat bloß gedacht, er find’t sie. Aber bei dem Zustand, in dem der Mann ist …«
»Vielleicht kommt er noch mal wieder«, sagt Frau Eva Kluge nachdenklich. »Dann schicken Sie ihn zu mir. Jedenfalls danke ich Ihnen schön, Frau Gesch. Guten Abend!«
Aber die Gesch grüßt nicht zurück, sie knallt bei sich die Tür zu. Sie hat noch nicht vergessen, wie die andere ihr vorhin die Tür vor der Nase zugemacht hat. Das ist noch lange nicht raus, dass sie den Mann schickt, wenn er wirklich noch mal hier auftaucht. So ’ne Frau soll sich zur rechten Zeit besinnen, nachher ist es manchmal zu spät.
Frau Kluge ist in ihre Küche zurückgekehrt. Es ist seltsam: obwohl doch das Gespräch eben mit der Gesch ohne Ergebnis geblieben ist, hat es sie erleichtert. Die Dinge müssen eben ihren Lauf nehmen. Sie hat getan, was sie tun konnte, sich sauber zu halten. Sie hat sich vom Vater wie vom Sohne losgesagt, sie wird sie austilgen aus ihrem Herzen. Sie hat ihren Austritt aus der Partei erklärt. Nun geschieht, was geschehen muss. Sie kann das nicht ändern, auch das Schlimmste kann sie nicht mehr sehr schrecken, nach dem, was sie durchgemacht hat.
Es hat sie auch nicht sehr erschrecken können, als die beiden vernehmenden Zivilisten vom nutzlosen Fragen zum Drohen übergegangen sind. Sie wisse doch wohl, dass solch ein Austritt aus der Partei sie ihre Stellung bei der Post kosten könne? Und noch viel mehr: wenn sie jetzt, unter Verweigerung von Gründen, aus der Partei austreten wolle, so sei sie politisch unzuverlässig, und für solche gebe es so etwas wie ein KZ! Sie habe doch wohl schon davon gehört? Da könne man politisch Unzuverlässige sehr rasch zuverlässig machen, fürs ganze Leben seien die zuverlässig. Sie verstehe doch!
Frau Kluge hatte keine Angst bekommen. Sie ist dabei geblieben, dass privat privat bleibt, und über Privates redet sie nicht. Schließlich hat man sie gehen lassen. Nein, ihr Austritt aus der Partei ist vorläufig nicht angenommen, sie wird noch darüber hören. Aber vom Postdienst ist sie vorläufig suspendiert. Sie hat sich aber in ihrer Wohnung zur Verfügung zu halten …
Während Eva Kluge den so lange vergessenen Suppentopf endlich auf die Gasflamme rückt, beschließt sie plötzlich, auch in diesem Punkte nicht zu gehorchen. Sie wird nicht ewig tatenlos in der Wohnung sitzen und auf die Quälereien der Herren warten. Nein, sie wird morgen früh mit dem Sechs-Uhr-Zug zu ihrer Schwester bei Ruppin fahren. Da kann sie zwei, drei Wochen unangemeldet leben, die füttern sie schon so durch. Die haben da Kuh und Schweine und Kartoffelland. Sie wird arbeiten, im Stall und auf dem Felde arbeiten. Das wird ihr guttun, besser als diese Briefträgerei für ewig: trabtrab!
Ihre Bewegungen sind, seit dem Beschluss, aufs Land zu gehen, frischer geworden. Sie holt einen Handkoffer hervor und fängt an zu packen. Einen Augenblick überlegt sie, ob sie Frau Gesch wenigstens sagen soll, dass sie verreist, das Wohin braucht sie ihr ja nicht zu sagen. Aber sie beschließt: nein, sie will lieber nichts sagen. Alles, was sie nun tut, tut sie ganz für sich allein. Sie will keinen Menschen da reinziehen. Sie wird auch der Schwester und dem Schwager nichts sagen. Sie wird jetzt so allein leben wie noch nie. Immer war bisher jemand da, für den sie zu sorgen hatte: die Eltern, der Mann, die Kinder. Nun ist sie allein. Es scheint ihr im Augenblick sehr möglich, dass ihr dieses Alleinsein gut gefallen wird. Vielleicht wird, wenn sie ganz allein mit sich ist, noch etwas aus ihr, jetzt, wo sie endlich Zeit für sich selber hat, das eigene Ich nicht immer über all den anderen vergessen muss.
In dieser Nacht, die Frau Rosenthal mit ihrer Einsamkeit so ängstet, lächelt die Briefträgerin Kluge zum ersten Mal wieder im Schlaf. Träumend sieht sie sich auf einem riesigen Kartoffelacker stehen, die Hacke in den Händen. So weit sie sieht, nur Kartoffelland, und sie dazwischen allein: Sie muss das Kartoffelland sauberhacken. Sie lächelt, sie hebt die Hacke, hell klingt ein getroffener Stein, ein Meldenstengel[15] sinkt um, sie hackt weiter und weiter.
12. Enno und Emil nach dem Schock
Der kleine Enno Kluge hat es viel schlechter getroffen als sein »Kumpel« Emil Barkhausen, den nach den Erlebnissen dieser Nacht eine Frau, sie mochte sein, wie sie wollte, doch immerhin in ein Bett gepackt hatte, wenn sie ihn auch sofort danach bestahl. Der schwächliche Rennwetter hat auch viel mehr Schläge bekommen als der lange, knochige Gelegenheitsspitzel. Nein, dem Enno ist besonders übel mitgespielt worden.
Und während er durch die Straßen läuft und angstvoll nach seiner Tutti sucht, ist der Barkhausen aus seinem Bett aufgestanden, hat sich in der Küche was zu essen gesucht und isst sich finster und nachdenklich satt. Dann findet Barkhausen im Kleiderspind eine Schachtel Zigaretten, er brennt sich eine an, steckt die Schachtel in seine Tasche und sitzt wieder finster grübelnd am Tisch, den Kopf in der Hand.
So findet ihn seine Otti, als sie von ihren Besorgungen wieder zurückkommt. Natürlich sieht sie gleich, dass er sich Essen genommen hat, sie weiß auch, er hat nichts zu rauchen in der Tasche gehabt, als sie ging, und sie entdeckt sofort den Diebstahl aus ihrem Kleiderspind. Sofort bricht sie einen Streit vom Zaun, so verängstigt sie auch ist. »Jawohl, so was liebe ich, einen Kerl, der mir mein Essen frisst und mir meine Zigaretten klaut! Gleich gibst du sie mir wieder, auf der Stelle gibst du sie mir wieder! Oder du bezahlst sie mir! Gib Geld her, Emil!«
Sie wartet gespannt, was er sagen wird, aber sie ist ihrer Sache ziemlich sicher. Die achtundvierzig Mark hat sie schon fast ganz ausgegeben, da kann er wirklich nicht mehr viel machen.
Und sie sieht aus seiner Antwort, so böse sie auch klingt, dass er von dem Gelde wirklich nichts weiß. Sie fühlt sich diesem doofen Kerl von einem Manne weit überlegen, sie hat ihn ausgenommen, und der Affe merkt es nicht mal!
»Halt die Schnauze!«, grunzt Barkhausen nur, ohne den Kopf zu erheben. »Und mach, dass du aus der Stube kommst, oder ich schlage dir alle Knochen im Leibe entzwei!«
Sie ruft von der Küchentür her, einfach, weil sie immer das letzte Wort haben muss und weil sie sich ihm so überlegen fühlt (obwohl sie jetzt Angst vor ihm hat): »Sieh du lieber selbst, dass dir die SS deine Knochen nicht ganz zerschlägt! Weit biste nicht mehr davon ab!«
Damit geht sie in die Küche und lässt ihren Ärger über diese Verbannung an den Gören aus.
Der Mann aber sitzt immer weiter in der Stube und grübelt. Er weiß nur wenig von dem, was in der Nacht geschah, aber das Wenige, das er weiß, das reicht ihm. Und er denkt daran, dass da oben die Wohnung der Rosenthal liegt, die jetzt wohl von den Persickes ausgeräumt ist, und er hätte sich nehmen können, noch und noch! Durch seine eigene Dussligkeit hat er das verbockt!
Nein, der Enno ist daran schuld gewesen, der Enno hat mit dem Schnaps angefangen, der Enno ist von allem Anfang an besoffen gewesen. Ohne den Enno hätte er jetzt einen Haufen Zeugs, Wäsche und Kleider; dunkel erinnert er sich auch an einen Radioapparat. Wenn er den Enno jetzt hier hätte, würde er ihm alle Knochen im Leibe zerschlagen, diesem feigen Schwächling, der ihm die ganze Sache vermasselt hat!
Aber einen Augenblick später zuckt Barkhausen schon wieder die Achseln. Wer ist denn schließlich dieser Enno? ’ne feige Wanze, die davon lebt, dass sie den Weibern Blut abzapft! Nein, wer richtig schuld ist, das ist dieser Baldur Persicke! Dieser Bengel, dieser Schuljunge von einem HJ-Führer hat von Anfang an vorgehabt, ihn reinzulegen! Das war alles vorbereitet, um einen Schuldigen zu haben und sich selbst die Beute ungestraft aneignen zu können! Das hat sich diese Giftschlange mit den funkelnden Brillengläsern fein ausgedacht! Ihn so reinzulegen, dieser verdammte Rotzjunge!
Barkhausen versteht es nicht so ganz, warum er nun eigentlich doch nicht in einer Zelle auf dem Alex, sondern in seiner Stube sitzt. Da muss denen was dazwischengekommen sein. Ganz dunkel erinnert er sich an zwei Gestalten, aber wer das war und wieso, das hat er damals schon in seiner halben Betäubung nicht erfasst, und jetzt weiß er es erst recht nicht.