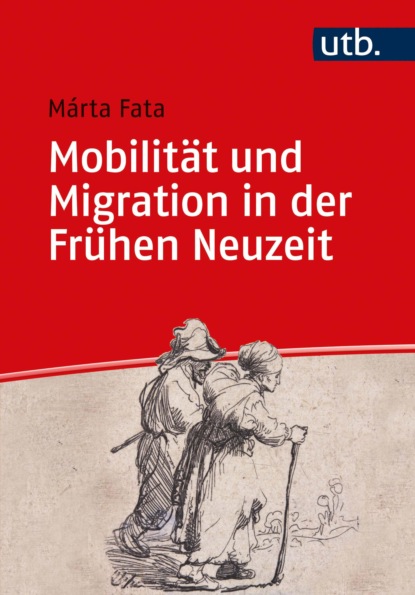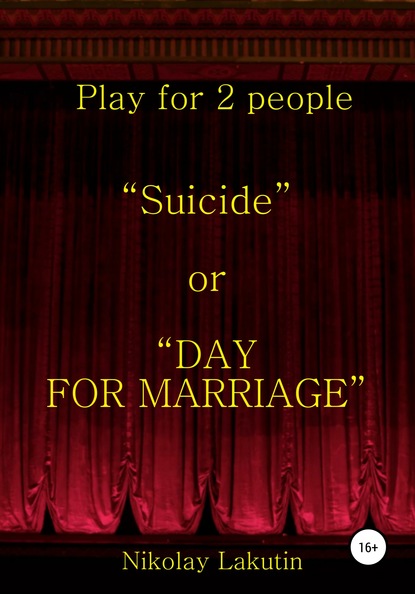- -
- 100%
- +
Die allermeisten indentured servants wählten diese Form der Auswanderung aufgrund ihrer Armut. Die Ursache dafür war vor allem in dem Übergang von der feudalen zur frühkapitalistischen Produktion in der englischen Landwirtschaft zu suchen. Die Einhegung von Ackerland für Schafweiden sowie die erheblichen Pacht- und Steuererhöhungen ließen die Zahl der Arbeitslosen und Vagierenden ständig wachsen. Die Auflösung von Privatarmeen, der Ausbruch des Bürgerkrieges 1642 und die bis zur Restauration im Jahre 1660 anhaltenden politischen und militärischen Auseinandersetzungen bewirkten einen weiteren Anstieg der Zahl der Arbeitslosen und Armen und dadurch auch der indentured servants.
Als Kontraktknechte wurden in großer Zahl auch Vertreter von in der Gesellschaft unerwünschten Gruppen abgeschoben, darunter vagierende Kinder, Bettler, Kriminelle, Prostituierte, Kriegsgefangene oder politische Gegner. Infolge der englischen Enteignungs- und Umsiedlungspolitik in Irland wurden auch mehrere Zehntausende irische Häftlinge in die nordamerikanischen Kolonien als indentured servants deportiert, um die gälisch-irische Bevölkerung zu schwächen. Da all diese Gruppen ohne Arbeitsverträge in den Kolonien ankamen, waren sie der Willkür der Händler und der Landeigner ausgesetzt. Heinrich von Uchteritz, der sich 1650 über Norwegen nach Schottland begab, um in der Armee Karls II. zu dienen, wurde nach der Schlacht bei Worcester durch Cromwells Truppen gefangen genommen und Anfang 1652 zusammen mit 1300 anderen Gefangenen, darunter mehrere Deutsche, als indentured servant nach Barbados verschifft. Dort wurde er für 800 Pfund Zucker verkauft. Nach seiner 1705 erschienenen Reisebeschreibung bestand zwischen den indentured servants, den afrikanischen Sklaven und der indigenen Bevölkerung lediglich ein einziger Unterschied, dass die Christen bekleidet waren, während „die Mohren und Wilden“ nur ein Schamtuch trugen.[45]
Auch wenn die Institution der indentured servants keineswegs an Bedeutung verlor und sich neben armen Auswanderungswilligen auch junge Männer aus der unteren Mittelklasse häufiger als indentured servants verdingten, um die Welt zu sehen und Erfahrung zu sammeln, arbeiteten auf den großen Zuckerrohr-, Tabak- und Baumwollplantagen im südlichen Nordamerika ab den 1640er-Jahren immer mehr Sklaven aus Afrika, die bis Ende des 17. Jahrhunderts zu bevorzugten Arbeitskräften wurden.
Ähnlich wie die englische überließ auch die französische Krone Vorstöße in der Neuen Welt privaten Interessenten. Die Kolonien entwickelten sich jedoch langsam, weil nur wenige Franzosen dauerhaft in der Neuen Welt eine neue Existenz suchten, da sie den Auswanderern nicht den erwünschten sozialen Aufstieg bescheren konnte. Auch nachdem 1663 die Krone die Verwaltung Neu-Frankreichs übernommen und Finanzminister Jean Baptiste Colbert ein merkantilistisches Konzept für die Kolonien zur Ergänzung und Stärkung der Wirtschaft im Mutterland entworfen hatte, blieb das Interesse mäßig. Das Konzept beinhaltete neben Deportation von Sträflingen und dem nach englischem Modell der indentured servants im viel bescheideneren Maße praktizierten engagé-System ebenso eine gezielte Heiratspolitik. Etwa 800 Frauen, vor allem verarmte adelige Töchter und Waisen wurden zwischen 1663 und 1672 zur Auswanderung gebracht. Diese filles du Roi erhielten neben der freien Überfahrt auch eine königliche Mitgift, die u. a. aus einigen Kleidungsstücken, vier Rollen Garn und 50 Livres bestand. Nicht zuletzt dieser Verheiratungspolitik war es zu verdanken, dass die Zahl der Einwohner in Kanada von 3035 Personen im Jahre 1663 bis 1685 auf 10.725 anwuchs.
Noch weniger Interesse an der Auswanderung in die Neue Welt als die Franzosen zeigten die Niederländer, denn in den niederländischen Provinzen war das Lebensniveau während der ganzen Frühen Neuzeit das höchste in Europa. So warben die Aktionäre der 1621 gegründeten Niederländischen Westindien-Kompanie vor allem um ausländische, darunter auch um deutsche Siedler für ihre Kolonien. Allerdings brachten für die Gesellschaft nicht die zerstreut liegenden Siedlungskolonien den großen Profit ein, sondern der Handel mit Waren und Sklaven.
Der Rückgang der Zahl der indigenen Bevölkerung und die in ihrem Volumen nur mäßige Ansiedlung von Siedlern machten den Import von afrikanischen Sklaven als Arbeitskräfte auf den Plantagen der Europäer erforderlich. Der bereits im ausgehenden Spätmittelalter beginnende und bis ins 19. Jahrhundert florierende atlantische Sklavenhandel mit über zwölf Millionen Sklaven bildete den Bestandteil jenes Dreieckhandels, in dessen Rahmen minderwertige Waren von Europa nach Afrika, von Afrika Sklaven als billige Arbeitskräfte nach Amerika und von dort wertvolle Rohstoffe und Waren wie Baumwolle, Zucker und Tabak nach Europa gelangten. Somit stellte die Arbeitskraft der aus Afrika Deportierten einen wichtigen Motor der frühkapitalistischen Wirtschaft dar.
Im 16. Jahrhundert war Portugal der größte Importeur afrikanischer Sklaven. In der in Afrika gängigen Praxis des Sklavenhandels witterten die portugiesischen Händler schon Mitte des 15. Jahrhunderts ein lukratives Geschäft und ließen sich 1455 in einer päpstlichen Bulle das Monopol auf Fahrten, Handel sowie Versklavung von „Ungläubigen“ entlang der westafrikanischen Küste sichern. Seit dem späten 17. Jahrhundert waren jedoch alle europäischen Großmächte und zahlreiche Großkaufleute und Handelshäuser auch aus anderen europäischen Ländern, so u. a. aus dem Heiligen Römischen Reich daran beteiligt.
Versuche deutscher Territorialfürsten, sich am Wettbewerb zu beteiligen, schlugen allerdings fehl. Eine von der Grafschaft Hanau im Jahre 1669 geplante Gründung der Kolonie „Hanauisch-Indien“ im nördlichen Brasilien konnte wegen der fehlenden Mittel nicht realisiert werden. Kein dauerhafter Erfolg war auch dem Kurfürstentum Brandenburg beschieden, das unter den letzten europäischen Staaten in den transatlantischen Sklavenhandel eintrat. 1682 wurde auf Wunsch des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie in Berlin gegründet. Die Grundlage dafür stellte die Marine dar, die im 17. Jahrhundert ausreichend groß war, um am transatlantischen Sklavenhandel eigenständig teilzunehmen. Möglich wurde das Projekt allerdings erst durch den mit Emden 1683 ausgehandelten Handels- und Schifffahrtsvertrag, der den Brandenburgern den Zugang zur Nordsee eröffnete und die finanzielle Beteiligung der reichen Kaufleute in Emden sicherte. An der westafrikanischen Küste wurde nach Verhandlungen der Brandenburger mit den Einheimischen die Festung Groß-Friedrichsburg gegründet, die der Gesellschaft von 1683 bis 1717 als Sklavenumschlagplatz diente. Von dort wurden die Sklaven zunächst auf die 1685 angemietete Insel St. Thomas in der Karibik, die unter dänischer Herrschaft stand, dann ab 1689 auf die von den Brandenburgern erworbene kleine Antilleninsel St. Peter gebracht, die als Zwischenstation für die in der Neuen Welt verkauften Sklaven diente. Insgesamt wurden beinahe 20.000 Afrikaner durch die Handelskompanie als Sklaven in die Karibik verkauft. Nachdem die Kompanie 1711 in staatlichen Besitz genommen wurde, ging sie ohne ausreichendes Kapital und besonderes Interesse Friedrichs I. schnell bankrott.
Mit dem Sklavenhandel nahm die Zahl der Afrikaner auch in Europa zu. Die meisten von ihnen gelangten als unfreies Dienstpersonal von Plantagenbesitzern, Kaufleuten, Offizieren oder Geistlichen nach Europa. Ihr Anteil an der Bevölkerung Lissabons beispielsweise wird schon um 1550 auf etwa zehn Prozent geschätzt, aber auch in London, Paris und in den großen europäischen Hafenstädten machte ihre Zahl mehrere Tausend aus. Für das Alte Reich konnte Anne Kuhlmann-Smirnov insgesamt 380 Personen afrikanischer Herkunft ausmachen.[46] Die meisten von ihnen gelangten als Geschenke an die Adels- und Fürstenhöfe, wo sie als „Hofmohren“ zu begehrten „Objekten“ der höfischen Herrschaftsrepräsentation gehörten. Andere kamen mit den hessischen und braunschweigischen Truppen, die im 18. Jahrhundert auf britischer Seite in Nordamerika kämpften.
Von den Schwarzen afrikanischer Herkunft im Alten Reich schlugen einige eine bemerkenswerte Laufbahn ein. Der vielleicht berühmteste unter ihnen wurde Angelo Soliman aus dem Volk der Kanuri im Nordosten Nigerias. Er wurde als Kind verschleppt und nach Messina verkauft, wo ihn seine Herrin taufen, erziehen und studieren ließ. Von Fürst Joseph Wenzel von Lichtenstein gekauft, eröffnete sich für Soliman der soziale Aufstieg. Er wurde zu einem der Erzieher des Prinzen Alois I. und zum Mitglied der Freimaurerloge „Zur wahren Eintracht“, in der am Wiener Kaiserhof wirkende Gelehrte und Künstler versammelt waren. Auch Kaiser Joseph II. schätzte die Gesellschaft des gebildeten Afrikaners. Dies alles hinderte die Wiener Gesellschaft allerdings nicht daran, nach Solimans Tod 1796 seine Haut zu präparieren und ihn bis 1806 im Kaiserlichen Naturalienkabinett als halbnackten Wilden mit Federn und Muschelkette auszustellen.
Fast zeitgleich mit der Expansion der Europäer in Amerika expandierte das Moskauer Reich nach Asien in Richtung Sibirien. Die staatliche Durchdringung des Gebietes vom Ural bis nach Kamtschatka erfolgte nicht nur planlos, sondern auch sehr langsam. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden zunächst befestigte Orte für den lukrativen Pelzhandel, insbesondere mit Zobelfell, gegründet, in denen neben Pelzjägern und -händlern Staatsbedienstete und Soldaten angesiedelt wurden. Ihnen folgten Bauern, Handwerker und Priester. Allerdings konnte Sibirien anders als Amerika wegen seiner extremen klimatischen Verhältnisse und der schlechten Verkehrsmöglichkeiten auch im 18. Jahrhundert nicht zu einem begehrten Einwanderungsgebiet werden. Auch die meisten Staatsbediensteten verließen Sibirien nach ihrer Dienstzeit, wenn sie konnten, und kehrten in den europäischen Teil des Zarenreichs zurück. Dem Mangel an freiwilligen Auswanderern, der die politische und ökonomische Inbesitznahme Sibiriens erschwerte, versuchte das Zarenreich durch die Verbannung von Verurteilten nach Sibirien entgegenzuwirken. Diese schon am Ende des 16. Jahrhunderts beginnende Praxis wurde im 17. Jahrhundert auf immer mehr Gruppen erweitert. Nicht nur politisch Unerwünschte, Kriminelle oder religiös verfolgte Altgläubige wurden nach Sibirien verbannt, sondern auch aufständische Bauern und Kriegsgefangene wurden dorthin deportiert. Ab 1703 verhängte das Zarenreich auch Haftstrafen als zeitlich begrenzte oder lebenslängliche Zwangsarbeit in Sibirien.
2.3 Alte und neue Formen der geografischen Mobilität
Mithilfe ihrer Navigations- und Schiffstechnik erkundeten die Europäer seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts permanent neue Gebiete, legten große Entfernungen zurück und unternahmen lange Reisen. Immer mehr Menschen überquerten auch den Atlantik. Das Schiff, auf den Illustrationen in den Amerika-Berichten, auf den See- und Landkarten oder in Form von kunstvollen Objekten dargestellt, wurde zum Inbegriff der neuen Zeit (vgl. Abb. 3).
Fallbeispiel: Das Schlüsselfelder-Schiff (Abb. 3)
Das Schiff symbolisierte um 1500 ganz im Sinne der mittelalterlichen Vorstellung noch immer die transzendente Pilgerreise des Christen auf Erden. Zugleich stand es auch für das Verkehrs- und Transportmittel, durch das die Umsegelung der Welt und transkontinentale Wanderungen erst möglich wurden. Es versinnbildlichte die tatsächliche Aneignung der Welt und somit die mentale Überschreitung der Grenzen, wie sie noch für das Mittelalter konstitutiv gewesen waren. Der aus vergoldetem Silber angefertigte Tafelaufsatz aus Nürnberg, das eine zeittypische Karacke mit insgesamt 74 Figuren als Besatzung und Passagiere darstellt, ist ein repräsentatives Trinkgerät. Es wurde zur Zierde einer festlichen Tafel bestimmt und demonstrierte Status und Reichtum seines Eigentümers.

Abb. 3 Das Schlüsselfelder-Schiff, Nürnberg um 1503.
Voraussetzung der stetig zunehmenden Wanderungsbewegungen bildeten erschlossene Seewege, kontinentale Wasser- und Landstraßen und die auf ihnen verkehrenden Verkehrs- und Transportmittel. Die beiden wichtigsten Transportmittel für Waren und Menschen in der Frühen Neuzeit, das Schiff und der Wagen, wurden schon seit der Antike benutzt, erfuhren aber durch die Dynamik der Wanderungsbewegungen in der Frühen Neuzeit einen gewissen Modernisierungsschub.
Entscheidend für die Entwicklung der Hochseeschifffahrt wurde einerseits die Verwendung von Dreimastern mit variabler Besegelung, die das Kreuzen gegen den Wind und somit die Hochseeschifffahrt überhaupt erst ermöglichten, andererseits der Übergang zur Kraweelbeplankung der Schiffe, die eine bessere Dichtigkeit bewirkte und den Bau größerer Schiffe ermöglichte. Im ausgehenden 15. Jahrhundert war die portugiesische Karavelle der bekannteste Schiffstyp dieser Bauweise, mit der eine Reise über den Atlantik etwa zwei bis drei Monate dauerte. Als die kleineren Karavellen für den regelmäßigen Transport und die sichere Fahrt nicht mehr ausreichten, entwickelte man in Spanien gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Galeone. Bei diesem neuen Schiffstyp handelte es sich um ein hochseetaugliches Transport- und Kriegsschiff, das schnell und wendig war. Rumpf und Aufbauten erhielten allerdings infolge der zunehmenden Warentransporte zwischen Südamerika und dem Mutterland eine Übergröße, die das Schiff schwer manövrierbar machte.
Im 17. Jahrhundert führten die Niederländer wichtige Innovationen in der Seefahrt ein. Der von ihren Schiffsbauern entwickelte neue Schiffstyp, die Fleute, war aus leichterem Holz und streng nach Zweckmäßigkeitskriterien gebaut. Sie leitete zugleich auch die Standardisierung des Schiffsbaus ein, was die Herstellungszeit von einem Jahr auf vier Monate reduzierte – kein Wunder, dass viele Handwerker aus Europa unterwegs waren, um in einer der niederländischen Werften Arbeit zu finden und die neue Technologie zu erlernen. Unter ihnen war sicherlich der russische Zar Peter I. der berühmteste, der seine Flotte ausbauen und modernisieren wollte und deshalb inkognito als Handwerker in Zaandam und Amsterdam arbeitete. Die Serienherstellung der Schiffe führte zu einer erheblichen Senkung der Produktions- und Betriebskosten, wodurch der Massentransport von Waren rentabel wurde, was zugleich auch dem Personenverkehr zugutekam. Im 18. Jahrhundert wurden die Schiffstypen durch die Engländer weiterentwickelt. Ihre Fregatten und größeren Linienschiffe machten Großbritannien zur Seemacht und zu einer der führenden Handelsmächte.
Als Passagier auf einem Schiff reiste man allerdings sehr unbequem. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts konnte ein Auswanderer von Rotterdam nach Philadelphia für 7½ Louisdor fahren, dafür erhielt er Verpflegung und einen Schlafplatz, der sechs Fuß lang und ebenso breit war, den er aber mit weiteren drei Personen teilen musste. Der spätere Schriftsteller Johann Gottfried Seume, der als Student zum Kriegsdienst in Amerika genötigt wurde, beschrieb diese Enge am Bord: „In den englischen Transportschiffen wurden wir gedrückt, geschichtet und gepökelt wie die Heringe […]. Im Verdeck konnte ein ausgewachsener Mann nicht gerade stehen, und im Bettverschlage nicht gerade sitzen.“[47] Auch machte den allermeisten Europäern eine Atlantikfahrt auf diesen Schiffen Angst. Der Brandenburg-Bayreuther Gefreite Johann Konrad Döhla, der ebenfalls zum Kriegsdienst in Amerika gezwungen wurde, notierte in seinem Tagebuch:
Die Wellen steigen als wie große Berge nach einander fort auf und gegen das Schiff daher, daß man alle Augenblicke meint, sie würden es verschlingen, ja, sie schlagen oft über das ganze Schiff zusammen […]. Wir wurden, als die ersten Seefahrer, ziemlich zaghaft und wünschten uns öfters in unserem lieben Vaterlande zu sein.[48]
Versuchten Portugiesen und Spanier im 15. und 16. Jahrhundert ihre Kenntnisse über die Seewege mit den dort herrschenden Strömungs- und Windverhältnissen als Staatsgeheimnisse zu bewahren, so waren diese zur Zeit der Ausweitung der Schifffahrt nicht sehr lange zu verheimlichen, zumal die Bemannung der zahlreichen Schiffe ohne fremdes seemännisches Personal nicht möglich war. Ein Großteil der Seemänner der 1602 gegründeten Niederländischen Ostindien-Kompanie etwa kam aus ganz Europa. Es entstand ein für die gesamte Frühe Neuzeit charakteristischer internationaler Migrations- und Arbeitsmarkt für Seeleute. Handelsgesellschaften und Reedereien warben nicht nur um freiwillige Seeleute, sondern rekrutierten seemännisches Personal auch mit Gewalt.
Gewaltsam wurde auch ein Großteil der Ruderer auf den Galeeren im Mittelmeerraum rekrutiert. Alle Meeresanrainer setzten Kriegsgefangene oder eigene und von anderen Staaten gekaufte Strafgefangene als Galeerenruderer ein. So gab es unter den Ruderern der venezianischen Flotte wegen ihrer Konfession verurteilte Hugenotten aus Frankreich oder Protestanten aus den österreichischen und ungarischen Gebieten wie auch wegen Diebstahl, Raub und Mord Verurteilte aus deutschen Reichsstädten und Territorialstaaten.
Hans Staden nutzte um die Mitte des 16. Jahrhunderts die rege Küstenfahrt, die schon seit der Hansezeit den Ostseeraum, die skandinavischen und deutschen Nordseeküsten mit den englischen, französischen und iberischen Hafenstädten verband und sich in der Frühen Neuzeit weiterentwickelte. Auch die Binnenschifffahrt hatte ständig neue Wege zu beschreiten. In den Niederlanden etwa entstand ein dichtes Netz von Kanälen und Wasserwegen, aber auch in den deutschen Territorialstaaten nutzte man schon früh die Flüsse für den gleichzeitigen Waren- und Personenverkehr. Zwischen Mainz und Frankfurt am Main beispielsweise fuhren ab 1600 täglich verkehrende Marktschiffe. 1789 reiste der dänische Schriftsteller Jens Bagessen zwischen Kohl, Erbsen und Rüben auf diesem Schiff zusammen mit „etwa zweihundert Personen beiderlei Geschlechts, aus verschiedenen Völkerschaften, allen Ständen und allen Religionen. Deputierte, Kaufleute, Soldaten, Bauern, Juden, Rattenfänger, Pfarrer, Werber, Handwerker, Komödianten, Frauen, Mädchen und Krebsweiber“.[49]
Der von Bagessen beschriebene Tumult der Passagiere ist nicht nur ein Beleg für die Mobilität der Menschen und die massenhafte Zunahme des Reisens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sondern zugleich für dessen beginnende Egalisierung, da Vertreter aller Stände als gleichbehandelte Passagiere unterwegs waren. In den meisten Fällen reisten jedoch Adelige und betuchte Bürger nach wie vor mit eigenen Transportmitteln, und auf den größeren Schiffen wurden Arme und Reiche durch für sie eigens errichtete Schiffsdecks getrennt.
Die Belastung der Fahrt mit Zöllen, die saisonale Befahrungsmöglichkeit der Flüsse und die meistens in eine Richtung verlaufende Talfahrt stellten Hindernisse für längere Fahrten dar. Nur im Fall von größeren Warenmengen war der Wasserweg gegenüber dem Landweg rentabler: so etwa beim Holztransport aus dem Schwarzwald für die niederländischen Schiffswerften und Städtebauten auf dem Rhein oder bei der Verlegung der Truppen des Schwäbischen und des Bayerischen Reichskreises an die ungarische Türkenfront im 17. Jahrhundert auf der Donau. Dennoch waren längere Fahrten auf den größeren Flüssen auch für Passagiere in der Regel die bequemere Art des Reisens. Auf der Donau wurde 1696 die planmäßige Schifffahrt zwischen Regensburg und Wien eingerichtet, 1712 folgte Ulm mit seinen bis Wien verkehrenden Ordinarischiffen, als die große Auswanderungswelle nach Ungarn eingesetzt hatte.
Gegenüber dem Schiff, das pro Tag bis zu 200 Kilometer zurücklegen konnte, war die Fahrt auf dem Landweg mit dem Wagen, der lediglich 20 Kilometer pro Tag fahren konnte, unverhältnismäßig langsamer. Sogar ein Fußgänger schaffte je nach Wegbeschaffenheit und Wetterlage 30 bis 50 Kilometer an einem Tag. Dennoch gehörte dem Wagen auf Europas Straßen die Zukunft. Frachtwagen, die dem Nah- und Ferntransport von Gütern aller Art dienten, wurden in der Frühen Neuzeit immer sicherer und größer und konnten bei guten Straßenverhältnissen Warenmengen zwischen vier und acht Tonnen transportieren. In Frankreich wie auch in den deutschen Territorialstaaten wurde der Transport auf Rädern bis ins 18. Jahrhundert hinein durch anliegende Bauern im Nebenerwerb oder als Frondienst geleistet. Nicht selten spezialisierten sich mit der Zeit ganze Gemeinden auf den Transport von Gütern und Personen.
Parallel zum Gütertransport entwickelte sich auch der Personenverkehr mit dem Wagen. Für die Mobilität auf den Landwegen war der seit dem 16. Jahrhundert allmählich erfolgte Mentalitätswandel des männlichen Adels von großer Bedeutung, der neben dem Reiten die Beförderung per Wagen als standesgemäß akzeptierte. Dieser Wandel begann nach den Quellen in Ungarn. Die aus leichtem Holz gebaute und deshalb eine hohe Elastizität und Bequemlichkeit aufweisende ungarische Kutsche (kocsi) erlangte dort eine so große Beliebtheit, dass den Militärdienst leistenden Adeligen in einem königlichen Dekret von 1523 bedeutet werden musste, nicht mit der Kutsche, sondern zu Pferd ins Feldlager zu ziehen. Der ungarische Wagentyp wurde europaweit übernommen und für den Personenverkehr weiterentwickelt. Zunächst noch von Fürsten und dem Hochadel zu offiziellen Anlässen benutzt, wurde die Kutsche in italienischen Werkstätten aufwendig und prachtvoll ausgestattet. Im 17. Jahrhundert von Ludwig XIV. gefördert, entstand in Frankreich ein wichtiges Zentrum des Kutschenbaus. Die Kutsche erhielt jetzt eine mit Türen und Fenstern versehene geschlossene Kabine, die den Reisenden vor den Unbeständigkeiten der Witterung und dem Staub der Wege schützte. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts spielte auch Großbritannien eine führende Rolle bei der technischen Entwicklung und der Massenproduktion der Kutsche. Die große Beliebtheit dieses Transportmittels in den Städten zeigte sich in der Entstehung der ersten Mietkutschenunternehmen in London und Paris. In England verkehrten zwischen den Städten bald auch coaches und wagons, die bis zu 20 Personen auf einmal beförderten.
Mit der Verschmelzung der gewerblichen Personenbeförderung und der Post im 17. Jahrhundert erfolgte im Personenfernverkehr ein Durchbruch. Ende des Jahrhunderts waren bereits alle großen Städte im Alten Reich durch kaiserliche, territoriale oder private Postbeförderungssysteme miteinander verbunden, die verschiedene Bereiche der Beförderung von Briefen, Kleingütern und Personen bündelten. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte sich dann das Postkutschenwesen eindeutig durch. Durch das System der Posten, d. h. der Stationen für den Wechsel der Pferde, und die Einrichtung von festen Routen und unabhängig von der Tagesnachfrage eingehaltenen Abfahrtszeiten wurde die Reise planbar und nicht zuletzt auch schneller. So konnte in Zedlers Universallexikon festgehalten werden: „Wer geschwinde reisen will, nimmt die Post.“[50] Die Geschwindigkeit hatte allerdings ihren Preis und dieser war nicht für jedermann erschwinglich. So kostete eine einfache Fahrt zwischen Hamburg und Berlin im 18. Jahrhundert ziemlich konstant neun Taler, was dem Monatsverdienst eines Maurergesellen gleichkam.
Schnelligkeit war größtenteils von den Straßenverhältnissen abhängig und diese ließen trotz erster großer Anstrengungen beim Chausseebau im 18. Jahrhundert noch viel zu wünschen übrig. Bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts waren die Trassen der Fernwege in der Regel unbefestigt, was dazu führte, dass die Räder der Wagen und Postkutschen Spurrillen im Untergrund der Straßen hinterließen und sich stellenweise Hohlwege herausbildeten, die vor allem bei schlechtem Wetter die Fahrt erheblich einschränkten.
Der Wunsch nach rentablem Transport von Gütern und nach schnellerer und besserer Mobilität der Menschen führte zu neuen Innovationen in Technik und Organisation des Transports- und Verkehrswesens. Doch trotz aller Neuerungen konnte sich die Mobilität während der gesamten Frühen Neuzeit nicht von der Natur emanzipieren. Sie blieb auf See von den Wind- und Wasserströmen und auf der Straße vom Pferd als Kraftmaschine abhängig. Bis Ende des 18. Jahrhunderts waren die meisten Menschen allerdings „auf Schusters Rappen“ unterwegs, war dies doch die erschwinglichste Form der Fortbewegung.