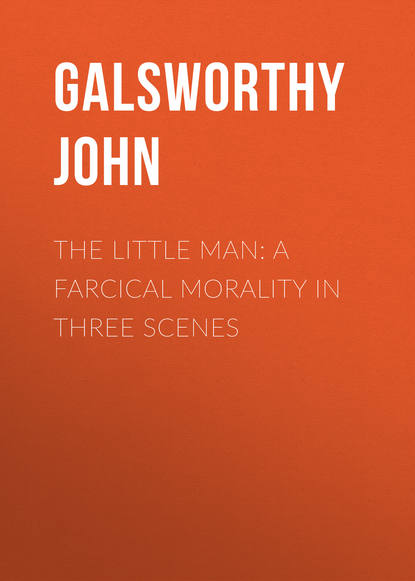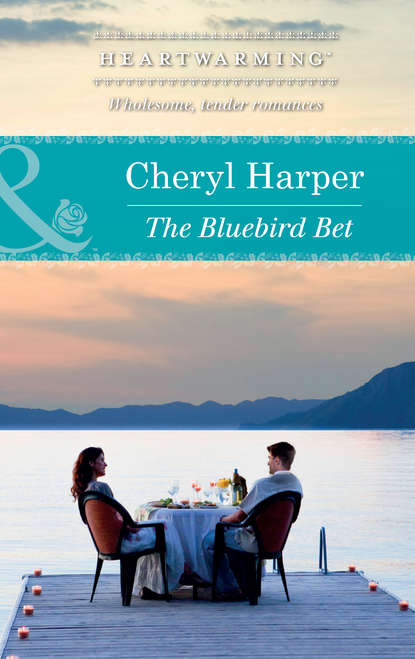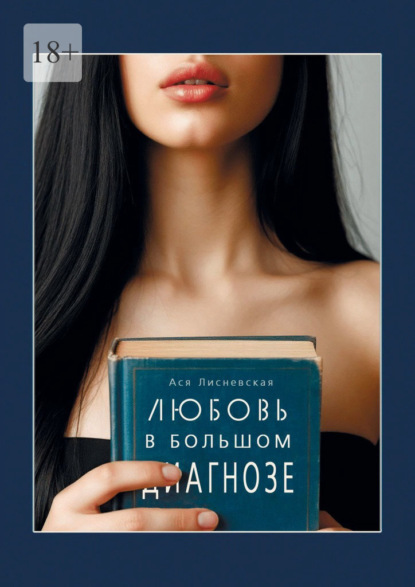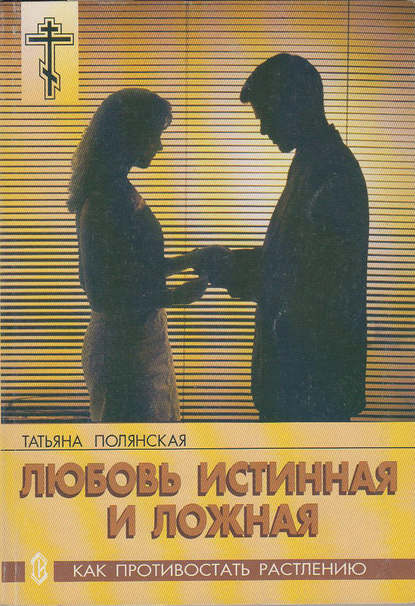Selbstoptimierung und Enhancement
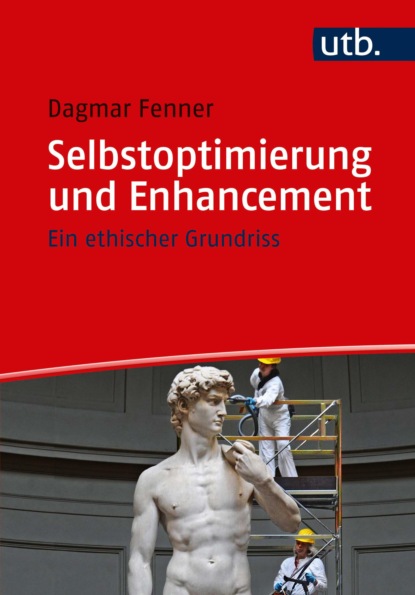
- -
- 100%
- +
Erkenntnisbedingungen: hinlängliches Wissen und kognitive Fähigkeiten
FreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive)Damit sich ein freier Wille bilden kann, müssen etwas konkreter folgende Erkenntnisbedingungen erfüllt sein: Zunächst braucht es ein hinlängliches Wissen sowohl über die vorgefundene Wirklichkeit als auch die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Jemand muss einigermaßen realistisch einschätzen können, welche Handlungsoptionen ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich offenstehen. Da in verschiedenen Handlungssituationen jeweils ganz unterschiedliche Kenntnisse vonnöten sind, kann die Willensfreiheit einer Person situativ in größerem oder kleinerem Grad vorhanden sein: Jemand kann in hinreichendem Maß willensfrei sein bei alltäglichen Verrichtungen wie Einkaufen, aber unfrei bei komplexeren Betätigungsformen wie Bankgeschäften. Wenn die kognitiven Fähigkeiten des Wahrnehmens und Erkennens z.B. infolge einer psychischen Erkrankung eingeschränkt sind, kommt es zu einer inadäquaten Situationswahrnehmung wie etwa beim „Tunnel-Blick“ von Depressiven oder einer krankhaft veränderten Körperwahrnehmung bei Kandidatinnen für Schönheitsoperationen (Kap. 3.1). Willensfreiheit erfordert daher zusätzlich die kognitiven Fähigkeiten des kritischen Prüfens und Hinterfragens: Kritisch überprüft werden sollen die eigenen Wünsche und Hintergrundannahmen, auf denen sie basieren. Auszusondern sind zum einen „neurotische WünscheWünscheneurotische“, die einer krankhaften psychischen Verfassung wie der erwähnten Körperbild-Störung oder einem Minderwertigkeitskomplex entspringen (vgl. Fenner 2007, 68f.). Denn die Befriedigung solcher Wünsche etwa nach Schönheitsoperationen oder der Eroberung von Frauen zum Beweis der eigenen Unwiderstehlichkeit bringt nicht die erhoffte Erfahrung von Erfüllung. Zum andern dürfen „uninformierteWünscheinformierte/uninformierte“ oder „unaufgeklärteWünscheaufgeklärte/unaufgeklärte Wünsche“ nicht zu Handlungszielen mutieren, weil ihnen Fehleinschätzungen der Handlungssituation oder der eigenen Fähigkeiten zugrunde liegen (vgl. ebd., 62f.). Dazu zählt etwa der oben erwähnte Wunsch nach einem Auftritt in der Scala bei mittelmäßigem musikalischem Talent. Eine sorgfältige Prüfung der eigenen Wünsche setzt eine reflexive, distanzierte Grundhaltung zu den eigenen Einstellungen und einen inneren, kritischen Abstand zu sich selbst voraus (vgl. BieriBieri, Peter, 71f./LeefmannLeefmann, Jon, 287f.). Ruiniert wird eine solche Haltung durch heftige Affekte oder Triebe: Höchst unfrei ist jemand in einer sogenannten Affekthandlung, bei der ein kurzzeitiger intensiver Erregungszustand etwa aufgrund einer überfordernden Stresssituation oder einer akuten Existenzangst die Einsichts- und Kritikfähigkeit ausschaltet oder stark herabsetzt. Genauso unfrei sind triebhafte Menschen, die sich einfach von ihren unhinterfragten spontanen Wünschen treiben lassen (vgl. FrankfurtFrankfurt, Harry, 72f.).
Wertungsbedingung: Ausbildung von Wünschen zweiter Ordnung
FreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive)Neben dieser Erkenntnisbedingung muss noch die Wertungsbedingung erfüllt sein: Die eigenen Dispositionen, Wünsche und Einstellungen sollen nicht nur erkannt, sondern auch mithilfe eigener Überlegungen bewertet werden (vgl. LeefmannLeefmann, Jon, 287). Willensfreiheit setzt nicht allein die Erkenntnis der faktisch vorhandenen Wünsche erster OrdnungWünscheerster/zweiter Ordnung voraus, die unmittelbar auf einen ersehnten Zustand oder ein erstrebtes Objekt gerichtet sind. Vielmehr braucht es gemäß Frankfurts vieldiskutierter Theorie der Willensfreiheit noch Wünsche zweiter Ordnung, die sich wertend auf solche Wünsche erster Ordnung beziehen (vgl. FrankfurtFrankfurt, Harry, 71): Wünsche zweiter Ordnung sind die auf einer höheren Reflexionsebene befindlichen Wünsche, bestimmte Wünsche erster Ordnung zu haben oder nicht zu haben. Wünscht sich jemand auf dieser höheren Ebene, dass ein bestimmter bereits vorhandener Wunsch ein Wille werde, nennt FrankfurtFrankfurt, Harry die entsprechenden Wünsche zweiter Ordnung Volitionen. Eine Person wäre genau dann willensfrei, wenn diejenigen Wünsche erster Ordnung handlungswirksam werden, die ihren Volitionen zweiter Ordnung entsprechen. Wichtig ist der Akt der Identifikation, d.h. die positive Bewertung und Bejahung der eigenen handlungswirksamen Wünsche und damit des eigenen Willens, weil dieser erst dadurch eine besondere „Zugehörigkeit“ zur Person erhält (vgl. BieriBieri, Peter, 382/FrankfurtFrankfurt, Harry, 93/KipkeKipke, Roland 2011, 106). Wünsche zweiter Ordnung können zentrale Wertvorstellungen, weiterreichende berufliche oder familiäre Lebensziele oder abstrakte Ideale wie Tapferkeit oder Coolness sein. Sie legen fest, was einer Person in ihrem Leben wichtig ist und wer sie sein möchte, und müssen sich mit vernünftigen Gründen rechtfertigen lassen. Während bei FrankfurtFrankfurt, Harry die Frage nach einem Bewertungsmaßstab für die Wünsche zweiter Ordnung offen bleibt und womöglich in einem unendlichen Regress auf immer noch höhere Stufen verschoben wird, hat man sein Modell später durch das Kriterium der „Kohärenz“ erweitert (vgl. KipkeKipke, Roland 2009, 377): Volitionen müssen kohärent sein, d.h. in den Gesamtzusammenhang einer Persönlichkeit mit stabilem Wertesystem und umfassendem Lebensplan integriert sein. Da die zentralen Lebensziele und Ideale das „Selbstkonzept“ oder „normative Selbst“ einer Person konstituieren, muss der freie Wille mit dem normativen Selbst übereinstimmen (Kap. 1.1). Willensfreiheit ist daher gleichbedeutend mit Selbstbestimmung oder „Selbstübereinstimmung“ sowie AutonomieFreiheitWillens-, Autonomie (positive) oder „Selbstgesetzgebung“, weil sich die Person mit ihrem Selbstkonzept und ihren Lebenszielen ihr „eigenes Gesetz“ gibt und diesem in ihrem Wollen und Handeln Ausdruck verleiht. Nur wenn sie im Einklang mit ihrem normativen Selbstbild handelt, tut sie das, was sie wirklich tun will.
Negative Randbedingung: Fehlen von Heteronomie
FreiheitOb Willensfreiheit vorliegt oder nicht, scheint nun wesentlich von der Art der Genese der Wünsche zweiter Ordnung abzuhängen: a) Intern betrachtet bedroht ein psychologischer Determinismus den freien Willen, b) extern gesehen eine Heteronomie im Sinne sozialer Fremdbestimmung. Ad a: Gemäß dem etwa von Gerhard Roth und Wolf Singer vertretenen psychologischen DeterminismusDeterminismus werden der Wille und das Handeln einer Person determiniert durch ihre eigenen Wünsche, Charakterzüge und Gewohnheiten, die ihrerseits durch Faktoren wie genetische Anlagen, frühkindliche Prägung und biographische Entwicklung bedingt sind (vgl. dazu Wildfeuer, 364f./KipkeKipke, Roland 2011, 100f.). Ihrer Ansicht nach ist Willensfreiheit zwar mit einem solchen „weichen Determinismus“ vereinbar, weil kein äußerlicher Zwang, sondern nur eine Determination durch eigene Wünsche oder Motive stattfindet. Im strengen Sinn liegt positive Freiheit im Wollen aber wie gezeigt nur vor, wo reflexive Distanz zu den eigenen Wünschen, Motiven und Überzeugungen gewahrt ist und die Entscheidung für bestimmte Handlungsoptionen auf eigene Überlegungen zurückgeht. Obgleich die bei der Reflexion abgewogenen Gründe faktisch von Erziehung, Sozialisation oder persönlichen Erfahrungen herstammen mögen, müssen sie kritisch hinterfragt und geprüft und aus reflexiver Distanz bejaht oder verworfen werden (vgl. Fenner 2008, 187f.). Ad b: Ethisch gesehen von viel größerer Relevanz ist die Bedrohung der Willensfreiheit durch Heteronomie oder Fremdbestimmung, weil eine solche Verletzung des grundlegenden Rechts auf Selbstbestimmung durch Mitmenschen oder den Staat moralisch höchst verwerflich ist: Ursprung des Wollens und Handelns ist dann nicht das handelnde Subjekt selbst, sondern der Wille einer anderen Person oder einer sozialen Gruppe. Das Fehlen von äußerer Fremdbestimmung oder Heteronomie stellt gewissermaßen eine negative Randbedingung für innere Selbstbestimmung oder Autonomie dar. Ein klarer Fall von Heteronomie ist die ManipulationManipulation, bei der durch einen gezielten Einsatz von Rhetorik, Propaganda, Drogen oder anderen psychologischen Mitteln die kritische Reflexionsfähigkeit und der Wille anderer Menschen ausgeschaltet werden. So versucht suggestive, manipulativeManipulation Werbung z.B. durch die Kürze der Einblendung eine bewusste Wahrnehmung zu umgehen oder unbewusste Ängste oder Bedürfnisse anzusprechen. Um einen Menschen zu manipulieren und seine WillensfreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive) zu untergraben, reicht aber bereits eine Täuschung durch falsche oder selektive Informationen bzw. das bewusste Vorenthalten relevanter Kenntnisse über die Handlungssituation aus. Wird beispielsweise eine Person durch die Werbung der Schönheitsindustrie mit irreführenden und suggestiven Bildern versorgt und durch die behandelnden Chirurgen unzureichend über eine gewünschte Schönheitsoperation aufgeklärt, kann ihre Entscheidung nicht frei genannt werden.
FreiheitAm häufigsten verbindet man Heteronomie jedoch mit der Vorstellung von einem direkten sozialen ZwangDruck, sozialer, bei dem jemand unter Anwendung oder Androhung von Gewalt zu etwas gezwungen wird, das seinem Willen widerstrebt. Aufgrund des moralischen und auch rechtlich geschützten Rechts auf Selbstbestimmung verbietet sich ein solches Aufzwingen eines fremden Willens durch Gewalt oder Nötigung. Entsprechend ist auch ein direkter Zwang zu Verbesserungshandlungen unter fast allen Umständen ethisch unzulässig (vgl. oben/AchAch, Johann 2016, 127f.). Wie bei der Erörterung der sozial externen Beschränkungen menschlicher Handlungsfreiheit gesehen, sind aber subtilere, gewaltfreie Formen eines indirekten sozialen Zwangs etwa durch gesellschaftliche Normen oder Ideale schwieriger zu kategorisieren und zu beurteilen. Sind wir etwa allein schon deswegen unfrei, weil wir in eine bestimmte Gesellschaft mit vorgegebenen Handlungsoptionen, Wertvorstellungen und Gesetzen hineingeboren werden? Schließlich hat es keiner frei gewählt, in einer Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft mit dem neuen handlungsmächtigen Trend zur Selbstoptimierung zu leben. Auch wenn Willensfreiheit in sozialer Hinsicht sicherlich durch mehr als nur durch direkte Gewalteinwirkung und Manipulation bedroht ist, wird sie schwerlich durch die vorgefundene Auswahl an gesellschaftlichen Selbstbildern, Rollenmustern und Vorstellungen vom guten Leben schon prinzipiell verunmöglicht. Denn Willensfreiheit oder Selbstbestimmung dürfen nicht mit einer absoluten Autonomie oder Autarkie in dem Sinn verwechselt werden, dass sich ein freier Wille in völliger sozialer Isolation und ohne jeden Einfluss entwickeln müsste. Vielmehr spielen zunächst Vorbilder, frühe Bezugspersonen und Lehrer eine zentrale Rolle, damit Heranwachsende mit den in der Gesellschaft realisierbaren Möglichkeiten an Selbstbildern und Lebensformen überhaupt erst einmal vertraut werden. Sowohl die WünscheWünscheerster/zweiter Ordnung erster Ordnung als auch die Bewertungsmaßstäbe der Wünsche zweiter Ordnung formen sich stets in Interaktion mit dem sozialen Umfeld heran. Positiv betrachtet können die Mitmenschen eine große Hilfe dabei sein, die eigenen Wünsche und das eigene Wollen zu erkennen und mit kritischem Nachfragen gegebenenfalls über eine Selbsttäuschung hinwegzuhelfen (vgl. BieriBieri, Peter, 421). Damit sich eine Identität oder ein Selbst herausbilden und stabilisieren kann, ist außerdem die Anerkennung der selbstgewählten Ziele und Ideale durch das soziale Umfeld erforderlich. Doch wo liegt die Grenze zwischen einem im Austausch mit anderen entwickelten autonomen Willen und einem von der Gesellschaft oktroyierten oder durch sie manipulierten heteronomen Willen, wenn es nicht um Autarkie und innere Abgeschlossenheit geht?
FreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive)Druck, sozialerSozial vorgegebene Ideale und Vorstellungen vom guten Leben müssen sich letztlich in der Praxis dadurch bewährenArgumenteBewährungs-, dass sie dem Einzelnen tatsächlich ein gelingendes gutes Leben ermöglichen. Auch wenn das Verfahren wegen der frühkindlich erworbenen gesellschaftlichen Beurteilungsmaßstäbe als zirkulär erscheint, werden Werterfahrung und Glückserleben nicht vollständig determiniert durch diese internalisierten normativen Orientierungen. Während Handlungsfreiheit nur in einer Gesellschaft realisierbar ist, die dem Einzelnen einen ausreichenden Handlungsspielraum lässt, setzt Willensfreiheit eine gesellschaftliche Offenheit gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen und Wertvorstellungen voraus. Statt ihre Mitglieder zu einer teilnahmslosen Anpassung an bestimmte vorgegebene Ziele und Ideale zu zwingen, müsste eine freiheitsfördernde Gesellschaft individuell abweichenden Lebensentwürfen wenigstens ein Minimum an Anerkennung und Unterstützung zusichern. Ein negatives Extrembeispiel wäre eine totalitäre religiöse Gemeinschaft oder „Sekte“, die mit einer lückenlosen Informationskontrolle und einem strengen Regiment des Belohnens und Bestrafens die vollständige Unterwerfung des Einzelnen unter die Gemeinschaft intendiert und jede kritische Auseinandersetzung mit dem religiösen Orientierungssystem unterbindet. Wenn die Mitglieder zuerst emotional und finanziell von der Gemeinschaft abhängig gemacht werden und ihnen bei abweichenden Meinung mit der sozialen Ausschließung gedroht wird, ist das Verlassen der „Sekte“ für die Betroffenen keine erwägenswerte Option mehr. Bezüglich der Selbstoptimierung könnte man einen analogen Fall so konstruieren, dass in Zukunft in sämtlichen Berufsbranchen irgendeine Form von Enhancement zu den Einstellungsbedingungen gehört. Auch hier hat jemand, der Enhancement grundsätzlich ablehnt, keine „echte“ Wahl, weil er die Exklusion aus der Arbeitswelt und damit meist auch aus einem sozialen Netzwerk nicht ernsthaft wollen kann. Von einer regelrechten Zwangslage oder einem gesellschaftlichen ZwangDruck, sozialer lässt sich allerdings strenggenommen nur da sprechen, wo basale menschliche Güter wie Leben, Gesundheit oder Fähigkeit zur Selbstbestimmung geopfert werden müssten. Denn sehr häufig wird in der alltäglichen Lebenspraxis etwas zwar nicht um seiner selbst willen erstrebt, aber als akzeptables Mittel zur Erfüllung eines eigenen Wunsches gutgeheißen (vgl. BieriBieri, Peter, 115f.). So schlucken wir eine bittere Medizin, um gesund zu werden, oder eben Pillen zur Leistungssteigerung, um einen besseren Job zu bekommen oder mit der Konkurrenz mithalten zu können. Sofern keine gravierenden Nebenwirkungen zu erwarten sind, ließe sich kaum von einer echten Zwangslage und der Unfreiheit des Willens sprechen (Kap. 4.4).FreiheitWillens-, Autonomie (positive)
Kontrollbedingung: Selbststeuerungsfähigkeit
FreiheitNeben der Erkenntnis- und Wertungsbedingung muss schließlich noch die Kontrollbedingung erfüllt sein: Eine Person muss sich in ihrem Handeln an den eigenen Gründen orientieren und die Verwirklichung der gewählten Handlungsziele einleiten können (vgl. LeefmannLeefmann, Jon, 287). Als Willensstärke wird die positiv formulierte Fähigkeit bezeichnet, seine eigenen Ziele durch absichtliches und realitätsgerechtes Handeln notfalls gegen innere und äußere Widerstände durchzusetzen. Bei einem Willensschwachen hingegen erlischt der Wille rasch und wird wieder zum bloßen Wunsch, sobald sich die Realisierung der Ziele als schwierig herausstellt (vgl. BieriBieri, Peter, 38; 100/KipkeKipke, Roland 2011, 171ff.). Unabdingbar für die Kontrolle seines Willens ist außerdem die negativ definierte Fähigkeit, unwillkürlich auftretende, den persönlichen Zielen zuwiderlaufende Triebe, Motive und Gefühle hemmen zu können. Beide Fähigkeiten sind wichtige Komponenten der Selbstregulationsfähigkeit oder SelbststeuerungsfähigkeitSelbststeuerungsfähigkeit/Selbstkontrolle als Gesamtheit von bewussten und unbewussten psychischen Vorgängen, mit denen Menschen ihre Aufmerksamkeit, Emotionen und Handlungsimpulse regulieren. Diese individualethisch kaum zu überschätzende Fähigkeit zur Selbstregulierung umfasst außerdem noch die erwähnten Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung und -bewertung sowie die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub und zur Selbstmotivation. Sie ist schon aufgrund genetischer Anlagen sehr unterschiedlich ausgeprägt und z.B. durch impulsive und aggressive Charakterdispositionen oder ADHS stark vermindert. Sie muss aber grundsätzlich in der frühen Kindheit trainiert werden, z.B. dank geeigneter Vorbilder, klarer Ansagen wie „Warte noch ein bisschen“ und der Kommentierung der kindlichen Gefühle und Gedanken als eine Art Anleitung zur Selbstreflexion wie: „Macht Dich das jetzt traurig?“ (vgl. Pauen). Die meisten Freiheitstheoretiker wie FrankfurtFrankfurt, Harry beschäftigen sich nicht weiter mit dem interessanten Fall, dass eine Person sich auf einer höheren Reflexionsebene gegen einen Wunsch erster Ordnung entscheidet, ohne dass dieser aber verschwindet. Diese Unfähigkeit zur KontrolleSelbststeuerungsfähigkeit/Selbstkontrolle des eigenen Willens könnte an einer krankhaften Sucht liegen oder in unbewusst wirkenden, frühkindlich verinnerlichten Idealen oder in dauerhaften Persönlichkeitsmerkmalen wie z.B. einem Hang zu Neid und Eifersucht verankert sein. Um vom Zustand der Unfreiheit wieder in denjenigen der FreiheitFreiheit zu gelangen, wäre dann die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit in Form einer Therapie oder Selbstformung erforderlich (vgl. KipkeKipke, Roland 2011, 102). Kontrovers diskutiert wird, ob biomedizinische Mittel zur Selbstoptimierung den eigenen Willen stärken oder langfristig die Fähigkeit zur Selbstregulierung und Selbstbestimmung untergraben (Kap. 4.4)FreiheitWillens-, Autonomie (positive)
2.3.2 Würde
In der Debatte um Selbstoptimierung und Enhancement spielt auch das normative Konzept der „Menschenwürde“ eine Rolle, das philosophisch-säkular gesehen in engem Zusammenhang mit dem Konzept „Freiheit“ steht. Formal und allgemein handelt es sich bei der Menschenwürde um eine diffuse, disparat gedeutete normative Leitvorstellung, die allen Menschen einen bestimmten moralischen Status und eine besondere Schutzwürdigkeit zuspricht. Inhaltlich existieren aber so viele verschiedene Interpretationen von „WürdeWürde“, dass sowohl Gegner als auch Befürworter sich darauf beziehen. In Francis Fukuyamas Worten ist der Grund für die Würde-Zuschreibung ein „Faktor X“ als essentielle Eigenschaft aller Menschen, die jedoch in verschiedenen Weltbildern jeweils anders bestimmt wird (vgl. 210ff.). Von BiokonservativenBiokonservatismus werden biotechnologische Optimierungsmaßnahmen häufig abgelehnt, weil sie in ihrem Verständnis die „Würde“ des Menschen oder menschlicher Aktivitäten gefährden (vgl. KassKass, Leon, 128f./KassKass, Leon u.a., 290f.). Im Hintergrund stehen dabei oft christliche Überzeugungen, auch wenn diese nicht explizit gemacht werden (Kap. 1.3): Bei einer Argumentechristliche/religiösereligiösen Auslegung der Menschenwürde kommt allen Menschen ein absoluter intrinsischer Wert und eine unhintergehbare Würde zu, weil alle Menschen von Gott geschaffen und Gottes Ebenbilder sind (vgl. dazu Fenner 2010, 83). Als Kinder Gottes und mit Vernunft und Wille ausgestattete Wesen haben sie Anteil an der göttlichen Heiligkeit und nehmen innerhalb der göttlichen Schöpfung eine Sonderstellung ein. BiokonservatismusDa der Würdestatus ausschließlich durch die Zugehörigkeit zur Gattung des Menschen, nicht aber durch die individuelle Ausprägung konkreter menschlicher Eigenschaften bedingt wird, handelt es sich um eine GattungsbetrachtungWürdeindividualisierende/Gattungsbetrachtung menschlicher WürdeWürde (vgl. ebd., 58). Wie FukuyamaFukuyama, Francis richtig bemerkt, kann diese Deutung allerdings nur diejenigen überzeugen, die an Gott glauben (vgl. 211). Eine auf den direkten Bezug auf Gott verzichtende biokonservative Argumentation macht demgegenüber eine konstante, gegebene menschliche NaturNaturmenschliche oder das „Wesen“ des Menschen geltend. Um eine absolute menschliche Würde sowie universelle Menschenrechte begründen zu können, komme nur die feste Grundlage der allen Menschen gemeinsamen „Natur“ in Frage (vgl. ebd., 160ff./KassKass, Leon u.a., 289f.). Wie sich in Kapitel 2.4 zeigen wird, sind aber Postulate einer normbildenden feststehenden Natur des Menschen begründungslogisch höchst problematisch. Wenn der X-Faktor wie bei FukuyamaFukuyama, Francis und KassKass, Leon nur äußerst vage konkretisiert wird als ein schwer beschreibbares komplexes Ganzes aus Vernunft, Bewusstsein, Empfindungsvermögen, Gefühlen und Soziabilität, scheint die Würde durch Biotechnologien aber ohnehin nicht bedroht werden zu können (vgl. ebd., 239/KassKass, Leon, 17f.).
BioliberaleBioliberalismus sehen die menschliche Würde in keiner Weise durch neue Optimierungsmaßnahmen bedroht, weil sie sowohl spezifische religiöse Begründungen als auch die Vorstellung einer konstanten und an sich wertvollen menschlichen Natur ablehnen (vgl. Althaus u.a., Teil 3). Betont werden stattdessen die Veränderbarkeit und Verbesserungswürdigkeit des Menschen und der hohe Wert seiner Selbstbestimmung, sodass das Konzept der „Würde“ eng an dasjenige der „Freiheit“ heranrückt. Aus einer säkularen philosophisch-ethischen Perspektive reicht der Hinweis auf die Zugehörigkeit zur Gattung „Mensch“ grundsätzlich nicht aus, um einen moralischen Sonderstatus des Menschen zu rechtfertigen (vgl. Fenner 2010, 83f.). Wenn den Menschen allein aufgrund ethisch irrelevanter biologischer Eigenschaften wie eines bestimmten Chromosomensatzes besondere Schutzwürdigkeit zugesprochen wird, handelt es sich nach einem berechtigten Einwand von Peter Singer vielmehr um einen „Speziesismus“. Genauso wie beim „Rassismus“ oder „Sexismus“ würden dann die Interessen der Mitglieder der eigenen Gruppe bevorzugt behandelt, ohne dass es dafür einen relevanten Grund gibt. Für eine hinlängliche Begründung eines moralischen Sonderstatus müssten sich ethisch relevante Eigenschaften oder Fähigkeiten der Menschen angeben lassen, die anderen Lebewesen fehlen. Im Anschluss an Immanuel KantKant, Immanuel wird der X-Faktor in säkularen Gesellschaften meist als die typisch menschliche Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung definiert, die ethisch von Bedeutung ist. Denn wenn ein Wesen sich selbst Zwecke setzen, Vorstellungen von einem guten Leben entwickeln und persönliche, über das nackte Überleben hinausgehende Interessen verfolgen kann, ist es in vielfältigerer und tieferer Weise verletzbar und braucht deswegen mehr moralische Rücksichtnahme als ein weniger entwickeltes, nichtselbstbestimmungsfähiges Tier. Diese innere WürdeWürdeinnere, s. auch „Willensfreiheit“ als zentrales Leitprinzip der neueren Ethik wird also konstituiert durch die Willensfreiheit, Selbstbestimmung oder Autonomie der Menschen (vgl. ebd., 57). Entsprechend liegt eine Verletzung dieser Würde vor, wo ein Mensch etwa durch Gewaltanwendung oder Manipulation verdinglicht oder instrumentalisiert wird. Bei einer Würdeindividualisierende/Gattungsbetrachtungindividualisierenden Betrachtung ist WürdeWürde graduierbar und hängt vom individuellen Besitz der entscheidenden mentalen Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung ab. Kleinkindern, Komatösen oder Demenzkranken könnte eine innere Würde höchstens mithilfe zusätzlicher Argumente wie etwa dem Potentialitäts-Argument zugesprochen werden, demzufolge sämtliche Mitglieder der vernunftbegabten Spezies „homo sapiens“ zumindest in einem potentiellen Sinn zur Selbstbestimmung fähig sind (vgl. ebd., 58).
Von dieser an Willensfreiheit gekoppelten „inneren Würde“ ist eine „äußere Würde“ oder „Würde-Darstellung“ zu unterscheiden, die vom Ausmaß an Handlungs- bzw. Willkürfreiheit abhängt. Würde-DarstellungWürdeäußere Würde-Darstellung bezeichnet die Möglichkeit eines Menschen, ohne innere und äußere Zwänge und Hindernisse seine selbstgesetzten Ziele in die Realität umsetzen zu können (vgl. Fenner 2010, 58f.). Diese Art von Würde ist offenkundig genauso graduierbar wie die Handlungsfreiheit, da sie durch die gleichen Hindernisse beeinträchtigt wird: Menschen können durch sozial externe Beschränkungen seitens von Einzelpersonen oder der Gesellschaft, durch interne natürliche Beschränkungen wie Krankheiten oder Behinderungen oder interne soziale Beschränkungen wie schlechte Ausbildung oder Arbeitsverhältnisse daran gehindert werden, ihre Würde zu realisieren oder zur Darstellung zu bringen. Damit ist auch schon deutlich geworden, dass eine im LiberalismusBioliberalismus weit verbreitete rein negative Bestimmung äußerer Würde genauso wenig sinnvoll ist wie die ausschließlich negativ als Abwesenheit von Handlungsschranken definierte Handlungsfreiheit. Wie gut jemand sein Leben selbstbestimmt gestalten und seine Handlungsziele verwirklichen kann, hängt vielmehr ab von positiv vorhandenen individuellen, materiellen, sozialen und institutionellen Bedingungen. Der Schutz äußerer menschlicher Würde verlangt daher nicht nur negative Freiheitsrechte wie das Recht auf Leben, freie Berufswahl oder Versammlungsfreiheit, sondern auch positive Sozialrechte wie Recht auf Existenzminimum, Bildung oder Gesundheit. Ethisch betrachtet muss der normative Gehalt oder die Bedeutung der Menschenwürde grundsätzlich durch Rechte näher bestimmt werden. Da Rechte zur Sicherung menschenwürdiger Lebensbedingungen für alle Menschen gefordert werden, spricht man von Rechte (auf)Menschen-Menschenrechten. Es wäre aber ein naturalistisches Missverständnis zu meinen, Menschenrechte seien „natürlich“ oder dem Menschen „von Natur aus angeboren“. Ein häufiger Denkfehler ist es auch, das Recht auf Schutz der Würde an den Besitz von Würde zu koppeln. Denn gerade Menschen, die aufgrund schlechter Ausbildung, Armut, Krankheit oder ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse in geringerem Maß Würde darstellen oder verkörpern, sind besonders auf Schutz und Hilfeleistungen angewiesen (vgl. dazu Fenner 2016, 81f.). Aus bioliberaler Sicht fördern neue technologische Selbstoptimierungs-Maßnahmen menschliche WürdeWürde, weil sie interne natürliche Beschränkungen aufheben und damit die Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns erweitern. Ob allerdings ein von radikalen Transhumanisten angestrebter rein siliziumbasierter „Posthumaner“ ohne Körper noch Würde darstellen kann, ist äußerst fraglich.