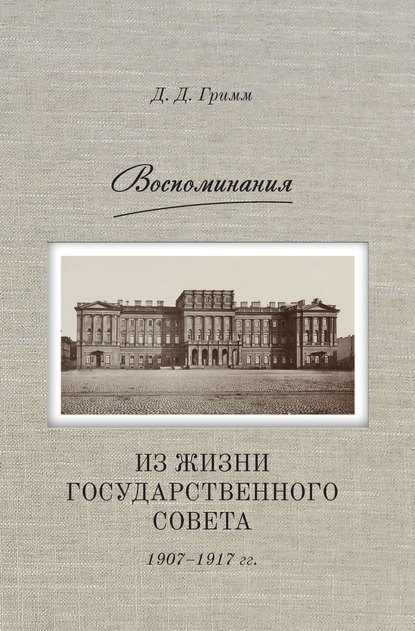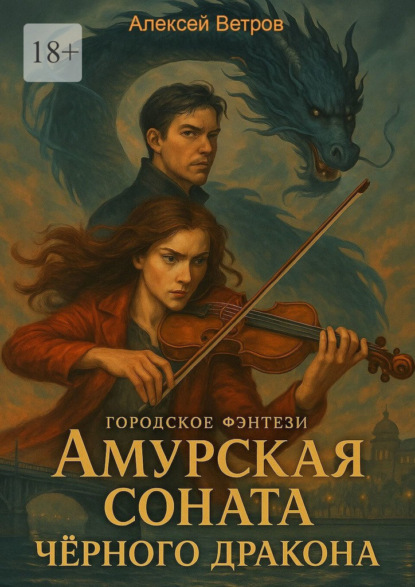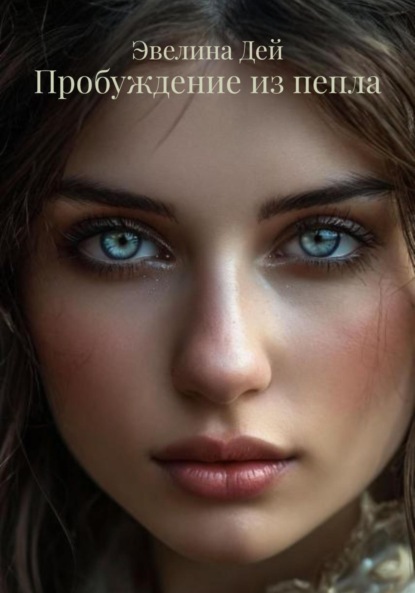Validation als Lebensphilosophie
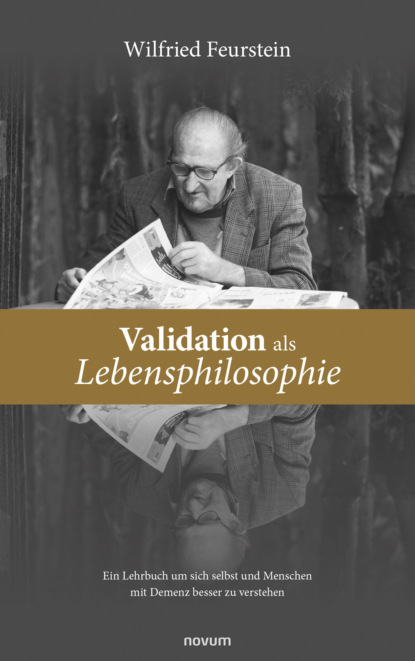
- -
- 100%
- +
Als ich ein kleiner Junge war, fuhren jedes Jahr Roma mit ihren großen Kastenwagen in unser Dorf ein, um hier ihre Korbwaren zu verkaufen. Wie im Flug verbreitete sich die Kunde ihrer Ankunft. Alle Bewohner des Dorfes rannten, um ihr Hab und Gut in den Scheunen und Häusern zu verstecken. Die Hühner durften ihren Stall und die Kinder das Haus nicht mehr verlassen, weil man sich erzählte, dass Roma stehlen und alles, was nicht eingesperrt ist, auf Nimmerwiedersehen verschwinde. Die Roma gingen mit ihren Körben von Haus zu Haus und verkauften, was sie im Winter hergestellt hatten. Manchmal bezahlten die Einheimischen mit Naturalien im Tauschhandel, manchmal mit Geld. Erst am Tag nach deren Abreise durften Kinder und Tiere wieder aus dem Haus.
Meine Prägung: Roma stehlen.
40 Jahre später:
Ich bin Lehrer an einer Schule für Erwachsene. Am ersten Schultag stellen sich die Schüler vor und erzählen aus ihrem Leben. Eine Schülerin erklärt, dass sie Roma sei und seit einigen Jahren hier wohne. Bei mir läuten alle Glocken Alarm: … STEHLEN … In mir entsteht ein innerer Konflikt: Muss ich jetzt die Schüler darauf aufmerksam machen, dass Roma stehlen und sie deshalb aufpassen sollen? Mir ist bewusst, dass ich ihrem Ruf schaden würde und sie keine Chance hätte, sich zu integrieren, also bin ich still. Insgeheim weiß ich, wer verdächtigt wird, wenn in nächster Zeit etwas verschwindet. 14 Tage nach Schulbeginn kommt die Roma und erklärt mir, dass sie ihren Eltern von meinem Unterricht erzählt habe und dass diese mich kennenlernen wollen. Ihre Familie feiere am Samstag ein großes Fest, dazu würde sie mich gerne einladen. Mein Blutdruck steigt und ich spüre Angst in mir. Trotzdem kann ich die Einladung nicht abschlagen. Am Samstag, auf dem Weg zum Fest, habe ich wieder Herzrasen und denke: „Augen zu und durch.“ Beim Eingang des Festsaales stehen die Schülerin und ein paar andere Leute. Mit freundlicher Geste holt mich die Schülerin ab, stellt mich ihren Eltern und Verwandten vor und schon bin ich mitten in der Festgemeinschaft. Alle sind sehr freundlich, es wird gegessen, getanzt, gesungen, die Musik spielt in einer Fröhlichkeit, die ich so nicht kenne. Diese Stimmung geht mir durch Mark und Bein. So viel Freiheit, Fröhlichkeit und Unbeschwertheit habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erfahren. Es ist schöner als jede Erzählung von diesen rauschenden Festen. Auf dem Nachhauseweg bin ich durch und durch erfüllt von einem unbeschreiblich leichten Gefühl und ich weiß, dass Roma nicht mehr stehlen als manch andere Bürger. Sie sind gastfreundlich und freigiebig, wie ich das nicht gekannt habe. Ich bin vom ersten Moment unserer Begegnung wie einer von ihnen behandelt worden. Wenn ich heute das Wort „Roma“ höre, spüre ich als erstes die Angst und denke an Stehlen, erst im zweiten Augenblick erinnere ich mich an das rauschende Fest und die Gastfreundschaft. Ich weiß dann, dass Roma Menschen wie du und ich sind. Trotz meines eindrücklichen Erlebnisses mit den Roma ist die elterliche Erstinformation tiefer in mir verankert als meine eigene Erfahrung.
Entwicklung heißt also nicht, alles Gelernte zu vergessen; vielmehr geht es darum, die alten mit den neuen Erfahrungen zu verbinden und zu vergleichen, sie zu ergänzen, um zu einem eigenen, individuellen Denken zu gelangen. Wenn wir das nicht schaffen, bleiben wir in der anerzogenen, autoritätshörigen Normalität stecken.
Die Loslösung von der elterlichen Autorität ist also für die Persönlichkeitsbildung entscheidend. Und gleichzeitig sehen wir an der Geschichte mit der Roma-Schülerin, wie tief wir auch noch als Erwachsene im Denken in unseren Kinderschuhen stecken, wie schnell nicht bearbeitete Ängste und Affekte aus der Kindheit in uns lebendig werden und sich mit aller Macht gegen das bewusste Ich durchzusetzen versuchen.
Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass der Mensch imstande ist, vom kindlichen Denken Abstand zu nehmen. Diese Freiheit, die erst in der Pubertät erworben wird, können wir aber im Alter in der Demenz wieder verlieren.
Was dann bleibt, ist– wie es die Methode der Validation fordert – die dementierenden Menschen in ihrer Prägung und in ihrer Gewordenheit zu respektieren. Validationsanwender holen Dementierende mit Verständnis da ab, wo sie sich im Moment befinden.
1.3 Faktoren, die zu einer Mehrbelastung im Alter führen
1.3.1 Körperliche Faktoren
(wie Gehbehinderung, Inkontinenz, Schwerhörigkeit)
Körperliche Erkrankungen können Ursache oder Folge einer psychischen Störung sein. Beispielsweise kann eine Herzschwäche zu einem gestörten Hirnstoffwechsel und somit zu Verwirrtheitszuständen führen. Umgekehrt können körperliche Leiden als Folge von psychischen Störungen auftreten, von denen dann der Verlauf der psychischen Störung negativ beeinflusst wird. Es kann zum Beispiel zu körperlichen Leiden kommen, wenn durch eine depressive Verstimmung Essen und Hygiene vernachlässigt werden. Infolge von Austrocknung oder Unterzuckerung kann zu der depressiven Verstimmung zusätzlich noch ein Verwirrtheitszustand hinzukommen. (Vgl. Bellinger 2002, S. 10ff.)
1.3.2 Seelische Faktoren
(wie Einsamkeit, Trauer, Depression)
Trauer: Je älter wir werden, umso mehr Menschen sterben in unserer Umgebung. Die Überwindung der Verluste kann langwierig und einschneidend sein. Wenn der Lebenspartner stirbt, muss der Überlebende sich mit Kummer, Verzweiflung, Mutlosigkeit und vielleicht auch mit Schuldgefühlen auseinandersetzen. Die Trauerarbeit kostet viel Kraft.
Bewältigung des Älterwerdens: Wir müssen uns alle damit abfinden, dass das Leistungsvermögen im Laufe des Lebens langsam abnimmt. Manchen Menschen fällt diese Anpassung sehr schwer, sie erleben den Prozess des Alterns als Kränkung und kämpfen gegen diese Zumutung.
Verlust der Zukunftsperspektive: Viele Ältere rechnen mit ihrem baldigen Tod. Das Alter ist die Zeit, in der wir Bilanz ziehen: „Wie war mein Leben?“ Die Bilanz fällt nicht immer erfreulich aus und den alten Menschen bleibt oft keine Zeit oder keine Möglichkeit mehr, Schaden wiedergutzumachen oder Versäumtes nachzuholen. (Vgl. Bellinger 2002, S. 10ff.)
1.3.3 Gesellschaftliche Faktoren
(Ausgrenzung und Abgeschobenwerden)
Verlust der bezahlten Arbeit: Der Verlust der Arbeit und der gesellschaftlichen Rolle wird von den meisten Menschen als Statusverlust erlebt. Statt Geschäftsmänner, Lehrer oder Metzger sind sie nun Rentner, fühlen sich nicht mehr gebraucht und empfinden sich und ihr Leben als nutzlos.
Einstellung der Gesellschaft zum Alter: Auch vonseiten der Gesellschaft verlieren ältere Menschen ihren gesellschaftlichen Stellenwert. Altsein ist out. Ältere Menschen erleben sich als Belastung und nicht als Mitglieder der Gesellschaft.
Verlust von Kontakten: Die Altersgenossen im Freundes- und Familienkreis sterben allmählich, Vereinsamung und Isolation sind die Folge.
Verlust der vertrauten Umgebung: Wenn die Hilfsbedürftigkeit zunimmt, müssen viele ältere Menschen ihr vertrautes Umfeld verlassen und zu den Kindern oder in ein Heim ziehen. Das Wissen über die Kosten, die sie verursachen, erzeugt Schuld und Scham. (Vgl. Bellinger 2002, S. 10ff.)

Dynamik Verluste – Selbstwertgefühl, E. Feurstein
Wenn Verluste größer werden, nimmt das Selbstwertgefühl ab.
Pensionsvorbereitung, E. Feurstein

1.4 Selbstbestimmung im Alter
Brauchen alte Menschen ein Selbstbestimmungsrecht?
Ob ein Mensch die Selbstbestimmung benötigt oder nicht, resultiert aus seiner Lebensgeschichte. Es stellt sich die Frage: Wie hat dieser Mensch seine Selbstbestimmung bis jetzt gelebt und hat oder will er diese Art beibehalten oder will er sich im hohen Alter noch verändern?
Geschichte
Eine Mutter hat einen Sohn. Sie liebt ihn über alles und versucht ihn vor all dem Bösen auf der Welt zu schützen. So geht sie in den Kindergarten, um mit dem kleinen Jungen, der gestern ihrem Sohn den Bagger aus der Hand gerissen hat, zu schimpfen. Sie beschimpft auch die Kindergartenpädagogin und erklärt dieser, dass sie besser auf die Kinder aufpassen solle. Ähnliches macht sie später in der Schule mit den Lehrern, mit den Lehrherren ihres Sohnes und an dessen späterer Arbeitsstelle. Als der Junge eine Freundin findet, muss er sich entweder für die Mutter oder für die Freundin entscheiden, denn beide wollen ihn beschützen, aber keine will, dass die andere mitredet. Der Sohn entscheidet sich für die Freundin. Wie geht es wohl der Mutter jetzt?
Der Sohn heiratet die Freundin. Die Ehefrau macht sich zur Aufgabe, ihren Mann vor allem Bösen dieser Welt zu beschützen. Als der Mann an seinem Arbeitsplatz um eine Gehaltserhöhung fragt, die abgelehnt wird, sucht sie dessen Chef auf und erklärt ausführlich, warum ihr Mann die Gehaltserhöhung verdient …
Reflexion zur Geschichte
Was glaubst du: Wünscht dieser Mann im Alter Selbstbestimmung, wenn Mutter und Ehefrau gestorben sind?
Antwort
Trotz der eindeutigen Geschichte kann man diese Frage nicht eindeutig beantworten. Vielleicht will er jetzt Verantwortung für sich übernehmen und sein Selbstbestimmungsrecht nachholen oder er verhält sich nach seinem alten Muster und ist mit der Möglichkeit zur Selbstbestimmung überfordert.
Ein anderer Mann, der schon früh von seiner Mutter zur Selbstständigkeit erzogen wurde und auch in seiner Familie selbstverständlich alle Entscheidungen getroffen hat, erkrankt an Demenz. Was glaubst du? Will er, dass ihm eine Pflegerin ständig nachläuft und ihm sagt, was gut für ihn sei, was er zu tun habe?
Auch hier kommt es ganz darauf an, wofür er sich in seiner neuen Situation entscheidet. Vielleicht bringt er in der Demenz den Wunsch nach passivem Versorgtwerden hervor oder er möchte sich, wie gewohnt, von keinem eine Entscheidung abnehmen lassen und reagiert mit Abwehr, wenn Pflegende ihn unterstützen wollen.
2
Alzheimer-Demenz
Wo liegt der Unterschied?
Demenz lässt sich übersetzen mit der Geist geht weg oder ohne Geist, und bedeutet, dass der Mensch nicht mehr abstrakt denken kann.
Jeder von uns kennt die Redewendung „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ und weiß, was damit gemeint ist. Ein Mensch mit Demenz versteht zwar, was er hört, kann aber den Sinn dieser Aussage nicht erkennen, er kann nicht mehr abstrakt denken. Das Gehörte bedeutet für ihn: Der Apfel ist vom Baum gefallen und liegt nun neben dem Stamm.
Im weiteren Verlauf von Demenz kann er sogar sein Selbstbild verlieren. Er weiß dann nicht mehr, wer er ist, und erkennt sein eigenes Spiegelbild nicht mehr.
Alzheimer und Demenz beziehen sich aufeinander wie ein Apfel zum Obst (ein Apfel ist Obst, aber nicht alles Obst ist ein Apfel). Demenz ist der Überbegriff für verschiedene Arten von Demenz wie Alzheimer, vaskuläre Demenz, Multiinfarktdemenz, Lewy-Body-Demenz und viele mehr.

Gliederung der Demenz, selbst erstellt
2.1 Definition aus medizinischer Sicht
Unter Demenz versteht man eine erworbene Hirnleistungsschwäche. Es kommt zu fortschreitenden Ausfällen von
Gedächtnis und Merkfähigkeit,
Orientierung und
Kritik- und Urteilsfähigkeit.
Dabei verändert sich auch die Persönlichkeit und das führt zu Störungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass eine Demenz immer auch als Erkrankung der Angehörigen zu sehen ist.
Nach längerem Krankheitsverlauf
zerfallen praktische Fähigkeiten wie Ankleiden, Gehen, Essen, Lesen, Sprechen,
kommt es zum Verlust der Autonomie,
folgt eine völlige Abhängigkeit von Betreuungs- und Pflegepersonen,
tritt der Tod ein.
Im letzten Stadium der Erkrankung
liegt der Patient reglos im Bett,
ist er unfähig zu verbalen Äußerungen,
ist er inkontinent,
ist er völlig auf fremde Hilfe angewiesen.
Der Verlauf einer Demenz ist
chronisch fortschreitend,
kann durch medizinische Maßnahmen nicht rückgängig gemacht werden
und endet meist innerhalb von fünf bis zehn Jahren tödlich.
Todesursachen sind häufig Pneumonien (Lungenentzündungen) nach Aspiration (Verschlucken) und Kachexie (Abmagerung, Auszehrung) bei Nahrungs- und Flüssigkeitsverweigerung oder Herz-Kreislaufversagen.
Die Betreuung Dementierender ist aufgrund der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oft sehr nervenaufreibend und schwierig. Das Fortschreiten ist trotz intensiver pflegerischer und therapeutischer Bemühungen seelisch sehr belastend und führt gerade bei pflegenden Angehörigen nicht selten zur Dekompensation. (Vgl. Bellinger 2002, S. 54ff.)
Während der Körper im Laufe des Lebens mehr oder weniger abgenutzt, sklerotisch und gebrechlich wird und der Geist langsam schwindet, bleibt die Seele, die Kindheitspsyche, in der Demenz erhalten. So knüpfen wir in der Validation an die unversehrt gebliebenen seelischen Kräfte an und kümmern uns darum, möglichst lange mit ihnen in Beziehung – in Verbindung – zu bleiben.

Körper, Geist und Seele, E. Feurstein
2.2 Vier Dimensionen der Desorientierung
2.2.1 Räumliche Desorientierung
Der Dementierende
kann seinen Geburtsort nicht benennen,
kann keine zutreffenden Aussagen über seinen derzeitigen Aufenthaltsort oder Wohnort machen,
kann die Postanschrift seiner Wohnung nicht nennen,
weiß nicht, wo sich seine Arbeitsstelle befindet,
kann auch keine Wegbeschreibungen zu ihm bekannten Orten angeben,
nimmt seine Umgebung als fremd wahr,
findet Gegenstände nicht, versteckt sie, fühlt sich bestohlen (glaubt, man stehle ihm das Denken),
verfehlt angegebene Richtungen und verläuft sich,
fragt ständig, wo er sich und wo sich etwas befindet,
zeigt sich verängstigt, irrt herum, sucht etwas ihm Vertrautes oder sitzt ruhig da, um sich nicht zu verirren. (Vgl. Pflegewiki, Orientierung 2012)
2.2.2 Zeitliche Desorientierung
Der Dementierende
kann keine Angaben über die aktuelle Tageszeit, den bestehenden Tagesabschnitt oder das aktuelle Datum machen,
kann nicht bestimmen, wie lange er sich in einer Situation oder an einem Ort befindet,
kann keine Aussagen über den Verlauf und die Dauer von Ereignissen treffen,
kann den derzeitigen Monat oder die jeweilige Jahreszeit nicht bestimmen,
weiß über bevorstehende Ereignisse und ihre Bedeutung nicht Bescheid,
verwechselt Daten und Termine,
zeigt sich verunsichert,
zeigt einen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus
und verwechselt lebende und verstorbene Personen. (Vgl. Pflegewiki, Orientierung 2012)
Ständig wiederkehrende Rituale geben Sicherheit:Alltagskleidung, SonntagskleidungFeiertage, TrauertageWechsel der Jahreszeiten oder wiederkehrende Ereignisse im Jahresablauf dekorieren (Advent, Ostern und Ähnliches)Essrituale (freitags fleischlos, Sonntagsfrühstück)Morgen- oder Abendgebete usw. (Vgl. Scharb 1996)
2.2.3 Personelle Desorientierung
Der Dementierende
kann seinen Familiennamen, Vor- und/oder Geburtsnamen nicht benennen,
weiß seinen Familienstand nicht,
weiß sein Geburtsdatum und/oder sein Alter nicht,
kann keine Auskunft über seinen erlernten Beruf geben,
kann keine Angaben darüber geben, ob und wie viele Personen im Haushalt leben,
weiß nicht, ob und wie viele eigene Kinder existieren,
zeigt sich verstört und sucht das Gefühl der Mutter (Liebe).
Die Logik unserer Denk- und Wahrnehmungsmuster ist in der Demenz ähnlich der eines Kindes. Beispielsweise suchen Dementierende die Mutter, wenn sie sich nicht geliebt und geborgen fühlen, obwohl diese schon vor langer Zeit gestorben ist. In diesem Fall ist es die Sehnsucht nach der Mutter, die die zeitlich verschobene Wahrnehmung bestimmt. Wenn sie sich durch Menschen in ihrer Umgebung überfordert fühlen, kann es passieren, dass sie selbst mit ihren nahen Angehörigen in einem sehr unpersönlichen Ton sprechen: „Was machen Sie in meinem Zimmer? Verlassen Sie sofort diesen Raum!“ Hilfreich für diese Menschen ist der Aufbau einer vertrauensvollen, fürsorglichen Interaktion. (Vgl. Scharb 1996)
2.2.4 Situative Desorientierung
Der Dementierende
kann Gründe für derzeitigen Aufenthalt oder für die gegenwärtige Situation nicht benennen,
kann keine Auskunft über die Art und Weise seiner Her- und Ankunft geben,
kann Eigenschaften von Dingen nicht beschreiben,
kann Funktionen und Positionen von Menschen nicht zuordnen,
kann Gebrauchsgegenstände nicht bestimmen und unterscheiden
oder zeigt sich ratlos.
Die Dementierenden erleben ihre Situation, sind aber nicht fähig, ihre Lage zu begreifen, was wiederum als stark existenzbedrohend erlebt wird.
Länger dauernde zeitliche Orientierungslosigkeit führt zum Verlust der ICH-Identität. (Vgl. Scharb 1996)
2.3 Demenz-Merksätze
„Demenz – Für viele ist es das schlimmstmögliche Ende: das Leben zu verlieren, lange vor dem Tod. … Vom Menschen bleibt nur mehr eine Hülle, der man den Tod wünscht, um dem langsam schleichenden Sterben ein Ende zu geben.“
„Kaum ein Schicksal wird so gefürchtet wie jahrelang im Siechtum der demenziellen Veränderung in einem Pflegeheimbett zu liegen.“
„Lieber lahm, blind oder besser gleich tot – nur kein Versinken im ewigen Vergessen.“
„So werden demenziell veränderte Menschen als dumpf dahindämmernde Hülle beschrieben. Das Leben wird ihnen abgesprochen und man redet vom lebenden Toten.“
„Die Medien erzeugen Angst und Abwehr, wenn sie die Demenz als bösartige Krankheit beschreiben, die den Menschen als Person auslöscht. Diese Meinung entsolidarisiert und grenzt demenziell veränderte Menschen aus und lässt die Frage zu, ob dieses vegetierende, menschenunwürdige Leben erhaltenswert sei.“ (Wißmann/Gronemeyer 2008, S. 20ff.)2
Was weiß die Medizin über Demenz?
„Es sind keine eindeutigen Ursachen oder Entstehungsgeschichten der Demenz bekannt.“
„Wo keine gesicherten Kenntnisse zu Ursachen und Entstehung vorliegen, kann es auch keine kausale Therapie und Heilung geben.“
„Der einzige gesicherte Risikofaktor ist das Alter.“
Wobei die Menschen mit der Diagnose „Demenz“ immer jünger werden
„Medikamentöse Behandlung der demenziellen Veränderung wird immer mehr in Frage gestellt.“
„In jüngster Zeit wurden vermehrt wissenschaftliche Untersuchungen und Positionen veröffentlicht, in denen die Wirksamkeit der Medikamente in Zweifel gezogen und auf die mangelhafte Qualität bisheriger Studien verwiesen wird.“
„Meist werden Medikamente zur Therapie von psychischen Begleiterscheinungen der Demenz verschrieben (Neuroleptika, Antidepressiva, Hypnotika und Tranquilizer). Diese Medikamente sind nicht demenzspezifisch, sondern wirken gegen die Verhaltensweisen, die von der Umwelt als störend und gefährdend eingeschätzt werden. Die Haupt- und die Nebenwirkungen können gravierend sein, deshalb muss sorgfältig damit umgegangen werden.“ (Wißmann/Gronemeyer 2008, S. 24ff.)2
2.3.1 Ist Demenz eine Krankheit?
Udo Baer sieht die Demenz als einen Erlebensprozess an: Auch in der Neurowissenschaft werde der Blick von der Denkstörung immer mehr auf die sozialen, emotionalen und anderen Aspekte des Erlebens und Verhaltens erweitert. (Vgl. Baer 2007, S. 33) Für Naomi Feil ist der Rückzug hochbetagter Menschen in ihre Vergangenheit keine Geisteskrankheit und kein Gebrechen, sondern eine Form des Überlebens. (Vgl. Naomi Feil, 1990, zitiert nach Scharb 1999, S. 1)
2.3.2 Ist Alzheimer ein normaler Alterungsprozess?
In der Literatur wie in Berichten und Geschichten tauchen immer wieder senile und sinnesgeschwächte Greise auf, deren Verhalten niemand mit einer Krankheit identifiziert hat. (Vgl. Wißmann/Gronemeyer 2008, S. 35)
Die Choctaw-Indianer begegnen Menschen, die ihr Verhalten im Alter verändern, mit mystischer Ehrfurcht. (Vgl. Wißmann/Gronemeyer 2008, S. 37)
Auch Amerikaner asiatischer oder pazifischer Abstammung sehen Demenz als nicht behandelbaren, natürlichen Alterungsprozess und afroamerikanische Pflegende weisen im Vergleich mit einer weißen Untersuchungsgruppe ein geringeres Belastungserleben auf.
Dem herausfordernden Verhalten von dementierenden Menschen wird in Entwicklungsländern eine sehr hohe Toleranz entgegengebracht. (Vgl. Wißmann/Gronemeyer 2008, S. 37f.)
Verschiedene alte Kulturen ehren demenziell veränderte Menschen. Die Inuit glauben, dass bei Menschen mit Demenz der Geist den Körper verlasse, in eine heilige Sphäre eintrete und neu wirke.
Es stellt sich die Frage, was ein Phänomen wie die Demenz einer Gesellschaft wie der unsrigen zu sagen hat und wie wir den Umgang mit dieser Bevölkerungsgruppe würdig gestalten können. (Vgl. Wißmann/Gronemeyer 2008, S. 22)
Vielleicht müssen wir trotz des enormen wissenschaftlich-technischen Fortschritts anerkennen, niemals vollständig über das Leben verfügen zu können. Diese Situation anzunehmen, statt die unter Demenz leidenden Personen auszugrenzen oder ihre Existenz zu verleugnen, könnte eine tragfähige Grundlage für einen würdigen Umgang mit Menschen, die die Fähigkeit und den Wunsch, Selbstverantwortung zu übernehmen, verloren haben, sein.
„Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind
sondern so wie wir sind.“
Anais Nin3
2.3.3 Ein Gedanke zur Vorsorge

Ein Gedanke zur Vorsorge
Das Yin-Yang-Symbol zeigt die Ausgeglichenheit der Plus- und Minussymptomatik, nach der wir streben.
Yin Yang-Zeichen E. Feurstein

In Wirklichkeit leben wir in einer Unausgeglichenheit der Minussymptomatik. Aus Zeitungen sowie aus dem Radio, Fernsehen und Internet erfahren wir viele Negativnachrichten.
Yin Yang-Zeichen E. Feurstein

Mit den positiven Lebensaspekten beschäftigt sich nur der, der sie direkt sucht.
„Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist;
weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich,
was aus dir werden kann.“
Johann Wolfgang von Goethe4
Die angeführte Plussymptomatik dementierender Menschen entspricht in den letzten Jahren immer mehr den Sehnsüchten stressgeplagter Menschen. Und trotzdem versuchen wir, diese Menschen mit verschiedenen Betreuungsmethoden auf unser Denkniveau zurückzuholen. Sind Dementierende unsere Lehrmeister, die wir nicht als solche erkennen?
Geschichte
Der Affe und der Fisch – eine Rettung in letzter Sekunde
Pflegepersonen verhalten sich manchmal wie dieser Affe, der auf dem Baum sitzt. Er sieht einen Fisch im Wasser schwimmen und denkt: „Hilfe, er ertrinkt, wenn ich ihn da nicht heraushole.“
Der Affe und der Fisch 1, E. Feurstein

So hüpft er vom Baum, springt ins Wasser und rettet den armen Fisch vor dem Ertrinken.

Der Affe und der Fisch 2, E. Feurstein