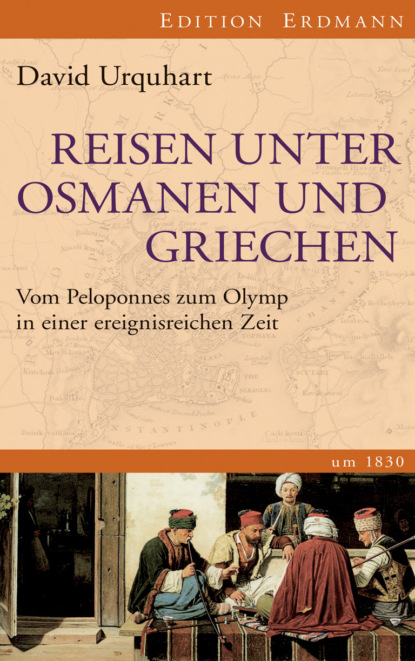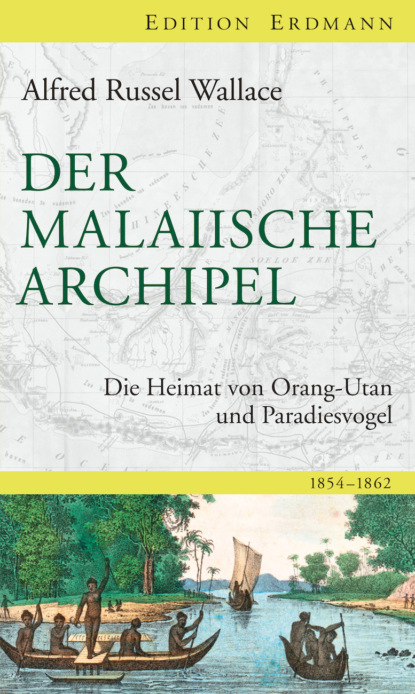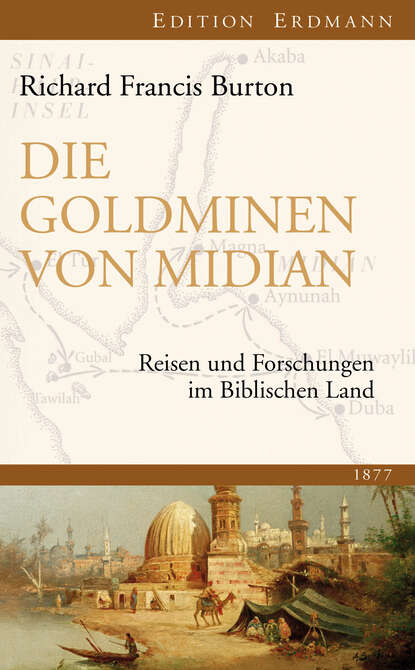Om mani padme hum

- -
- 100%
- +
Meine nächsten Besuche gelten dem italienischen Postmeister Cavalieri und Herrn Feldmann, dem Direktor der Russisch-Asiatischen Bank. Direktor Feldmann hatte Besuch aus Kaschgar. Es handelte sich um die Familie Roerich, Vater, Mutter und Sohn. Sie wollten ursprünglich nach Kansu weiterreisen. Der Generalgouverneur verweigerte ihnen jedoch den Pass. Sie sollten nun nach Tschugutschak in der Sowjetunion abgeschoben werden. Roerich, ein bedeutender Bildhauer, war russischer Staatsangehöriger, wanderte mit seiner Familie dann aber nach Amerika aus und lebte zuletzt in Paris. Er erzählte uns, dass ihm die Vereinigten Staaten eine Million Dollar zu einer Kunstreise in Asien angewiesen hätten.
Tags darauf besuche ich den Generalkonsul der Sowjetunion. Er steht im besten Mannesalter und kommt aus alter Schule. Dieser allgemein beliebte und angesehene Mann erbot sich, meine astronomisch-magnetischen Messungen mit Kurier über Moskau nach dem Zentralobservatorium Leningrad zu senden. Leider sind auf diesem Weg die Messungen von zwölf Stationen verlorengegangen. Es darf im Interesse der Wissenschaft erwartet werden, dass alles geschieht, um das Fehlende wieder herbeizuschaffen.
Auch den beiden ansässigen Ärzten, Pedaschenko und Dr. Eichtmeyer, die als russische Emigranten hier leben, stellte ich mich vor. Sie dürfen als die »Elite« der Emigranten bezeichnet werden. Die übrigen Herrschaften dieser Gattung, mit wenigen Ausnahmen, kommen als Umgang nicht in Betracht. Der Chinese begegnet ihnen mit Verachtung. Er sieht in ihnen arbeitsscheue und lästige Bittsteller, die er sich gern vom Halse hält und denen er alles zu bieten wagt. Damit ist aber zugleich seine einstige Achtung vor den Vertretern der westeuropäischen Kultur gesunken. In seiner Verallgemeinerung macht er nun überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen »Europäern« und »Emigranten«. Alle Weißen wirft er in einen Topf. Natürlich leidet jeder Fremde unter dieser Einstellung, in erster Linie aber der europäische Forscher, auf den die Missachtung übertragen wird.
Der Generalgouverneur lässt mich um Darlegung meines Expeditionsprogramms bitten, das ich ihm sogleich übersende.
Die Luft am Hof des gestrengen Herrn wird sehr dick. Ein verdächtiges Mitglied der Emigrantenschar, der Lehrer des Gouverneurssohnes, intrigiert heimlich gegen mich. Sein Hass ist nicht persönlich. Er steht bei der katholischen Mission in üblem Ruf. Da ich nun von dieser Seite alle nur denkbare Förderung erfahre, sucht er mich zu verdächtigen und meine Kreise zu stören. Seine Einflüsterungen fallen auf guten Boden; denn bald erfahre ich, dass man mich als »lästigen Ausländer« nach Sowjetrussland abschieben will. Diesen Schlag pariere ich sofort und bleibe schließlich Sieger.
Am 13. Mai bin ich Gast im Palast des Generalgouverneurs. Der Empfang ist formvollendet. Der Posten tritt ins Gewehr. Man gibt mir den Ehrenplatz an der Tafel. Das Diner ist ausgezeichnet. Der Schampus fließt in Strömen. Auch hier im Herzen Asiens versteht man zu leben. Trotz alles äußeren Gepränges bleibt die Haltung des Gastgebers mir gegenüber kühl und gemessen. Das macht keinen tieferen Eindruck auf mich. Ich kenne die Söhne des Reiches der Mitte zu genau. Im Verkehr mit ihnen muss man die Zeit arbeiten lassen. Das asiatische »Schnell, aber langsam!« habe ich nun zur Genüge erprobt. Je mehr Misstrauen mir entgegenweht, umso liebenswürdiger, höflicher und – harmloser gebe ich mich.
Am Tag nach dem Fest führe ich in der Nähe der Telefunkenstation meine Messungen aus. Ein kleines Intermezzo: Die Pferde eines offenen Personenwagens scheuen. Der Wagen kippt um. Ein älterer Chinese und ein achtjähriges Mädchen kommen zu Fall. Die Kleine verwundet sich bei dem Sturz am Fuß. Mit Pater Veldman zusammen bringen wir sie zur katholischen Mission, und dort verbinde ich sie. Nun stellt sich heraus, dass die Kleine eine Nichte des Generalgouverneurs ist. Ihr Vater, der bei dem Unfall heil davonkam, ist dessen Bruder und der Leiter der fünf Kilometer entfernten Munitionsfabrik, die vor langen Jahren von Deutschen eingerichtet worden ist. Das Mädchen besuchte mich nun fast täglich. Dieser Zwischenfall brachte mir insofern einen wesentlichen Vorteil, als sich die ganze Familie der Kleinen in ihrer Dankbarkeit für meine Hilfsbereitschaft nicht genug tun konnte. Durch diese zufälligen Beziehungen gestaltete sich mein Verhältnis zum Generalgouverneur allmählich angenehmer.
Am Nachmittag besah ich mir einen chinesischen Tempel, der mehrere große, reich bemalte Höfe hatte. In dem einen der Höfe waren zwei Räume eingebaut mit vielen Figuren, Symbolen der Höllenstrafen. Die »Plastiken« waren aus bemaltem Lehm geformt. Auch leere und besetzte Särge standen in großer Zahl umher.
Am folgenden Tag besuchte ich den Engländer Mr. Hunter, den Leiter der China-Inland-Mission. Schon vor 22 Jahren hatte ich ihn in Sining-fu im Hause meines opferfreudigen englischen Freundes, des Herrn Ridley, kennengelernt. Hunter ist ein ausgezeichneter Kenner des Islams. Er warnte mich, auf meiner Weiterreise Kansu zu berühren.
In Tihwa ist neben anderen auch ein Deutscher ansässig. Er heißt Zug und betreibt eine Darmschlemmerei. Bereits seit zehn Jahren lebt er in China und ist ein hervorragender Vertreter des Deutschtums in Asien. Neben seinem Handwerk versteht er die Chinesen richtig und mit Takt zu behandeln, was leider nicht von allen Landsleuten behauptet werden kann, die einem auf fremder Erde begegnen.
Auch in Asien wohnt das Glück. So habe ich heute meine Taschenuhr, die ich gestern verlor, wiedergefunden!
Die nächsten Tage sind ausschließlich magnetischen Messungen gewidmet. Der Geheimpolizist Joseph bringt mir eine unerfreuliche Neuigkeit. Der Generalgouverneur hat mein Gesuch um Weiterreise kategorisch abgelehnt. Am Nachmittag bestätigt sich die Hiobspost. Fan Dao-tai erscheint persönlich. Er begründet die Ablehnung des Gouverneurs mit dem unsicheren Zustand im Osten und fügt liebenswürdig hinzu, man wolle mich vor allen Dingen vor Gefahren schützen. In dieser kritischen Stunde erwächst mir im italienischen Postmeister Cavalieri ein warmherziger Fürsprecher, der persönlich beim Generalgouverneur für mich wirkt.
Am 22. Mai laufen tatsächlich bedenkliche Nachrichten von Raubüberfällen auf der Strecke Dschin-huo–Sairam-nor–Tihwa ein. Eine von 18 Moslems geführte Warenkarawane ist überfallen worden. Die Räuberbande, etwa 25 Kirgisen, war ausgezeichnet bewaffnet, begnügte sich aber mit dem Diebstahl sämtlicher Pferde. Die Waren blieben unberührt. Cavalieri setzt seine diplomatischen Bemühungen in meinem Interesse fort. Er entwirft zwei Briefe, einen an den Generalgouverneur, einen zweiten an Fan Dao-tai.
Gleichzeitig bringe ich nachstehende Depesche an die Deutsche Gesandtschaft in Peking zur Absendung:
»Weiterreise Kansu möglich, wenn das Zentralgouvernement der Chinesischen Republik amtliche Versicherung erhält, dass meine Expedition wissenschaftliche und keine anderen Ziele verfolgt. Eure Exzellenz bitte ich ehrerbietigst und herzlich, mir und der Wissenschaft diese Hilfe zu gewahren. Filchner, Katholische Mission.«
Am 23. Mai teilt mir der Geheimpolizist Joseph mit, dass die Erlaubnis zur Weiterreise nicht mehr lange ausbleiben werde. Am 26. Mai konferiert Cavalieri stundenlang mit Fan Dao-tai. Drei Tage nachher bestürmt er Fan Dao-tai und Joseph wiederum eindringlich, um meiner Sache zu dienen. Dann stellt er an mich die Schicksalsfrage: »Was gedenken Sie zu tun, wenn man Sie über Tschugutschak abschieben will?« Ich erwidere: »Ich würde mit der sibirischen Bahn nach Peking reisen und von dort über Schanghai nach Lantschou fahren.« Mit dieser Antwort wollte ich dem Generalgouverneur die Sinne schärfen. Ich wusste genau, dass es ihm gegen den Strich ging, wenn ich von hier auf dem nächsten Wege nach Lantschou reiste, weil er befürchtete, ich würde von dort nach Peking weiterfahren. Er will mir nämlich noch immer nicht glauben, dass ich von Lantschou aus die Route westwärts nehmen will, nach Kaschgar oder Kaschmir.
Am 30. Mai scheint es im Palast des Generalgouverneurs sehr stürmisch hergegangen zu sein. Die höheren Beamten sind über die Willkür des Machthabers empört und billigen seine Maßnahmen nicht. Selbst dem Dao-tai, der einen Pass nach dem Osten verlangt, wird sein Gesuch vom Generalgouverneur abgeschlagen. Überall herrscht Auflehnung gegen seine Tyrannei. Man munkelt von seinem baldigen Sturz. Auch im Volk gärt es.
Joseph sucht meinen Unmut zu dämpfen. Er versichert, dass nicht das Geringste gegen mich vorliege. »Im Gegenteil«, sagte er, »man schätzt Sie und hält Sie für einen ehrlichen Mann, der mit den Chinesen sehr gut fertig wird. Der Dao-tai und alle Minister stehen auf Ihrer Seite.«
Josephs wohlgemeinten Rat, sofort funktelegraphisch in Kaschgar beim englischen Konsul anzufragen, ob er mich unter seinen Schutz nehmen wolle, lehnte ich ab, mit dem Hinweis, dass ein deutscher Konsul in Tientsin existiere. Der Trost war schwach, aber schließlich hätte ich die Heimatbehörde doch nicht schneiden können!
Es wird endlich vereinbart, dass Pater Veldman und der hilfreiche Cavalieri anderentags mit dem Dao-tai konferieren. Man weiß genau, dass ich politisch durchaus unverdächtig bin. Der Dao-tai will meinetwegen beim Generalgouverneur sogar schweres Geschütz auffahren. Mitten in all den unerquicklichen Verhandlungen erreicht mich die erfreuliche Nachricht, dass von der Filmfabrik Wolfen am 8. Mai weitere 10 000 Meter Film nach Tientsin auf den Weg gebracht wurden.
31. Mai. Zweistündige Konferenz beim Dao-tai. Er übt scharfe Kritik am Generalgouverneur und deutet bekräftigend mit dem Finger nach der Stirn. Schließlich schlägt er vor, mit ihm gemeinsam sofort zum Generalgouverneur zu gehen und diesem noch einmal die Versicherung zu geben, dass Peking für mich überhaupt nicht in Betracht komme, sondern nur ein Westmarsch von Lantschou aus. Der Dao-tai ist empört und sagt wörtlich: »Es ist ungeheuerlich, Sie, den Gelehrten, nicht ziehen lassen zu wollen!«
Um ein Uhr Audienz beim Gouverneur in Gegenwart des Dao-tai. Einstündige Unterredung. Der Gouverneur operiert mit seiner Nachricht aus Kansu. Dort seien schwere Unruhen ausgebrochen. Er wolle mich nicht in Gefahr bringen! Pater Veldman behauptet das Gegenteil und versichert, er habe Berichte von seinen Missionsbrüdern aus Kansu, dass es dort ganz ruhig sei. Außerdem fügt er hinzu, wolle ich ja überhaupt nicht nach Lantschou, sondern nach Sining-fu. Der Generalgouverneur bittet mich nach langen, fruchtlosen Debatten, mich noch etwas zu gedulden. Das Eis scheint langsam zu brechen! Geduld ist aller Schmerzen Arznei!
1. Juni. Telegraphische Anfrage in Kuldscha und Taschkent nach dem Verbleib des mir von Potsdam nachgesandten Instruments.
Soeben erscheinen zwei chinesische Kriminalbeamte, um vier Photographien von mir für den chinesischen Pass zu erbitten. Gute Auspizien. Gleichzeitig erbittet der Direktor der Munitionsfabrik, der Bruder des Gewaltigen, meinen Besuch. Ich lehne ab, um beim Generalgouverneur kein neues Misstrauen zu erregen. Der Direktor der Munitionsfabrik antwortet: »Ich bürge bei meinem Bruder für Sie.« Seine kleine kranke Tochter kann in ihrer Dankbarkeit gegen mich nicht genug tun. Dudewin feiert den 30. Geburtstag seines ältesten Sohnes. Da er ihn gern als Konsul nach der Sowjetunion schicken möchte, ist das Generalkonsulat der Sowjetunion zu einer Feier eingeladen.
2. Juni. Vormittags starke Leibschmerzen: die ersten Anzeichen eines beginnenden Gallensteinleidens. Aus Manaß treffen von Pater Hilbrenner 2000 Lan ein. Endlich habe ich wieder Geld. Ohne die Steyler Mission hätte ich schon in Tihwa die Zelte abbrechen müssen. Ich bitte um Hilbrenners Besuch in Tihwa. Vielleicht gelingt es seiner Verhandlungskunst, den Generalgouverneur zu bestimmen, mir die Pässe für die Weiterreise auszuhändigen. Dieser treue Mann kommt sofort. Am ersten Tag legt er 120 Kilometer zu Pferde zurück. Bald nach seiner Ankunft, am 5. Juni, wird er mit mir vom Dao-tai empfangen. Da höre ich zu meinem nicht geringen Erstaunen, dass man mich anklagt:
1. die Grenze Chinas ohne chinesischen Reisepass überschritten zu haben;
2. in China Messungen ohne Erlaubnis ausgeführt zu haben, da weder mein deutscher Pass noch das Empfehlungsschreiben des Generalkonsuls von Tientsin solche Arbeiten erwähnt,
3. außerdem fehle meinem chinesischen Reisepass das Visum des Chinesischen Auswärtigen Amtes in Peking,
4. sei weder die chinesische Grenzstelle in Chorgos noch Tihwa von meiner Ankunft benachrichtigt worden.
Ich antworte: »Aufgrund dieser Vorgänge hätte mich ja der Generalgouverneur glatt einsperren können!«
Der Dao-tai nickt vielsagend.
Dann fahre ich fort: »Es ist also ein besonders großes Entgegenkommen des Generalgouverneurs, wenn er mich trotz dieser Verstöße, die man mir zur Last legt, so wohlwollend behandelt und aufgenommen hat!«
Der Dao-tai stimmt zu. Ich schließe: »Unter diesen Verhältnissen bin ich dem Gouverneur für seine mir bisher erwiesene Güte doppelt dankbar.«
Der Dao-tai meint dann, ich möge mich nur noch einige Tage gedulden; er werde noch einmal persönlich für mich eintreten und hoffe, mir bald das Jawort zu bringen.
Einige Stunden später schickt mir der Dao-tai seine Photographie mit einer freundlichen Widmung. Ich danke und beteuere außerdem, dass ich für alles, was mir zustoßen könne, auf jeden Schadenersatz von chinesischer Seite verzichte und dass ich selbst jede Verantwortung trage.
Schließlich benachrichtige ich den Dao-tai, dass ich ihn, den Generalgouverneur und alle seine Minister demnächst bei mir zu einem Festessen zu begrüßen hoffe. Das ist der einzige Weg, um rasch zum Ziel zu kommen.
Am Abend des 5. Juni erwachte ich mit wahnsinnigen Leibschmerzen. Ich konnte nicht mehr liegen, so hatte ich zu leiden. Beick und die Missionare kamen augenblicklich. Man legte mir heiße Kompressen auf den Leib. Bald stellte sich schweres Erbrechen ein. Wie ich später erfahren sollte, war das der erste Gallensteinanfall!
Am 6. Juni kommt Joseph mit der Freudenbotschaft, dass der Pass in ein paar Tagen da sein werde! – Vielleicht, vielleicht auch nicht! Ärztekonferenz wegen meines Leidens. Die Diagnose schwankt zwischen Gallensteinkolik und Leberkrankheit.
Vormittags mache ich trotz meiner Anfälligkeit mit Pater Hilbrenner Besuche bei folgenden Ministern: Ji-tschin-tschang, dem Chef des Geheimen Kabinetts des Generalgouverneurs, Siü-tschin- tschang, dem Finanzminister, Liu-tschin-tschang, dem Kultusminister, Jen-tschin-tschang, dem Ackerbauminister, und Wu-tschin-tschang, dem Telegraphendirektor.
Mein Freund Cavalieri benachrichtigt mich, dass der Generalgouverneur mir die Erlaubnis verweigert, die Zeitsignale von Peschauer aufzunehmen. Niemand hat Zutritt zu dem Empfangsraum. Der Tyrann trägt den Schlüssel in seiner Tasche!
In der Missionsstation gibt es eine Abwechslung mit humoristischem Einschlag. Pater Veldman wird von Zahnweh geplagt; eine goldene Zahnbrücke ist gebrochen. Während der Nacht spielt der Missionshund mit dem künstlichen Gebiss seines Herrn und bricht noch einige Zähne aus!
Trost im Leid: Meine Passangelegenheit soll günstig stehen!
Ich verfüge jetzt ungefähr über 1000 Lan zur Reise nach Kansu. Meine bisherigen Auslagen von 600 Lan wollen mir die beiden gütigen Missionare Hilbrenner und Veldman stunden. Sie erklären sich sogar bereit, mir weitere Geldmittel vorzuschießen.
Der Geheimpolizist Joseph verriet mir des Gouverneurs Besorgnisse. Der Allmächtige glaubt nämlich, so orakelte Joseph, dass Deutschland und die Sowjetunion gemeinsame Sache machen. Da nun Sinkiang zwischen dem Gebiet der Sowjetunion und dem bolschewistisch eingestellten Kansu liege, sei es nicht unwahrscheinlich, dass Deutschland in Sinkiang in bolschewistenfreundlichem Sinne wirken wolle! – Ich war also nach der allerhöchsten Ansicht der Hund im Kegelschub!
Am 10. Juni gab ich Auftrag nach Tientsin, die fünf Kisten der für mich aus Deutschland eintreffenden Negativfilme ungeöffnet an die katholische Mission in Yen-tschou-fu in Schantung zu senden mit der Bitte, diese bei nächster Gelegenheit unter sicherem Geleit an die katholische Mission in Lantschou weiterzugeben.
Es war ein Kommen und Gehen in meinem Quartier. So erschien u.a. ein Geheimpolizist, der Angaben über die Anzahl meiner Wagen, Pferde, Apparate, Gepäckstücke und Waffen erbat. Sie müssten in meinem Pass aufgeführt werden, den ich ganz sicher am nächsten Tag erhalten würde.
12. Juni. Das Orakel versagte auch diesmal.
13. Juni. Zu meinem Schrecken erfahre ich nun, dass der Generalgouverneur den Pass wiederum abgelehnt hat. Ich schreibe sogleich drei Briefe: einen an das Auswärtige Amt in Berlin, den zweiten an den Deutschen Generalkonsul in Tientsin und den dritten an meinen Generalbevollmächtigten in Berlin.
Die neuerliche Passverweigerung soll, wie man mir sagt, darauf zurückzuführen sein, dass tags zuvor ein deutsches Unternehmen ohne ausdrückliche Genehmigung des Generalgouverneurs in Sowjethände übergegangen sei. Mit dieser Transaktion bringt man mich in Verbindung. Ich führe den Nachweis, dass ich diesen Dingen durchaus fernstehe!
Vorläufig lässt mir der Gouverneur die wenig erbauliche Mitteilung machen, dass ich auf acht bis zehn Tage ruhig verreisen könne. Dann sei es ja noch immer früh genug, in meiner Passangelegenheit weitere Schritte zu unternehmen. Das waren also wieder recht nette Aussichten!
Meine Geduld war nun wirklich zu Ende. Ich musste jetzt taktisch vorgehen. Statt einer Antwort lud ich die hohen Herren zu einem festlichen Diner ein. Sämtliche Minister sagten zu, auch der Höchstgebietende. Dieser entstieg im Gehrock unter starker militärischer Eskorte einer eleganten europäischen Kutsche. Die Minister erschienen sämtlich im Festgewand. So waren wir zu achtzehn Personen. Es wurden sehr freundliche Reden gehalten, und während des Diners überreichte mir der Außenminister feierlich den langersehnten Pass. Das war mein Lohn für alle Geduld und alle Kämpfe.
Nun ging alles wie am Schnürchen. Die nächsten Tage waren den Vorbereitungen zur Weiterreise gewidmet. Ich machte beim Generalgouverneur sowie bei allen Ministern einen Abschiedsbesuch und wurde schließlich noch zu einem äußerst prunkvollen und luxuriösen Festmahl im Sommerpalast des Generalgouverneurs eingeladen. Diesem Diner wohnten sämtliche Abgeordnete bei, insgesamt wohl 100 Gäste.
Der Generalgouverneur wollte mir absichtlich vor allem Volk ein ganz »großes Gesicht« geben.
Als ich dann mit meinen beiden Wagen Tihwa, das mich fast sechs Wochen in seinen Mauern festgehalten hatte, entrann, gab mir der Außenminister sogar persönlich das Geleit, und allerseits wurden mir Ehrerbietung und Achtung entgegengebracht.
4 Dieser war ein Bruder des mohammedanischen Generals Ma in Sining, des chinesischen Amban von Tibet. Der Generalgouverneur von Sinkiang hatte stets Angst vor diesem General, und deshalb frohlockte er, als bald darauf die Tibeter den General Ma und dessen Truppen in die Flucht geschlagen hatten. Später ist es Ma übrigens gelungen, die Tibeter entscheidend aufs Haupt zu schlagen, und erst vor Kurzem stand er auf dem Gipfel seiner Macht.
6.
ZWISCHEN FEINDLICHEN BRÜDERN
Bis Ku-tschöng (Gu-tschen) ging die Fahrt flott, weil die Pferde durch die mehrwöchige Rast in Tihwa gekräftigt waren.
Das schwerste Stück der ganzen Reise stand uns nunmehr bevor: die Durchquerung der gefürchteten Gobi mit ihren zwei Millionen Quadratkilometern. Die armen Pferde! Was haben sie aushalten müssen, im tiefen Sand und in den felsigen Pässen des Bogdo-ola-Gebirges!
Aber die Tiere haben durchgehalten, vielleicht nur deshalb, weil wir sie immer gut behandelten, im Gegensatz zu den Eingeborenen, die mit diesem lebendigen und gerade hier besonders lebenswichtigen Material nicht umzugehen wissen. Wie dankbar blickten mich die Tiere an, wenn sie nach heißem, anstrengendem Marsch todmüde und durstgequält von mir gestreichelt wurden oder ich ihnen unter aufmunternden Worten die lästigen Mücken verscheuchte.
Unser erstes Ziel war Hami, eine wundervolle, weit ausgedehnte Gartenstadt, eine blühende Oase inmitten der Wüste. Herrliche Parks dehnen sich zwischen den aus Lehm und Erde gebauten kleinen Häusern der Muselmänner. Hunderte von Kamelen ziehen langsam durch die breiten Straßen. Täglich erreichen und verlassen Hunderte von Reisenden diese Stadt an der wichtigsten Karawanenstraße Innerasiens.
Noch ehe wir Hami erreichten, machten wir in einem kleinen Wüstendorf Rast. Hier passierte mir etwas ganz Seltsames. Wie aus dem Erdboden gewachsen, stand plötzlich ein Herr in europäischer Kleidung mit Tropenhelm vor mir und rief mich an:
»Are you Mr. Filchner?«
Dieser Mann mit schneeweißem Haar, kurzgestutztem Schnurrbart und scharfen Zügen, dessen Stimme ich nur zu gut kannte, war kein Fremder. Doch im ersten Augenblick wusste ich nicht, wo ich ihn hintun sollte. Plötzlich kam mir die Erleuchtung:
»Yes«, sagte ich, »and you are Mr. Ridley!«
Vor 22 Jahren hatten wir uns das letzte Mal im Herzen Asiens gesehen. 40 Jahre lang hatte Ridley mit seiner Familie in Sining-fu an der chinesisch-tibetischen Grenze eine Station der China-Inland-Mission geführt. Und nun trafen wir uns zufällig hier mitten in der Wüste. Wie klein ist doch die Welt!
Ridley, dessen Frau vor Kurzem gestorben war, befand sich auf dem Marsch nach Kaschgar, von wo aus er nach Persien weiterwandern wollte. Er hatte mir seinerzeit bei der Vorbereitung meiner ersten Tibetexpedition geholfen. Er war es auch, der damals als Erster die Nachricht erhielt, ich sei in Nordost-Tibet von den Ngoloken ermordet worden. Dieses Gerücht fand damals bald auch den Weg nach Europa.
Die Chinesen vergötterten ihn, denn Ridley war jener Mann, der mit den Seinen während der furchtbaren Belagerung der Grenzstadt Sining-fu durch die Mohammedaner die Pflege der Verwundeten übernommen hatte. In meinem Buch »Hui-Hui – Asiens Islamkämpfe« ist diese Belagerung mit ihrer Menschenschlächterei und ihren Schrecknissen eingehend geschildert.
Sobald wir die Wüste erreicht hatten, setzte ich bestimmte Tagesetappen fest, um an jedem Abend einen Wasserplatz zu gewinnen. Das lag im Bereich der Möglichkeit, wenn wir täglich 50 bis 60 Kilometer bewältigten. Nur einmal im südlichen Teil der Gobi musste zur Überwindung einer völlig wasserlosen Zone ein Doppelmarsch eingelegt werden.
Die chinesische Regierung, die für die Anlage der Raststationen längs der Karawanenstraße Sorge trägt, hat die Karawansereien der Oasen an arme Leute verpachtet. Sie verkaufen Gras als Futter für die Kamele, die hier ausschließlich als Lastträger verwendet werden. Auch Brennmaterial ist dort erhältlich.
Fast jede Oase besitzt Quellen oder Tümpel mit süßem und salzigem Wasser. Das salzhaltige Wasser soll übrigens von Jahr zu Jahr an Salzgehalt verlieren und allmählich trinkbar werden; doch niemand weiß, worauf dieser Umschlag zurückzuführen ist. Die Eingeborenen trinken das Salzwasser mit dem gleichen Genuss wie das süße. Uns Europäern hingegen ist das Salzwasser schädlich, es verursacht stets schweren Durchfall.
Die Chinesen fürchten nicht mit Unrecht, dass die Oasen der Gobi, die an sich schon sehr eng umgrenzt sind, durch Sandwehen und Sandstürme allmählich verkleinert und schließlich vom Erdboden ganz verschwinden werden. Aber die chinesischen Behörden, denen die Straßen durch die Wüste überaus lebenswichtig sind, haben weitsichtig vorgesorgt, dass auch nach dem Verschwinden der kleineren Oasen noch hinreichend Wasserplätze vorhanden sind. Ab und zu stießen wir mitten in der Wüstenzone auf ganz merkwürdige Erdbauten, deren Zweck wir uns nicht vorstellen konnten, bis sich Beick eines Nachts trotz des strengen Verbots, die Karawanenstraße zu verlassen, an diese, manchmal durch Soldaten scharf bewachten, mit Reisig überdeckten Erdlöcher heranmachte. Er stellte fest, dass jede dieser Zisternen einen lichten Durchmesser von 1,70 Metern hatte und dass die ausgehobene Erde ringsum aufgeschüttet war. Durch Abwurf eines Steines konnte in der Tiefe Grundwasser nachgewiesen werden. Die ungefähr 20 Meter tiefen Zisternen folgen einander in einer Reihe mit Zwischenräumen von je 40 Metern. Die einzelnen Reihen haben Abstände von etwa einem Kilometer. Alle diese Zisternen scheinen in Höhe des Grundwassers durch Kanäle miteinander verbunden zu sein.