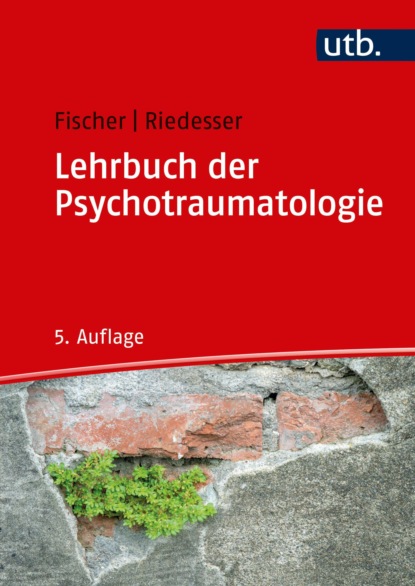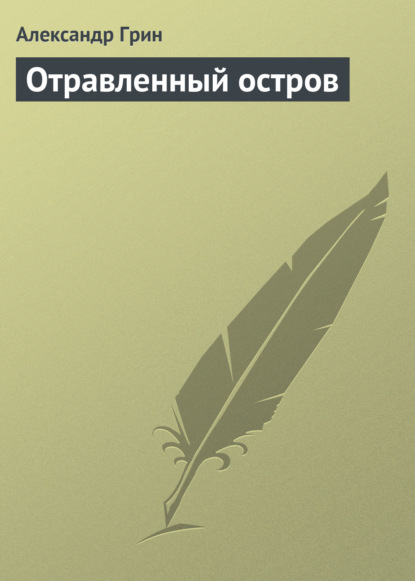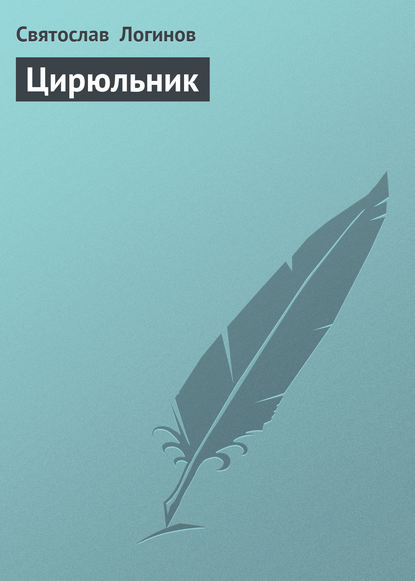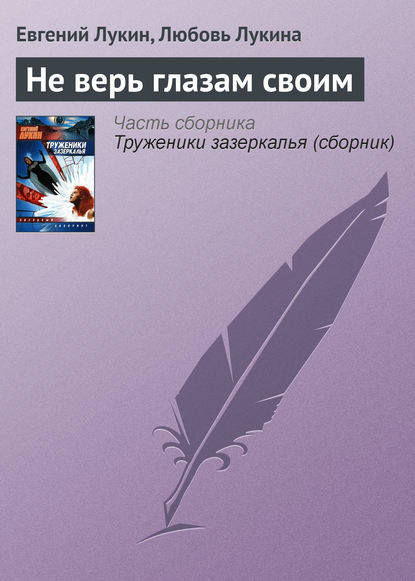- -
- 100%
- +
Untersuchen wir diese Frage am Beispiel von Herrn R. Er hat die Erfahrung von hilflosem Ausgeliefertsein an lebensbedrohliche situative Umstände gemacht, sowohl als Kind wie auch später beim Unfall, beides unter unvorhersehbaren Umständen. Wie soll er nun voraussehen können, wann etwas Unvorhergesehenes geschehen kann und wann nicht? Zudem bilden lebensbedrohliche Situationen aus sich heraus einen ganz besonderen Bedeutungshorizont. Das Erlebnis von → Todesnähe führt von sich aus eine andere Form von „Generalisierung“ herbei. Insofern der Tod den Zeithorizont des Individuums begrenzt und „schließt“, ist er die allgemeinste Kategorie. Der Tod ist die Grenze überhaupt. So ist es nicht verwunderlich, dass eine Erfahrung, die der Todesnähe ausgesetzt ist, „grenzenlos“ verallgemeinert wird. Schon unsere alltäglichen Kategorien bilden wir nicht nach dem induktiven Muster eines allmählichen Aufstiegs vom Einzelnen zum Allgemeinen, sondern, wie u. a. Piaget nachgewiesen hat, zielt jedes kognitive Schema auf Allgemeingültigkeit, die durch zusätzliche Erfahrungsprozesse dann differenziert und modifiziert werden kann. So stellt nicht die Verallgemeinerung der traumatischen Erfahrung das erklärungsbedürftige Phänomen dar, sondern umgekehrt deren Differenzierung. In der dialektischen Terminologie von Hegel gesprochen: Situationen werden nicht als zusammenhanglose Einzelheiten aufgefasst, sondern immer als Besonderung allgemeiner Kategorien und Bedeutungen. So kann auch eine generelle Erschütterung von Welt- und Selbstverständnis beim traumatisierten Individuum durch die Erfahrung besonderer traumatischer Situationen bewirkt werden. Traumatische Situationen werden vom erlebenden Subjekt als „repräsentativ“ für zentrale Aspekte des Weltbildes genommen. Sie führen zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverhältnisses in bestimmten Bereichen oder – wenn sie sich der Erfahrung von Todesnähe verbinden – auch insgesamt. Die therapeutische Veränderung kann sich daher nicht einfach darauf beschränken, eine situationsbezogene Übergeneralisierung zu „löschen“. Vielmehr muss der gesamte Welt- und Selbstbezug des Subjekts, von der physiologischen Ebene über die emotionale Erfahrung bis hin zu kognitiven und, wenn man will, „alltagsphilosophischen“ Mustern der Welt- und Selbsterfahrung so umgearbeitet werden, dass die traumatische Situation verständlich wird im Rahmen der allgemeinen Welterfahrung. Dieses kognitive und emotionale Begreifen der traumatischen Situation in ihrer relativen Position zur sozialen Lebenswelt bestimmt den Weg vom „Opfer“ zum „Überlebenden“ einer traumatischen Erfahrung.
Vor allem durch die Todesdrohung und das Erlebnis von Todesnähe gewinnt die traumatische Situation eine Erlebnisqualität, die wir als → exemplarische Situation bezeichnen wollen. Die exemplarische Situation hat Modellcharakter für die Welterfahrung der traumatisierten Persönlichkeit. Viele Gewaltverbrecher, besonders wenn sie bestrebt sind, ihr Opfer auch seelisch zu verletzen, zielen darauf ab, die Situation für das Opfer zu einer exemplarischen zu machen. In einigen Fällen verwenden sie die Todesdrohung, um die besondere Situation für das Opfer zur allgemeinen zu gestalten. Die meisten Vergewaltiger nutzen die Todesdrohung zumindest implizit auch zu diesem Zweck. Ihr Verhalten zielt nicht auf sexuelle Befriedigung ab. Ihre „Befriedigung“ liegt vielmehr im erschütterten Selbst- und Weltverständnis eines Opfers, das dem Angriff hilflos ausgeliefert und gezwungen ist, den Täter als Herrn über Leben und Tod, als „absoluten Herrn“ (Hegel) anzuerkennen. Dass die exemplarische Extremsituation sich im Alltagsleben nicht ständig wiederholt, macht die Erfahrung – subjekttheoretisch gesehen – nicht weniger bedrohlich, sondern steigert manchmal noch ihre Bedrohlichkeit. Manche Psychoanalytiker haben versucht, die exemplarische Situationserfahrung von Traumaopfern durch den Begriff der „Introjektion“ zu erklären (von intro-iacere = nach innen werfen, sich gewissermaßen „reinziehen“). Die traumatische Situation und der Täter bilden demnach ein „Introjekt“ im Seelenleben des Opfers. Hier handelt es sich um einen räumlich-metaphorischen Versuch, Elemente des → Victimisierungssyndroms zu erklären, den Umstand nämlich, dass viele Opfer unbewusst, über lange Zeit, manchmal sogar lebenslang an die traumatische Erfahrung und den Täter gebunden bleiben. Kognitionstheoretisch ist die traumatische Situation für sie zu einer exemplarischen geworden ohne die Möglichkeit einer Differenzierung und Reorganisation von allgemeinen und besonderen situativen Charakteristika.
Die → Dialektik von Besonderem und Allgemeinem ist auch zu berücksichtigen bei der zeitlichen Dimension des Traumatisierungsprozesses. Wann endet eine traumatische Situation? In objektiver Betrachtungsweise fällt die Antwort leicht. Sie ist dann zu Ende, wenn die reale Bedrohung vorüber ist. Dieser objektive Zugang zielt in der → Situationsanalyse jedoch zu kurz. Ein Beispiel dafür ist die Auffassung einiger deutscher Gutachter nach dem zweiten Weltkrieg bei Ausgleichszahlungen an Holocaustopfer. Einige vertraten im Gefolge der deutschen Psychiater Karl Jaspers und Karl Bonhoeffer die Auffassung, dass der Aufenthalt in einem KZ sicher einen Stressor dargestellt habe. Dieser sei aber nach der Entlassung aus dem Lager vorüber gewesen. Wenn bei den Opfern dennoch Schäden zu beobachten seien, so könnten diese eben nicht auf den Stress des KZ-Aufenthalts zurückgehen, sondern auf konstitutionelle, somatische und psychische Schwächen der Opfer (zur beschämenden Geschichte der deutschen Begutachtung von Naziopfern vgl. Pross 1988, 1995). In Wirklichkeit stellte diese rein objektivistische Argumentation eine Retraumatisierung der Opfer dar oder genauer sogar eine Fortsetzung der Traumatisierung i. S. der → sequenziellen Traumatisierung.
Traumatische Situationen enden nicht nach der objektiven Zeit und nicht per se schon dann, wenn das traumatische Ereignis vorüber ist. Unter subjektiven und inter-subjektiven Gesichtspunkten enden sie, vor allem wenn sie von Menschen verursacht werden erst dann, wenn die zerstörte zwischenmenschliche und ethische Beziehung durch Anerkennung von Verursachung und Schuld wiederhergestellt wurde. Exemplarische Situationen enden nicht einfach, wenn Zeit vergeht. Daher heilt Zeit allein nicht alle Wunden. Vielmehr muss eine qualitativ veränderte Situation entstehen, die die traumatischen Bedingungen in sich „aufhebt“, d. h. sie überwindet und einen qualitativ neuen Anfang erlaubt. Bei dieser Auflösung und Überwindung von traumatischen Situationen sind Schuldanerkennung, Wiedergutmachung, aber auch Fragen von Sühne und Strafe von Bedeutung.
Bei politischer Traumatisierung in totalitären Regimen repräsentieren die oppositionellen Kräfte oft die menschlichen Werte innerhalb eines unmenschlichen Systems. Dennoch oder meistens gerade deshalb wurden sie verfolgt und traumatisiert. Hier ist auch objektiv eine repräsentative Situation entstanden, da der Einzelne als Repräsentant der ausgegrenzten Werte misshandelt wurde, nicht aber ursächlich als „individuelle Person“. Entsprechend erfordert Traumaverarbeitung in totalitären Regimen auch nach deren Zusammenbruch eine dialektische Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem, worin die Repräsentanten der tyrannischen Herrschaft dahin gelangen müssen, das zugrunde gerichtete Wertsystem in sich und ihren Opfern zu erkennen und anzuerkennen. Eine komplementäre Einsicht besteht darin, dass nicht das Opfer „geschändet“, gedemütigt und oft psychophysisch zerstört wurde, sondern der Täter als „menschliches Wesen“ (Fischer 1996).
2.2 Der Riss zwischen Individuum und Umwelt: Peritraumatische Erfahrung im Modell des „Situationskreises“
Extrembelastungen und seelische Verletzung betreffen das menschliche Weltverhältnis in seiner psychophysischen und psychosozialen Gesamtheit. Wir hatten uns in Abschnitt 1.2 mit der Analogie zwischen körperlichen und seelischen Verletzungen befasst und zum Verständnis ein hierarchisches Modell der physisch-psychosozialen Systemebenen herangezogen (vgl. das Modell der Systemhierarchie, Abb. 2). Das Modell sieht so genannte Aufwärts- und Abwärtseffekte vor. Körperliche Verletzungen haben psychische Auswirkungen und seelische Verletzungen können körperliche Folgen nach sich ziehen. Wir werden uns im Folgenden mit einem Modell befassen, das uns das Zusammenspiel der Systemebenen verständlicher machen kann. Es wurde in seinen Grundzügen in der Biologie entwickelt von Jakob von Uexküll, um die Orientierung der Tiere in ihrer Lebenswelt, gewissermaßen deren Welt- und Situationsverständnis nachvollziehbar zu machen. Thure von Uexküll hat es zu einem Modell der Humanmedizin weiterentwickelt, um Krankheitsverläufe integrativ auf den unterschiedlichen Ebenen psychosozialer und somatischer Phänomene studieren zu können. Er nannte dieses integrierende Konzept vom Zusammenspiel des Menschen mit seiner Umwelt das Modell vom „Situationskreis“. Zusammen mit Wesiack hat von Uexküll dieses Modell fortlaufend weiter ausdifferenziert und für unterschiedliche biologische und psychosoziale Fragestellungen fruchtbar gemacht.
An unsere bisherigen Bemühungen um ein integratives, „synthetisches“ Verständnis der traumatischen Erfahrung schließt dieses Modell auch insofern an, als es ebenfalls mit dem Situationsbegriff arbeitet, der im vorigen Abschnitt als heuristischer Bezugsrahmen für die Traumaanalyse eingeführt wurde. Der Situationsbegriff verpflichtet bei v. Uexküll ebenso wie im phänomenologischen Ansatz zur systematischen Verbindung von Innen- und Außenbetrachtung, von Erleben und Verhalten. Auch biologische Funktionen lassen sich im Modell des Situationskreises (Abb.3) aus der Innenperspektive verstehen. So leistet das Modell einen Beitrag zu einer „subjektiven Biologie“ bzw. „Biologie des Subjekts“, als deren Pionier in Deutschland Jakob von Uexküll genannt werden kann.

Erklärung: Individuum und Umgebungsfaktoren sind zirkulär aufeinander bezogen. Ihre Verbindung wird symbolisiert durch die beiden Teilkreise, von denen der obere die rezeptorische Sphäre, die verschiedenen Sinneswahrnehmungen repräsentiert, der untere die effektorische Sphäre des Organismus, also Handlungen und Handlungsdispositionen.
Abbildung 3: Modell des Situationskreises nach Uexküll und Wesiack (1988)
Jakob von Uexküll hatte die beiden Teilsphären als Merk- und Wirkwelt der Organismen unterschieden. Merk- und Wirkwelt sind durch die organische Ausstattung der Lebewesen vorstrukturiert. Die rezeptorische Sphäre reagiert auf eine bestimmte Problemsituation in der Umgebung. Der Organismus bzw. das Individuum entwickelt eine Lösungsstrategie, die über die effektorische Sphäre günstigenfalls die Ausgangslage erfolgreich verändert, so dass der Kreis zwischen Merken und Wirken geschlossen und die Harmonie, eine wie v. Uexküll und Wesiack schreiben, Beziehung der Synthesis zwischen Organismus bzw. Individuum und Umwelt wieder hergestellt ist.
Im Inneren des Zirkels ist nun eine „kognitive“ Sequenz der Bedeutungszuschreibung eingetragen, in der sich tierisches und menschliches Verhalten von einander unterscheiden. Gemeinsam ist zunächst, dass sowohl Tiere wie Menschen aufgrund von „Bedeutungen“ handeln, die sie ihrer Umgebung zuschreiben. Die Bedeutungszuschreibung oder Bedeutungserteilung verwandelt Umgebung in Umwelt (Lagebestimmungen in situative Gegebenheiten, um an den phänomenologischen Situationsbegriff anzuknüpfen). Durch gelingende Bedeutungserteilung sind die Lebewesen zu effektivem Handeln in der Lage. Beim Menschen hat sich diese → semiotische Zwischensphäre des Umgangs mit Bedeutungen komplex ausdifferenziert. Durch „Probehandeln“ (Freud) im Denken, Durchspielen von Plänen und Handlungsresultaten in der Phantasie hat sich der menschliche Weltbezug im Vergleich zum tierischen vom → „Funktionskreis“ zum „Situationskreis“ erweitert. Während die Tiere mit ihrer Umgebung in einer funktionalen (im Sinne der „funktionalen Norm“), teilweise reflexgesteuerten Verbindung stehen – so wie auch der menschliche Organismus auf der Ebene des vegetativen und animalischen Nervensystems – haben die Fähigkeiten des Menschen im Gebrauch von Zeichen und Symbolen, insbesondere sein Umgang mit Sprache oder sprachähnlichen Zeichensystemen zur Öffnung des Funktionskreises geführt und zu seiner Verwandlung in die vergleichsweise reaktionsoffene Umweltbeziehung des Situationskreises. Die → semiotisch-kognitiven Möglichkeiten verschaffen auch der Individualisierung des Menschen einen größeren Raum. Prozesse der Bedeutungsverarbeitung und -zuschreibung sind stärker als bei den Tieren durch die persönliche Lebensgeschichte und deren individuelle Verarbeitung bestimmt. Wer z. B. Krankheitssymptome oder symptomatische Verhaltensweisen aus der Innenperspektive, dem Situationsverständnis des Patienten heraus verstehen will, muss sich empathisch mit dessen individueller Wirklichkeitskonstruktion befassen, die nur aus seiner besonderen Lebensgeschichte verständlich wird.
Rezeptorische und effektorische Sphäre sind antizipatorisch aufeinander abgestimmt. Die Situationswahrnehmung wird strukturiert durch antizipierte Handlungsmöglichkeiten. Sensorische Rezeption oder Wahrnehmung besteht also nicht in „passiver Reizaufnahme“. Sie ist vielmehr aktiv auswählend und insofern bedeutungserteilend. Die Wahrnehmung ist ihrerseits motiviert durch einen Mangelzustand, der das Gleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt vorübergehend stört, so dass eine Problemsituation entsteht. Die semiotische Zwischensphäre von Bedeutungsunterstellung, -erprobung und -erteilung ermöglicht beim Menschen ein intelligentes problemlösendes Handeln, das den Gleichgewichtszustand zwischen Individuum und Umwelt wieder herstellt.
Harmonie oder Synthesis von Organismus und Umwelt wird gewährleistet durch interne Regulationssysteme, die wir mit Piaget als „Schemata“ bezeichnen können. Schemata unterliegen Piaget zufolge einem Regulationsprinzip mit zwei verschiedenen Funktionen, dem Assimilations- und Akkommodationsvorgang. Ist keine Problemsituation vorhanden, so ist das → Schema aktiv, indem es sich die Umgebungskonstellation assimiliert (= sich angleicht oder „anähnelt“), d. h., sie in „Umwelt“ verwandelt. In diesem Falle setzt die Umgebung der Reproduktion des Schemas keinen Widerstand entgegen. Tritt aber eine Problemsituation auf, so muss das Schema so lange umgearbeitet werden, bis das Problem durch effektives Handeln gelöst werden kann. Die Funktion, die das Schema intern reorganisiert, bezeichnen wir mit Piaget als Akkommodation. Ist sie erfolgreich, so kann die Umweltsituation wieder problemlos assimiliert werden. Die Akkommodation führt so zu einer neuen Assimilation, die Anpassung zur gelingenden „Einpassung“ (von Uexküll und Wesiack) des Organismus bzw. des Individuums in seine Umwelt, in eine → „ökologische Nische“.
Der Schemabegriff. Die inneren Strukturen oder Systeme, die im Situationskreis die Feinabstimmung zwischen Individuum und Umwelt leisten, können wir als rezeptorisch-effektorische Schemata bezeichnen, oder auch mit Jean Piaget als sensorisch-motorische Schemata (kurz sensomotorische Schemata). Piaget beruft sich mit diesem Konzept wiederholt auf die biologischen Arbeiten Jacob von Uexkülls. Thure von Uexküll und Wesiack beziehen ihrerseits Piagets Schemakonzept in das Modell vom Situationskreis ein. Auch in der modernen kognitiven Psychologie hat sich das Schemakonzept als ein zentrales heuristisches Instrument zur Untersuchung kognitiver Strukturen und Funktionen bewährt (z. B. Neisser 1967, 1976). Der Kern des Schemakonzepts ist hier – wie auch im Funktions- bzw. Situationskreis – das Zusammenspiel von rezeptorischer und effektorischer Sphäre, von Wahrnehmung und Handlung.
Piaget hat gezeigt, dass die Organisation der Orientierungsschemata im Laufe der menschlichen Entwicklung eine strukturelle Stufenfolge durchläuft. Grundlage bleibt die sensomotorische Stufe der Intelligenzentwicklung, also die im Situationskreis modellierte Koordination von rezeptorischer und effektorischer Sphäre. In der Entwicklungsphase der sensomotorischen Intelligenz (0-18 Monate) besteht die wesentliche Leistung darin, Handlung und Wahrnehmung immer genauer zu koordinieren. Mit etwa 1 1/2 Jahren, im Übergang zum symbolisch vorbegrifflichen Denken (bis 4. Lebensjahr) ereignet sich, was Piaget die kopernikanische Revolution der Intelligenzentwicklung nennt: Symbol und Vorstellungsbild verselbständigen sich bis zu einem gewissen Grade gegenüber den bis dahin eingespielten Kreisläufen der Wahrnehmungs- und Handlungskoordination. Hier tritt – mit anderen Worten – das Kind in die Welt spezifisch menschlicher Bedeutungsverarbeitung ein. Allem Anschein nach ist dieser Zugang zur menschlichen Symbolwelt, die Ablösung aus dem „symbiotischen Funktionskreis“ (von Uexküll und Wesiack 1988, 341) mit emotionalen Krisen verbunden. Das Kind löst sich aus der Unmittelbarkeit der sinnlichen Erscheinungen und gewinnt einen ersten Zugang zur Sphäre der Symbole. Es handelt sich um den gleichen Entwicklungszeitraum, den Margaret Mahler (Mahler et al. 1975) als Separations-Individuationsphase beschreibt.
Gegen Ende des ersten Lebensjahres bildet sich die „Gegenstandspermanenz“, die Fähigkeit des Kindes, eine Vorstellung auch von verdeckten oder verschwundenen Gegenständen innerlich festzuhalten und obgleich sie unsichtbar sind, weiter nach ihnen zu suchen. Von der Gegenstandspermanenz zu unterscheiden ist die sog. „Objektkonstanz“ oder „Beziehungskonstanz“ (Fischer 1987, 300), die Fähigkeit, eine konstante innere Repräsentanz des Liebesobjekts auch in Abwesenheit oder emotionalen Belastungssituationen aufrechtzuerhalten.
Die „Beziehungsschemata“ (s. u.) des Kindes haben hier ein neues Niveau der Selbstregulation und Autonomie erreicht, das für die weitere psychische Entwicklung von großer Bedeutung ist. Die Ablösung des Denkens, der kognitiven Schemata von der sinnlichen Unmittelbarkeit durchläuft noch folgende unterscheidbare Stufen: Das anschauungsgebundene Denken von 4-7 Jahren; die konkreten Denkoperationen von 7–12 und die formalen Operationen ab 12 Jahren. Erst im Stadium der formalen Operationen können, wie schon in Abschnitt 1.2 ausgeführt, psychische Abläufe kognitiv repräsentiert werden und damit auch Traumata als „seelische Verletzungen“. Im Bereich des logischen Denkens können Kinder „Hypothesen über Hypothesen“, also Hypothesen zweiter Stufe bilden und sich in ihren Denkoperationen auf „geistige Inhalte“, auf Hypothesen erster Stufe beziehen. Damit werden jene reflexiven und selbstreflexiven Fähigkeiten des Menschen voll ausgebildet, die wir im Modell des Funktions- bzw. Situationskreises als „Merken des Merkens“ und als „Merken des Wirkens“ bezeichnen können. Unser Wahrnehmen wahrzunehmen oder unsere Denkprozesse zu beobachten, setzt Fähigkeiten voraus, die in diesem Stadium erworben werden. Basseches (1980) konnte nachweisen, dass auf das Stadium der formalen Operationen noch eine weitere Stufe der kognitiven Entwicklung folgt, die wir als Stadium der dialektischen Operationen bezeichnen. → Dialektisches Denken ist in besonderem Maße ein integratives Denken, das Widersprüche analysiert und sie „aufhebt“ durch Bildung übergeordneter Konzepte. Ansätze der dialektischen Operationen und zu einer Kompetenz in dialektischem Denken finden sich natürlich schon in früheren Stadien der kognitiven und emotionalen Entwicklung, vor allem an den Übergängen zwischen den Entwicklungsstufen. Das Bestreben, widersprüchliche, dissoziierte Schemata zu integrieren, ist der Motor für die Entwicklung eines in sich kohärenten Selbstsystems, das wir mit Bezug auf die integrierende Instanz als → Ich-Selbstsystem bezeichnen wollen. Dialektisches, integrierendes Denken, Aufarbeiten widersprüchlicher oder in sich gespaltener Schemata ist die Voraussetzung dafür, dass die Person situationsübergreifende „Metaschemata“ ausbilden kann, welche die situationsspezifischen Schemata koordinieren, um die Kontinuität des Handelns in der Lebensgeschichte zu gewährleisten. Durch traumatische Erfahrungen kann besonders diese interne Koordination der Schemata über verschiedene Entwicklungsstufen hinweg beeinträchtigt werden. Traumatische Situationserfahrungen sind in den verfügbaren Schemavorrat nur schwer oder manchmal auch nicht integrierbar. So können schon erreichte Koordinationsstufen, wie die Beziehungskonstanz, regressiv wieder verlassen werden, so dass sich einzelne, in sich gespaltene Teilschemata und Erlebniszustände verselbständigen. Zudem erschwert die traumatische Umwelterfahrung jene Koordination, Überarbeitung und reflexive Umkehr des schematischen Wissensbestands, die für den Übergang zu höheren Stufen der kognitiv-emotionalen Entwicklung notwendig ist.
Schematisiertes, intelligentes Wissen, das der Mensch im Laufe seiner Lebensgeschichte erwirbt, ist hinsichtlich sozialer und gegenstandsbezogener Komponenten zu unterscheiden. Diese Unterscheidung wird oft nicht mit der wünschenswerten Klarheit vorgenommen. Jene Strukturen, die sozial-emotionale Wissensbestände regeln, bezeichnen wir als Beziehungsschemata. Kognitive Schemata, die in erster Linie sachbezogene Wissensbestände koordinieren, hingegen als Gegenstandsschemata. Manchmal wird hier auch die Unterscheidung zwischen kognitiven versus sozialkognitiven Schemata vorgeschlagen, die jedoch in mancher Hinsicht problematisch ist. Beziehungsschemata sind nicht nur kognitiver Art, sie sind vielmehr besonders eng mit Emotionen, Affekten, Triebwünschen und Stimmungslagen verbunden. Sie entsprechen weitgehend dem, was in der Psychoanalyse als Beziehung zwischen Selbst- und Objektrepräsentanzen bezeichnet wird (Fischer 1996, 67 passim). Im Einzelnen umfassen sie Bilder oder Konzepte vom Selbst, dem Anderen oder Beziehungspartner, sowie eine Regel für deren gegenseitiges Beziehungsverhalten in umschriebenen Interaktionssituationen. Beziehungsschemata können situationsspezifisch oder stärker generalisiert sein. In den stärker verallgemeinerten Beziehungsschemata, die wiederum sehr viele situationsspezifische koordinieren, bezeichnen wir das koordinierende Regelsystem als Script (vgl. Abschnitt 2.1; ferner Horowitz 1991; Singer und Salovey 1991; Stinzen und Palmer 1991). „Traumatische Erfahrungen“, die in den Gesamtbestand der Beziehungsschemata und ihre Koordinationsregeln nicht aufgenommen werden können, führen zu aufgespaltenen, dissoziierten Schemata und in sich widersprüchlichen „Koordinationsregeln“ oder Scripts.
Zur Bezeichnung für die regulativen Strukturen unseres Wissensbestandes, die sich auf den sachlich-gegenständlichen Umweltbereich beziehen, schlagen wir den Terminus Sachschemata oder Gegenstandsschemata vor. Der wesentliche interne Unterschied zwischen Sach- und Beziehungsschema ist das Kriterium der sozialen „Wechselseitigkeit“ (Fischer 1981). Beziehungsschemata bauen auf der sozialkognitiven Struktur einer Perspektivenhierarchie auf, auf der Annahme, dass der andere mich und mein Weltverhältnis ebenso antizipieren kann wie ich das seine, was im Umgang mit Sachobjekten natürlich nicht der Fall ist. Die meisten alltäglichen Interaktionssituationen erfordern allerdings den koordinierten Einsatz von Sach- und Beziehungsschemata, das Zusammenspiel von „interpersoneller und gegenständlicher Orientierung in der sozialen Interaktion“ (Fischer 1981). Auch viele entwicklungspsychologische Stadien und Stufenübergänge lassen sich aus der Koordination von gegenständlichen und interpersonellen Schemata begreifen (Fischer, 1981, 1986a). Nach Uexküll und Wesiack differenzieren Sachschemata sich erst allmählich aus dem „symbiotischen Funktionskreis“, den primären sensomotorischen und affektiven Beziehungsschemata heraus (1988). Unsere sachbezogenen Schemata werden nach diesen Autoren vom → pragmatischen Realitätsprinzip reguliert, dem Prinzip des erfolgskontrollierten Handelns, die Beziehungsschemata dagegen vom → kommunikativen Realitätsprinzip, worin der Andere als Kommunikations- und Dialogpartner anerkannt und behandelt wird. In mancher Hinsicht eine Verbindung von beiden stellt das → psychische Realitätsprinzip dar, dessen Kriterium darin besteht, zwischen den Erfordernissen pragmatischer und kommunikativer Realität einerseits, den Bedürfnissen des Individuums und seiner „Selbstgegenwart“ andererseits erfolgreich zu vermitteln – eine Funktion, die im psychoanalytischen Strukturmodell dem „Ich“ zugeschrieben wird.
Die Unterscheidung von Sach- und Beziehungsschemata ist psychotraumatologisch u. a. von Bedeutung, wenn wir die Auswirkung jeweils von Naturkatastrophen („natural disasters“) und Katastrophen mit menschlicher Verursachung („man-made-disasters“ oder disasters „of human origin“) miteinander vergleichen wollen. Im einen Fall wird unser pragmatisches, im anderen unser → kommunikatives Realitätsprinzip mehr oder weniger nachhaltig erschüttert oder infrage gestellt.